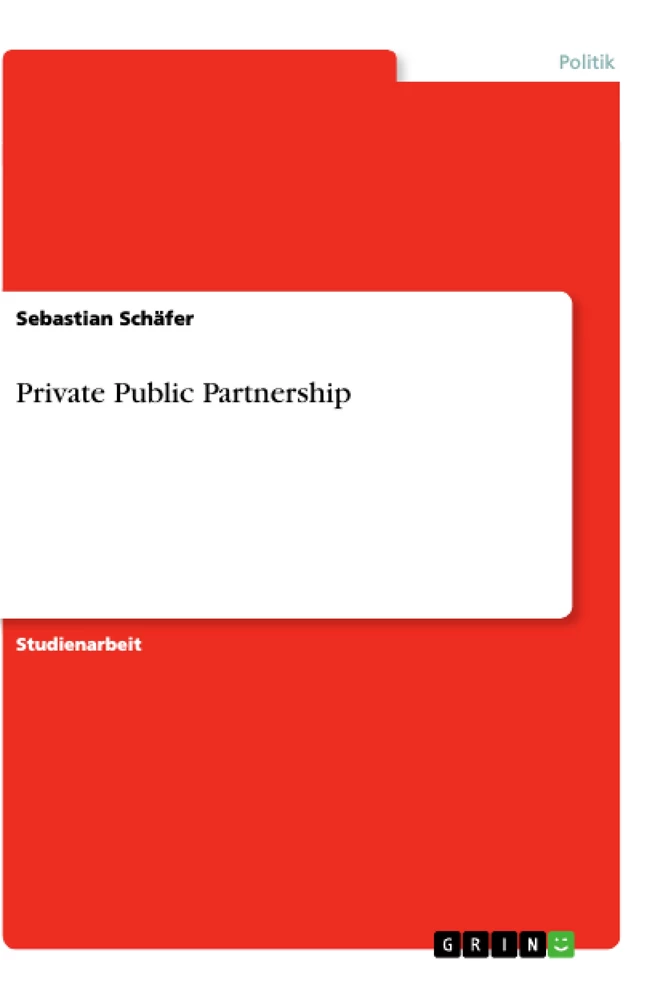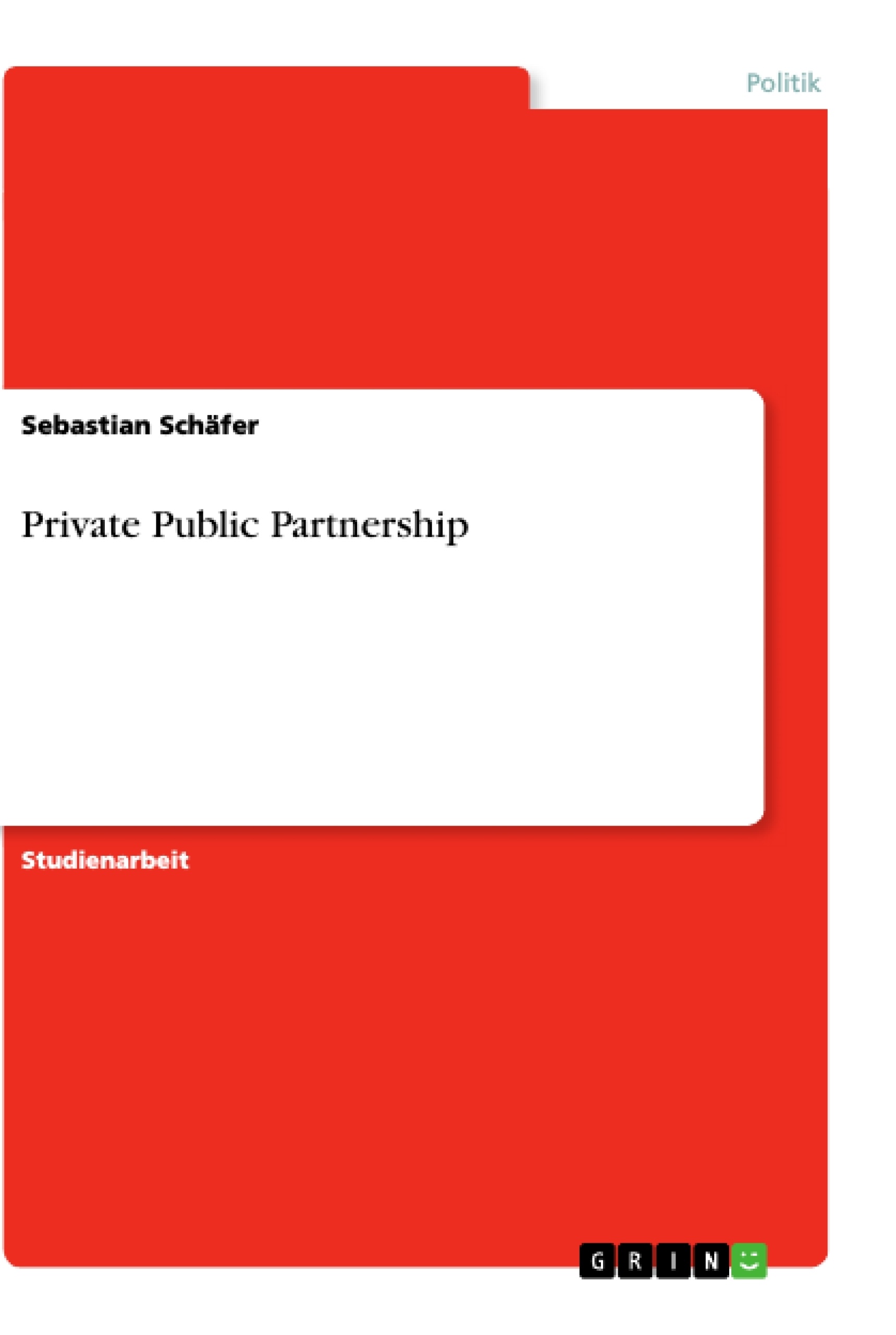Diese Ausarbeitung diskutiert Public-Private-Partnerships. Sie gibt einen kurzen historischen Rückblick, stellt die Vor- und Nachteile sowie Chancen und Risiken von PPP vor. Bei Public-Private Partnerships oder vielmehr Öffentlich-Privaten Partnerschaften (ÖPP) handelt es sich um Kooperationen zwischen privaten Unternehmen und der öffentlichen Hand, die gemeinsam eine öffentliche Aufgabe erledigen. Dabei lässt sich nicht jede Kooperation zwischen öffentlicher und privater Hand als PPP bezeichnen. Vielmehr gibt es Kriterien, die eine Public-Private Partnership ausmachen. Zum einen sollte die Kooperation langfristig bestehen, zum anderen werden die aus den zu erfüllenden Aufgaben resultierenden Ressourcen zusammengeführt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Begriffserklärung
- II. Rechtliche Grundlage
- III. Ziele
- IV. Historische Betrachtung
- V. Arten von PPP
- V.I Kooperationsmodell
- V.II Leasing- und Mietmodell
- VI. Chancen und Risiken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit Public-Private Partnerships (PPP) und deren Bedeutung für die öffentliche Hand. Sie untersucht die rechtlichen Grundlagen, die verschiedenen Modelle von PPP, die Chancen und Risiken dieser Kooperationsform und stellt die historische Entwicklung von PPP dar.
- Rechtliche Grundlagen von PPP
- Ziele und Herausforderungen von PPP
- Verschiedene Modelle von PPP
- Historische Entwicklung und Bedeutung von PPP
- Chancen und Risiken von PPP
Zusammenfassung der Kapitel
I. Begriffserklärung
Dieses Kapitel definiert den Begriff Public-Private Partnership (PPP) und erklärt die Unterscheidung zwischen PPP und Privatisierung. Es wird hervorgehoben, dass PPP eine langfristige Kooperation zwischen öffentlicher Hand und privaten Unternehmen darstellt, die gemeinsam eine öffentliche Aufgabe wahrnehmen.
II. Rechtliche Grundlagen
Das Kapitel beleuchtet die rechtlichen Grundlagen von PPP, insbesondere das ÖPP-Beschleunigungsgesetz, das die Umsetzung von PPP-Projekten erleichtern soll. Es werden die wesentlichen Änderungen im Vergaberecht, der Vertragsgestaltung und steuerlichen Vorgaben im Rahmen des Gesetzes erläutert.
III. Ziele
Der Fokus dieses Kapitels liegt auf den Zielen, die von der öffentlichen Hand und dem privaten Partner bei einer PPP verfolgt werden. Es wird der Zielkonflikt zwischen Gewinnmaximierung des privaten Partners und Gemeinwohlorientierung der öffentlichen Hand hervorgehoben.
IV. Historische Betrachtung
Dieses Kapitel zeichnet die historische Entwicklung von PPP nach. Es zeigt, dass bereits in den 1920er Jahren Formen der Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und privaten Unternehmen existierten, die den heutigen PPP-Modellen ähneln. Die Einführung des Begriffs „PPP“ in den 1980er Jahren hat die politische Auseinandersetzung mit dieser Kooperationsform intensiviert.
V. Arten von PPP
Das Kapitel beschreibt die verschiedenen Modelle von PPP, wobei die Unterscheidung zwischen Finanzierungsmodellen und Organisationsmodellen im Vordergrund steht. Zwei Modelle, das Kooperationsmodell und das Leasing- und Mietmodell, werden anhand von Beispielen näher erläutert.
Schlüsselwörter
Public-Private Partnership, ÖPP, Öffentlich-Private Partnerschaft, Infrastrukturinvestitionen, Aufgabenwahrnehmung, Kooperationsmodell, Leasing- und Mietmodell, Rechtliche Grundlagen, ÖPP-Beschleunigungsgesetz, Ziele, Gemeinwohl, Gewinnmaximierung, Historische Entwicklung, Daseinsvorsorge.
- Quote paper
- Sebastian Schäfer (Author), 2020, Private Public Partnership, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/542151