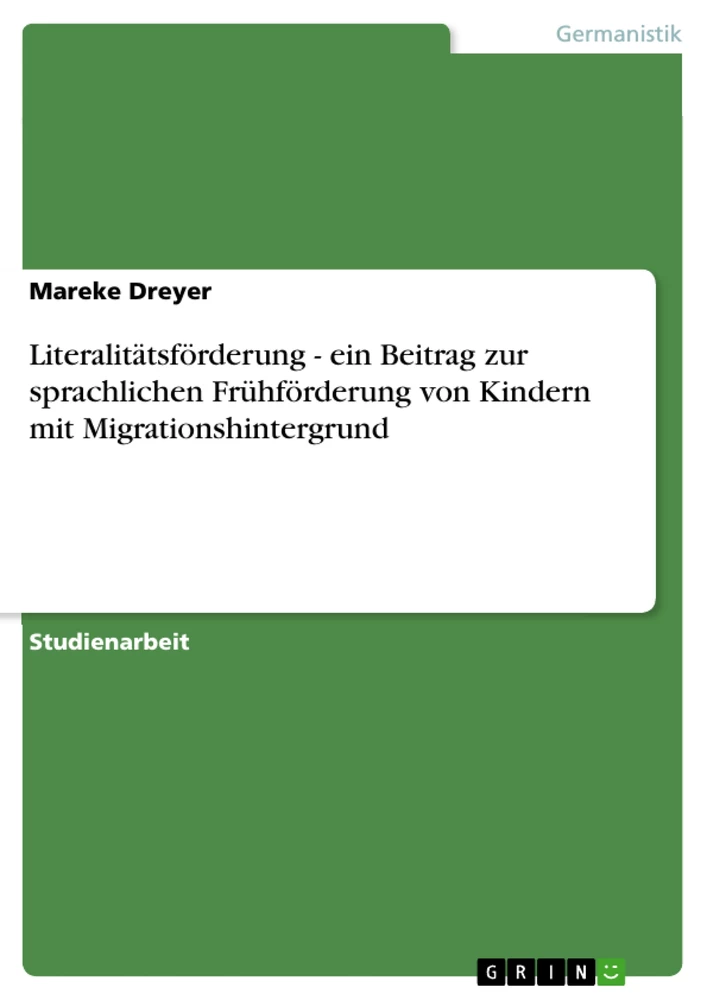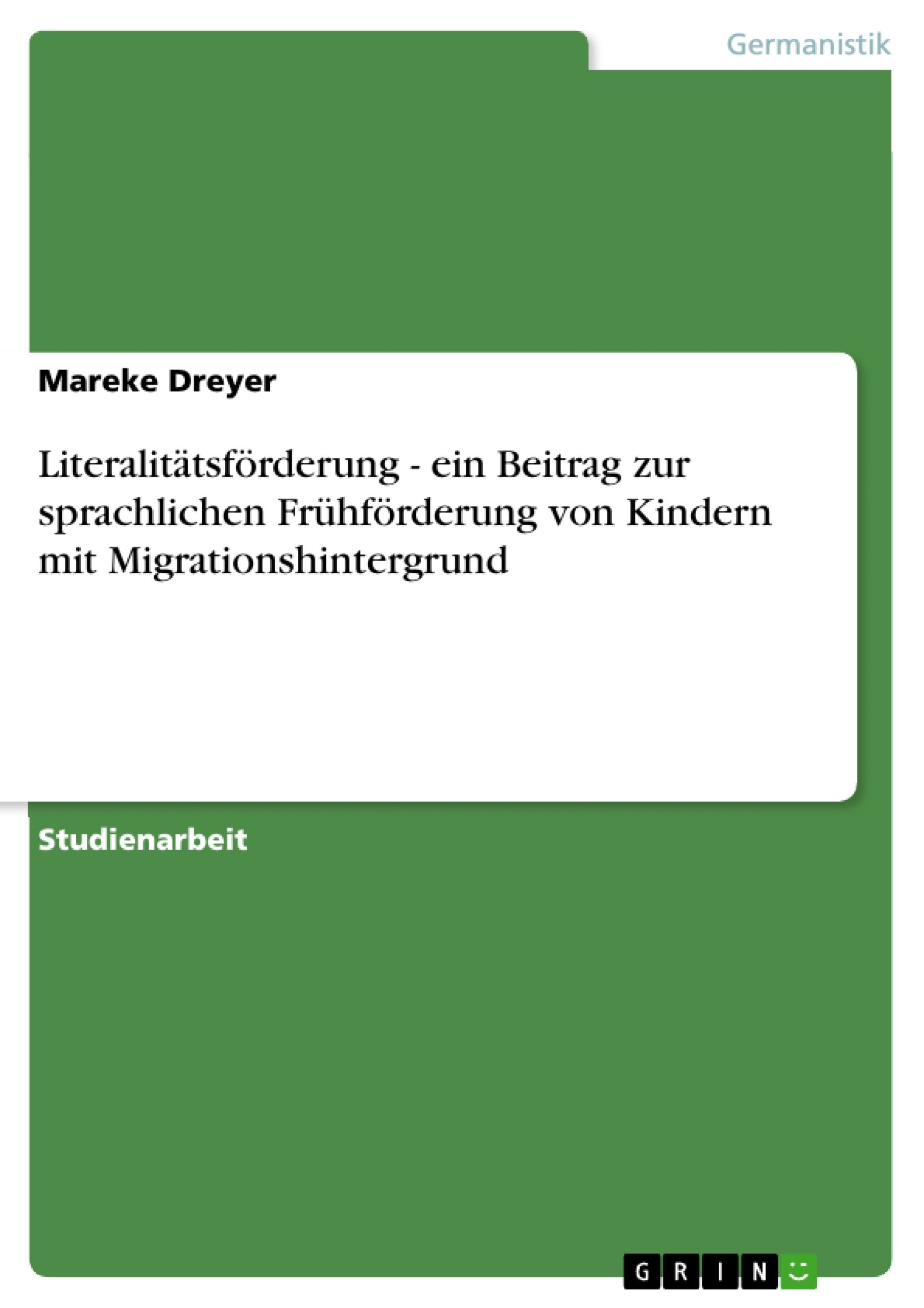Die PISA-Studie aus dem Jahre 2000 hat in Bezug auf die getestete Sprachkompetenz vor allem im Bereich der Lesekompetenz den deutschen Schülerinnen und Schülern ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. So erreichten 23% der 15-Jährigen lediglich die unterste von 5 Lesekompetenzstufen, das heißt, sie können einfache Texte oberflächlich verstehen und besitzen elementare Lesefertigkeiten. Mit diesen Fähigkeiten gehören sie jedoch in unserer Informationsgesellschaft zur Risikogruppe zukünftiger Arbeitsloser und Sozialhilfeempfänger, weil sie aufgrund ihrer mangelhaften Textkompetenz nur schwer Zugang zu einer qualifizierten Aus- und späteren Fortbildung haben. Auch Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Erstsprache gehören zu dieser Gruppe. Es ist jedoch auffällig, dass fast die Hälfte der Jugendlichen aus Familien mit Migrationshintergrund diese erste Lesekompetenzstufe nicht überschreiten. Für das schlechte Abschneiden der Jugendlichen an deutschen Schulen wurden zwei Hauptursachen ausgemacht: Erstens gäbe es hierzulande einen besonders hohen Anteil an Kindern, die Deutsch als Zweitsprache sprechen, und zweitens würden Kinder in Deutschland in der Zeit vor ihrem Schulbesuch zu wenig gefördert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- PISA und Sprachförderung
- Tests
- Sprachliche Fördermaßnahmen vor PISA
- Sprachliche Fördermaßnahmen nach PISA
- Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen
- Sprachförderung an der Schnittstelle zwischen Elementar- und Primarbereich
- Schwierigkeiten an der Schnittstelle Elementar- und Primarbereich
- Literalität
- Aspekte von Literalität
- Anbahnung von Literalität
- Situation von Migrantenfamilien im Hinblick auf Literalität
- Bedeutung der Erstsprache
- Neue Formen der sprachlichen Frühförderung
- Family Literacy
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der PISA-Studie auf die Sprachförderung in Deutschland, insbesondere im Hinblick auf Kinder mit Migrationshintergrund. Sie analysiert den Zusammenhang zwischen mangelnder Lesekompetenz und dem Bildungshintergrund der Eltern. Darüber hinaus befasst sich die Arbeit mit dem Konzept der Literalität und seiner Bedeutung für die sprachliche Frühförderung im Vorschulbereich.
- Sprachförderung von Kindern mit Migrationshintergrund
- Einfluss der PISA-Studie auf die Bildungssysteme
- Das Konzept der Literalität und seine Rolle in der Sprachförderung
- Entwicklung und Wirksamkeit von Frühförderungsprogrammen
- Bedeutung der Erstsprache für den Spracherwerb
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die Ergebnisse der PISA-Studie aus dem Jahr 2000, die die Lesekompetenz deutscher Schülerinnen und Schüler als unzureichend bewertete. Sie hebt die besondere Herausforderung für Kinder mit Migrationshintergrund hervor, die im Hinblick auf die Lesekompetenz besonders benachteiligt sind. Die Einleitung begründet die Notwendigkeit von frühkindlicher Sprachförderung und führt in die folgenden Kapitel ein.
2. PISA und Sprachförderung
Dieses Kapitel analysiert die Rolle der PISA-Studie in der Diskussion um Sprachförderung. Es setzt sich mit den Ursachen für die schlechten Leseleistungen auseinander, wobei der Fokus auf den hohen Anteil von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache und die unzureichende Förderung im Vorschulbereich liegt. Das Kapitel beleuchtet verschiedene Testverfahren zur Erfassung des Sprachentwicklungsstandes von Vorschulkindern und beleuchtet die Bedeutung der Muttersprache für den Spracherwerb.
2.1. Tests
Dieses Kapitel untersucht die methodischen Ansätze und Vorgehensweisen von Sprachstandserhebungen im Vorschulbereich. Es hinterfragt kritisch, ob die Tests lediglich die Sprachbeherrschung in der deutschen Sprache erfassen und die Bedeutung der Muttersprache vernachlässigen.
2.2. Sprachliche Fördermaßnahmen vor PISA
Das Kapitel beleuchtet frühe Ansätze zur Sprachförderung von Kindern mit verschiedenen Muttersprachen in den 1990er Jahren. Es betrachtet, wie sich der Fokus auf die Interkulturelle Erziehung mit der Förderung des respektvollen Umgangs miteinander und dem Abbau von Vorurteilen auseinandersetzte. Es stellt fest, dass bereits damals wichtige Aktivitäten zur Sprachförderung eingesetzt wurden, jedoch eine systematische Evaluierung und Erhebung der Sprachkompetenz noch ausstand.
2.3. Sprachliche Fördermaßnahmen nach PISA
Dieses Kapitel untersucht die unterschiedlichen Förderansätze in verschiedenen Bundesländern nach der Veröffentlichung der PISA-Studie. Es stellt fest, dass es in einigen Bundesländern spezielle Maßnahmen zwischen Test und Schulbeginn gibt, während in anderen Bundesländern die Förderung in eigenen Sprachlernklassen erfolgt. Der Abschnitt erläutert, wie diese Ansätze den unterschiedlichen Bedürfnissen von Kindern mit Migrationshintergrund gerecht werden sollen.
2.3.1. Sprachliche Förderung in Kindertagesstätten
Dieses Kapitel betont die Bedeutung von Sprachförderung in Kindertagesstätten, die sowohl Kinder mit deutscher als auch mit einer anderen Muttersprache zugutekommt. Es erläutert, wie die Sprachstände deutscher Kinder sinken und die Notwendigkeit für gezielte Förderung im Kindergartenalltag besteht. Der Abschnitt beleuchtet die Integration des multikulturellen Aspekts in die Sprachförderung und stellt fest, wie die Sprachentwicklung aller Kinder gefördert werden kann.
3. Literalität
Das Kapitel führt in das Konzept der Literalität ein, welches für den Prozess des Leselernens und die Sprachförderung relevant ist. Es beschreibt verschiedene Aspekte von Literalität und erläutert, wie sie in der frühkindlichen Bildung angebahnt werden kann. Darüber hinaus analysiert es die Situation von Migrantenfamilien im Hinblick auf Literalität und betont die Bedeutung der Erstsprache für den Spracherwerb.
3.1. Aspekte von Literalität
Dieser Abschnitt beleuchtet verschiedene Aspekte von Literalität, die für den Erwerb von Lese- und Schreibkompetenz relevant sind. Er erklärt, wie Literalität im Kontext von Sprachförderung verstanden werden kann und welche Faktoren entscheidend für die Entwicklung von Lesekompetenz sind.
3.2. Anbahnung von Literalität
Dieser Abschnitt erläutert, wie Literalität im frühen Kindesalter angebahnt werden kann. Er stellt verschiedene Ansätze und Strategien vor, die Eltern und Erzieherinnen nutzen können, um die Voraussetzungen für den späteren Leselernprozess zu schaffen.
3.3. Situation von Migrantenfamilien im Hinblick auf Literalität
Dieser Abschnitt beleuchtet die besondere Situation von Migrantenfamilien im Hinblick auf Literalität. Er analysiert, wie die sprachliche und kulturelle Umgebung der Familie den Zugang zu Literalitätsangeboten beeinflusst und welche Herausforderungen im Kontext von Mehrsprachigkeit bestehen.
3.4. Bedeutung der Erstsprache
Dieser Abschnitt betont die Bedeutung der Erstsprache für den Spracherwerb und die Entwicklung von Literalität. Er zeigt auf, wie die Stärkung der Erstsprache den Erwerb der Zweitsprache fördert und die Basis für erfolgreiches Lesen und Schreiben legt.
4. Neue Formen der sprachlichen Frühförderung
Das Kapitel stellt neue Formen der sprachlichen Frühförderung vor, die sich an den Bedürfnissen von Kindern mit Migrationshintergrund orientieren. Es beleuchtet insbesondere den Ansatz der "Family Literacy", der die Einbindung der Familie in die Förderung des Leselernens und die Entwicklung von Literalität betont.
4.1. Family Literacy
Dieser Abschnitt beschreibt den Ansatz der "Family Literacy" und erläutert, wie dieser Ansatz die Vernetzung von Familie und Kindergarten fördert. Es erklärt, wie die Familie aktiv an der sprachlichen Förderung beteiligt werden kann und welche Vorteile dieser systemische Ansatz für die Entwicklung von Lesekompetenz bietet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Sprachförderung, Lesekompetenz, PISA-Studie, Migrationshintergrund, Literalität, Frühförderung, Kindertageseinrichtungen, Family Literacy und Erstsprache. Die Schwerpunkte liegen auf der Entwicklung und Wirksamkeit von Sprachförderprogrammen sowie der Bedeutung der Erstsprache für den Spracherwerb.
- Quote paper
- Mareke Dreyer (Author), 2006, Literalitätsförderung - ein Beitrag zur sprachlichen Frühförderung von Kindern mit Migrationshintergrund, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/54172