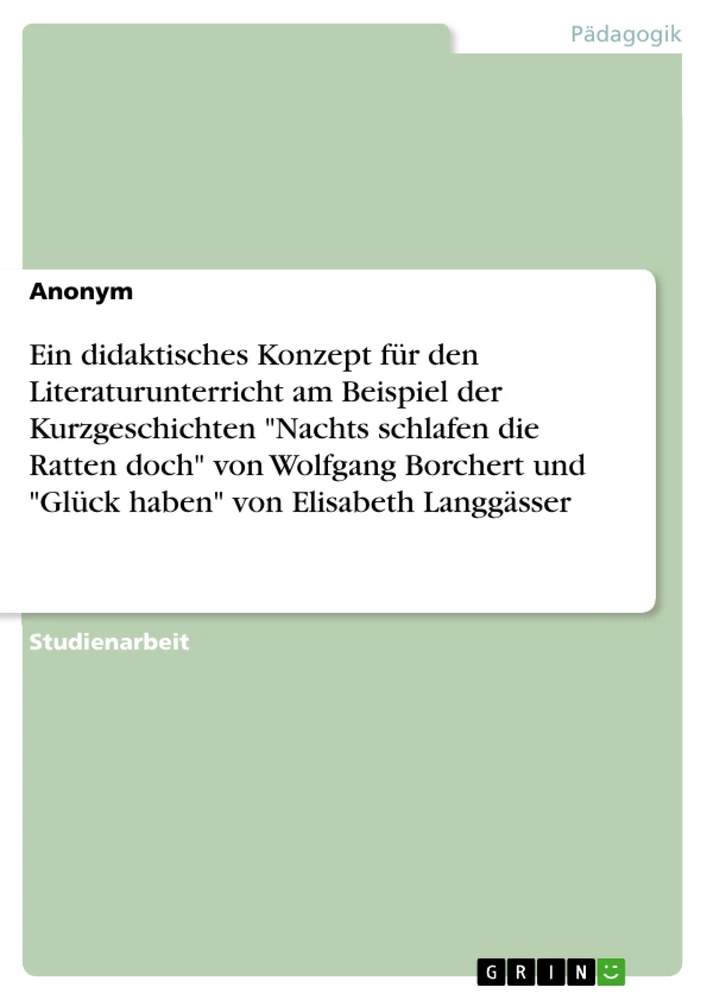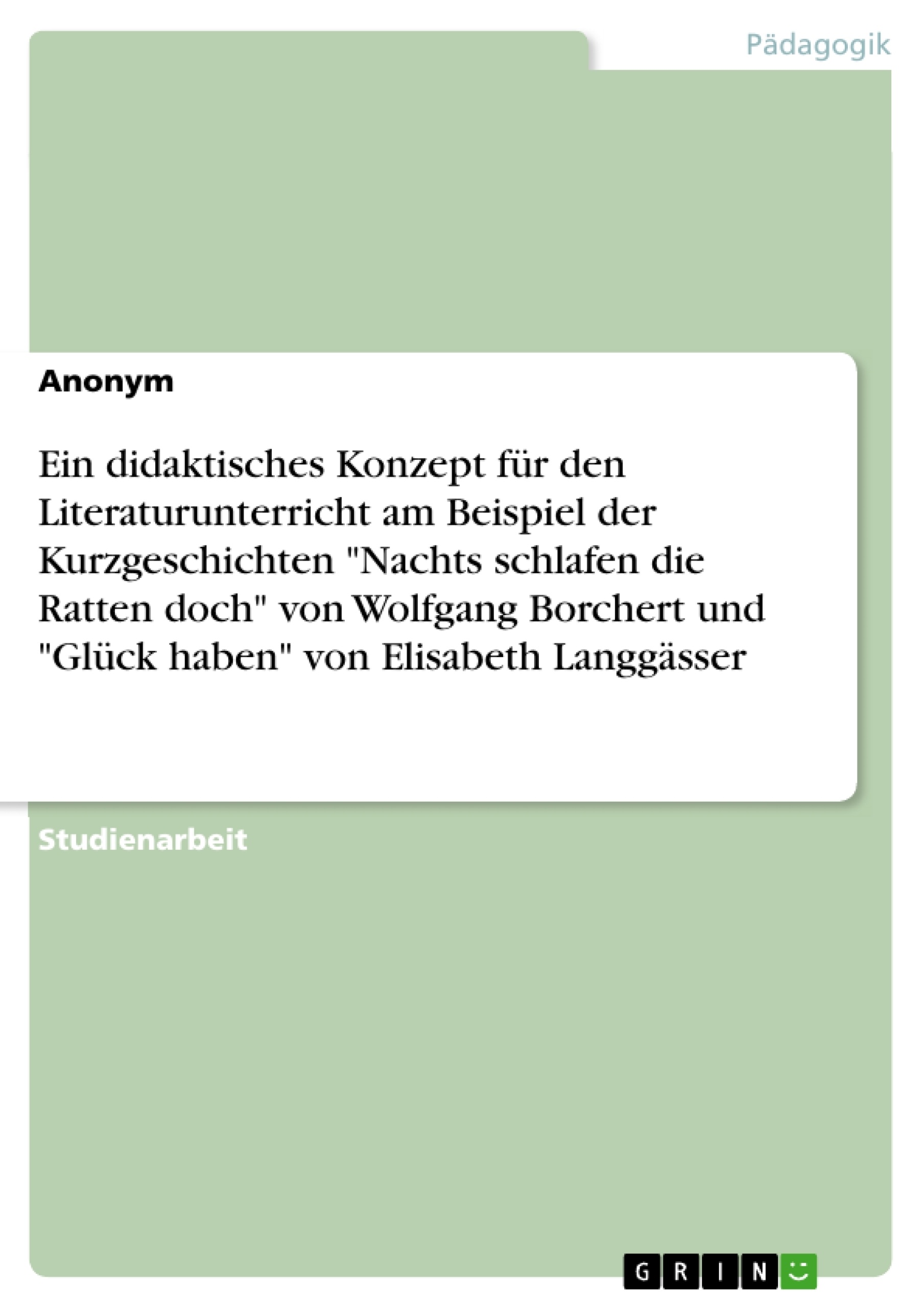Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Kurzgeschichten "Nachts schlafen die Ratten doch" von Wolfgang Borchert (1947) und "Glück haben" von Elisabeth Langgässer (1946). Aus den Kurzgeschichten soll ein didaktisches Konzept für den Literaturunterricht entstehen.
Dazu werden sie zunächst fachwissenschaftlich und im Anschluss fachdidaktisch untersucht. Im Laufe der fachwissenschaftlichen Betrachtung, soll auf Grundlage von Sekundärliteratur zu den Werken eine Interpretation vollzogen werden. Die dabei leitenden Aspekte bilden der Entstehungshintergrund, die sprachliche Gestaltung, der Aufbau sowie die Wirkung der Kurzgeschichten. Wesentliche Aufgabe dieses Teils ist es, dass die Werke inhaltlich und interpretatorisch verständlich werden. Auf dieser Basis wird eine folgende fachdidaktische Untersuchung der Kurzgeschichten möglich.
Hierbei soll zunächst die Auswahl der vorliegenden Exemplare erläutert werden, sodass ihre didaktische Eignung erkennbar wird. Auf Grundlage dessen, kann dann eine Jahrgangsstufe ausgewählt werden, die sich für ein didaktisches Vorhaben anbietet. Bei dieser Auswahl sowie der weiteren Ausarbeitung des didaktischen Konzepts, in dem eine exemplarische Unterrichtsreihe und eine Einzelstunde zum Thema dargestellt werden, wird entlang des Kernlehrplans von Nordrhein-Westfalen gearbeitet und methodische Entscheidungen mithilfe von didaktischer Fachliteratur begründet.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Fachwissenschaftlicher Teil
- 2.1 Interpretation der Kurzgeschichte Nachts schlafen die Ratten doch
- 2.2 Interpretation der Kurzgeschichte Glück haben
- 3 Fachdidaktischer Teil
- 3.1 Die Auswahl der Kurzgeschichten und ihre didaktische Eignung
- 3.2 Das didaktische Konzept
- 3.2.1 Exemplarische Unterrichtsreihe: Kurzgeschichten der Nachkriegszeit
- 3.2.1 Exemplarische Einzelstunde: Einstieg in die Thematik
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit entwickelt ein didaktisches Konzept für den Literaturunterricht anhand der Kurzgeschichten „Nachts schlafen die Ratten doch“ von Wolfgang Borchert und „Glück haben“ von Elisabeth Langgässer. Ziel ist die fachwissenschaftliche und fachdidaktische Untersuchung der Texte, um deren didaktische Eignung für den Unterricht zu belegen und eine exemplarische Unterrichtsreihe samt Einzelstunde zu konzipieren.
- Interpretation der Kurzgeschichten im Kontext der Nachkriegszeit
- Analyse der sprachlichen Gestaltung und des Erzählens
- Didaktische Eignung der Texte für den Literaturunterricht
- Entwicklung einer exemplarischen Unterrichtsreihe
- Konzeption einer Einzelstunde zum Einstieg in die Thematik
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Zielsetzung der Arbeit: die Entwicklung eines didaktischen Konzepts für den Literaturunterricht basierend auf den Kurzgeschichten „Nachts schlafen die Ratten doch“ und „Glück haben“. Es wird der methodische Aufbau der Arbeit skizziert, der sowohl eine fachwissenschaftliche als auch eine fachdidaktische Auseinandersetzung mit den Texten umfasst. Die Einleitung dient als Überblick und stellt die Relevanz der gewählten Texte im Kontext des Literaturunterrichts heraus.
2 Fachwissenschaftlicher Teil: Dieser Teil präsentiert Interpretationen der beiden Kurzgeschichten. Der Fokus liegt auf der Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden der Texte, die im Hinblick auf ihre literarischen Merkmale und ihren inhaltlichen Gehalt betrachtet werden. Diese Analyse bildet die Grundlage für den anschließenden fachdidaktischen Teil der Arbeit.
2.1 Interpretation der Kurzgeschichte Nachts schlafen die Ratten doch: Die Interpretation von Borcherts „Nachts schlafen die Ratten doch“ analysiert die Darstellung der Zerstörung des Individuums durch die Folgen des Krieges, fokussiert auf das Opfer eines neunjährigen Jungen. Die Analyse untersucht die sprachliche Gestaltung, den Aufbau und die Wirkung der Geschichte. Besondere Aufmerksamkeit wird der Entwicklung der Stimmung und der symbolischen Bedeutung der beschriebenen Bilder gewidmet. Die Parallelen zwischen der Kurzgeschichte und der Biografie Borcherts werden ebenfalls beleuchtet.
2.2 Interpretation der Kurzgeschichte Glück haben: Die Interpretation von Langgässers „Glück haben“ untersucht die Thematik der nervlichen und geistigen Verwirrung als Folge des Krieges und des NS-Regimes. Die Analyse konzentriert sich auf den Aufbau der Geschichte als Rahmenerzählung mit Binnenerzählung und die unterschiedliche Gestaltung der Erzählzeit. Die Wirkung der sprachlichen Mittel und die Darstellung der psychischen Zustände der Figuren werden ausführlich betrachtet.
3 Fachdidaktischer Teil: In diesem Teil wird die didaktische Eignung der ausgewählten Kurzgeschichten begründet und ein didaktisches Konzept für den Unterricht entwickelt. Es wird erläutert, warum diese Texte sich für den Unterricht eignen und welche Jahrgangsstufe sich hierfür anbietet. Das Konzept umfasst eine exemplarische Unterrichtsreihe und eine Einzelstunde.
Schlüsselwörter
Nachkriegsliteratur, Didaktik, Literaturunterricht, Wolfgang Borchert, Elisabeth Langgässer, Kurzgeschichte, Kriegsfolgen, Trauma, sprachliche Gestaltung, Erzählperspektive, didaktisches Konzept, Unterrichtsreihe, Einzelstunde.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Didaktisches Konzept zum Literaturunterricht anhand der Kurzgeschichten „Nachts schlafen die Ratten doch“ und „Glück haben“
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit entwickelt ein didaktisches Konzept für den Literaturunterricht, basierend auf den Kurzgeschichten „Nachts schlafen die Ratten doch“ von Wolfgang Borchert und „Glück haben“ von Elisabeth Langgässer. Sie umfasst eine fachwissenschaftliche Interpretation beider Texte und die Entwicklung einer exemplarischen Unterrichtsreihe inklusive einer Einzelstunde.
Welche Themen werden in den Kurzgeschichten behandelt und wie werden sie interpretiert?
„Nachts schlafen die Ratten doch“ behandelt die Zerstörung des Individuums durch die Folgen des Krieges, fokussiert auf das Opfer eines neunjährigen Jungen. „Glück haben“ thematisiert die nervliche und geistige Verwirrung als Folge des Krieges und des NS-Regimes. Die Interpretationen analysieren sprachliche Gestaltung, Erzählstrukturen und die Wirkung der Geschichten.
Welche Aspekte der didaktischen Eignung werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht die didaktische Eignung der Texte für den Literaturunterricht, begründet die Auswahl und schlägt eine geeignete Jahrgangsstufe vor. Es werden die literarischen Merkmale und der inhaltliche Gehalt der Geschichten im Hinblick auf ihre Unterrichtsrelevanz analysiert.
Wie ist das didaktische Konzept aufgebaut?
Das didaktische Konzept beinhaltet eine exemplarische Unterrichtsreihe zum Thema Kurzgeschichten der Nachkriegszeit und eine Einzelstunde als Einstieg in die Thematik. Es beschreibt den methodischen Ablauf und die didaktischen Ziele.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Nachkriegsliteratur, Didaktik, Literaturunterricht, Wolfgang Borchert, Elisabeth Langgässer, Kurzgeschichte, Kriegsfolgen, Trauma, sprachliche Gestaltung, Erzählperspektive, didaktisches Konzept, Unterrichtsreihe, Einzelstunde.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen fachwissenschaftlichen Teil (Interpretationen der Kurzgeschichten), einen fachdidaktischen Teil (didaktisches Konzept und Unterrichtsplanung) und ein Fazit.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel ist die fachwissenschaftliche und fachdidaktische Untersuchung der ausgewählten Kurzgeschichten, um deren didaktische Eignung zu belegen und ein praxisorientiertes Unterrichtskonzept zu entwickeln.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Ein didaktisches Konzept für den Literaturunterricht am Beispiel der Kurzgeschichten "Nachts schlafen die Ratten doch" von Wolfgang Borchert und "Glück haben" von Elisabeth Langgässer, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/541395