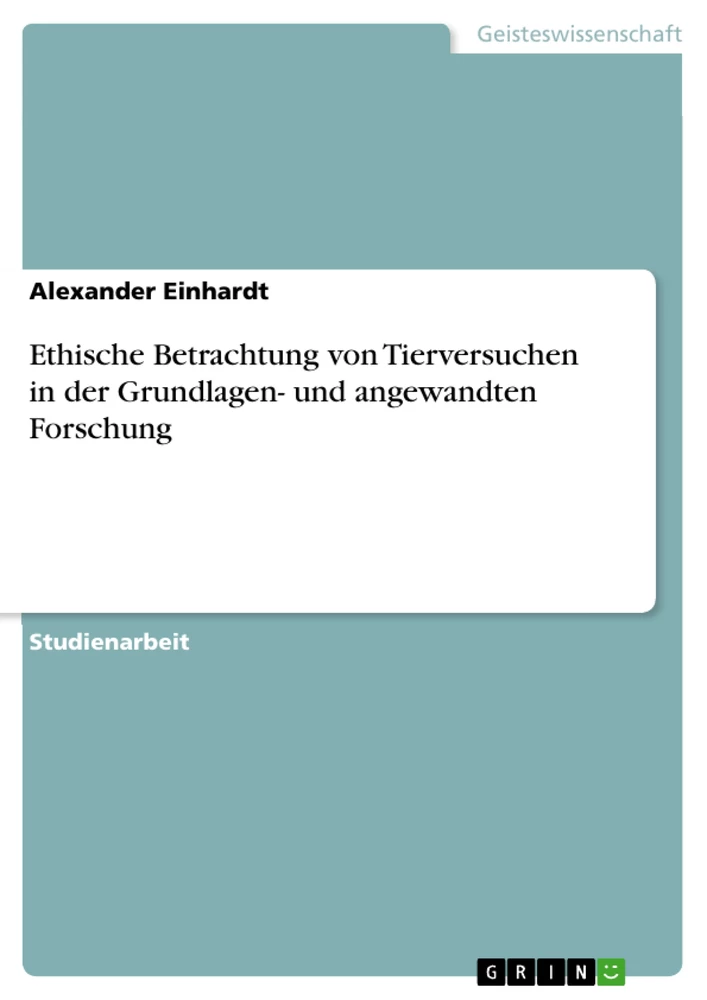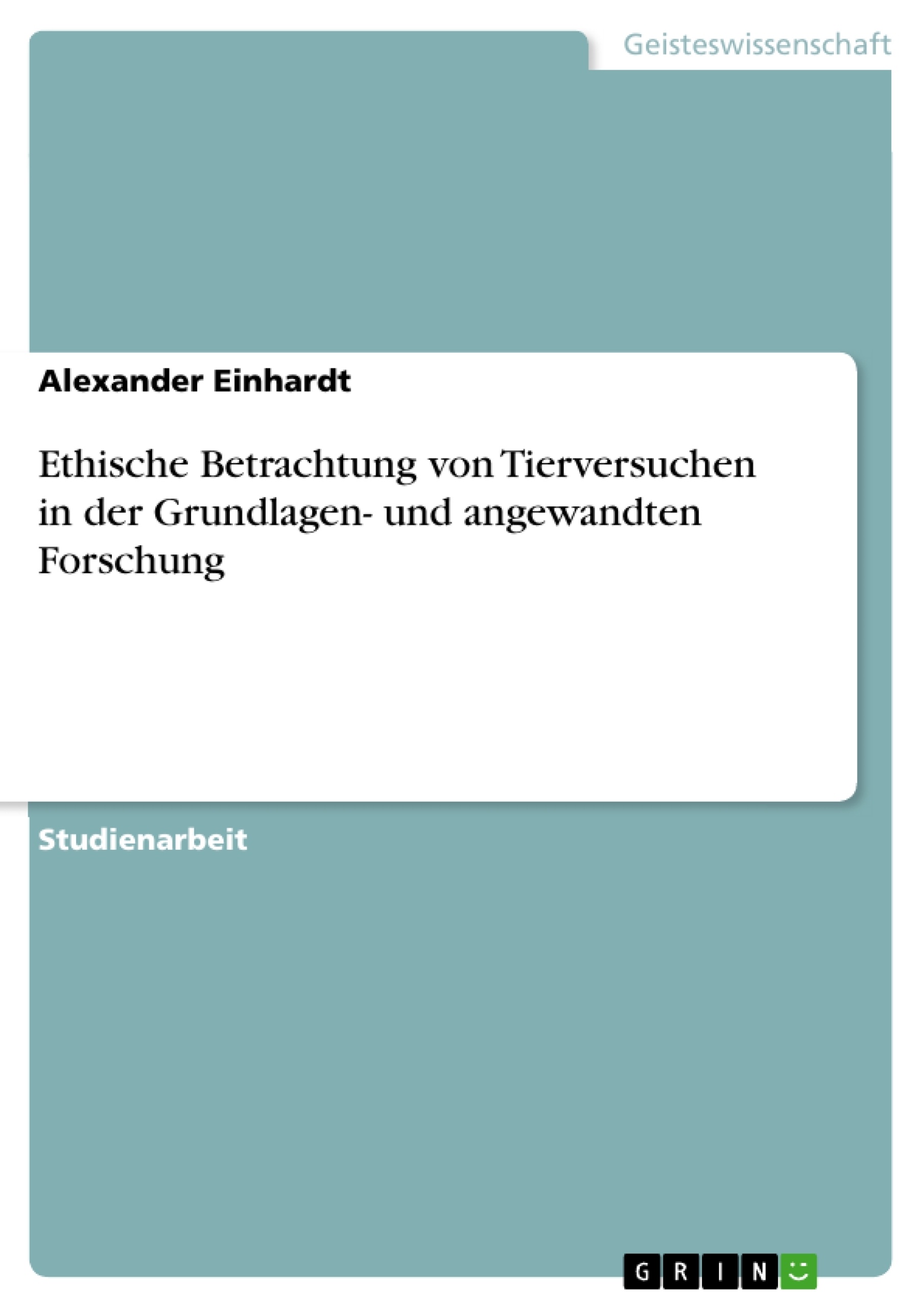Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit folgender Frage: "Kann auf Tierversuche in der Grundlagenforschung und in der angewandten Forschung aus ethischer Sicht verzichtet werden?". Im Theoretischen Teil wurde hierfür der aktuelle Wissensstand definiert. Um in der Analysephase zu neuen Erkenntnissen zu kommen, wurde induktiv und qualitativ geforscht. Genauer gesagt wurden mithilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse sekundäre Daten ausgewertet. Die ausgewerteten Daten waren vier Interviews von 2017 und 2018 und beschäftigen sich allesamt mir der ethischen Betrachtung von Tierversuchen. Die Qualitative Inhaltsanalyse besteht aus vier Kriterien (Anwendung alternativer Verfahren und Methoden, Erfolge durch Tierversuche, Ethische Vertretbarkeit und Welt ohne Tierversuche) die miteinander verglichen wurden. Nach dem Vergleich dieser Daten wurden entsprechende Schlüsse gezogen und die Forschungsfrage entsprechend beantwortet.
Die Historische Entwicklung des Tierschutzgedankens und der damit verbundenen ethischen Abwägung von Tierversuchen begann im 17. Jahrhundert. Zu diesem Zeitpunkt lebten die Menschen aber noch nach dem anthropozentrischen Stil, der Tierschutz als nützlich für den Menschen darstellen lässt. Im 18. Und 19. Jahrhundert entstand aus der Angst vor der immer rücksichtsloser werdenden Gesellschaft eine Tierschutzbewegung. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es keine rechtlichen Einschränkungen, die Tierversuche zu Forschungszwecken eingrenzten oder gar vermieden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Tierversuche in Grundalgen und angewandter Forschung
- Definition Tierversuche
- Tierversuche in der Grundlagenforschung
- Tierversuche in der angewandten Forschung
- Historische Entwicklung
- Der Versuchsantrag
- Das 3R-Prinzip
- Alternative Verfahren und Methoden
- Ethische Sicht auf Tierversuche
- Forschungsfrage
- Tierversuche in Grundalgen und angewandter Forschung
- Methodik
- Deduktion und Induktion
- Qualitativ und Quantitativ
- Primär und sekundär
- Qualitative Inhaltsanalyse
- Analyse
- Anwendung alternativer Verfahren und Methoden
- Erfolge durch Tierversuche
- Ethische Vertretbarkeit
- Welt ohne Tierversuche
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit beschäftigt sich mit der ethischen Betrachtung von Tierversuchen in der Grundlagen- und angewandten Forschung. Das Hauptziel der Arbeit ist es, die ethische Vertretbarkeit von Tierversuchen zu analysieren und die Frage zu beantworten, ob auf Tierversuche in beiden Forschungsbereichen aus ethischer Sicht verzichtet werden kann.
- Definition und historische Entwicklung von Tierversuchen
- Die ethische Debatte um Tierversuche
- Das 3R-Prinzip und alternative Methoden
- Erfolge und Risiken von Tierversuchen
- Die zukünftige Rolle von Tierversuchen in der Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Tierversuche und deren ethische Betrachtung ein. Sie beleuchtet die Kontroverse um Tierversuche und die Notwendigkeit, die Spannungsfelder zwischen Wissenschaftsfreiheit und Tierschutz zu analysieren. Der theoretische Teil der Arbeit definiert den aktuellen Wissenstand zu Tierversuchen in der Grundlagen- und angewandten Forschung. Er beleuchtet die Definition von Tierversuchen, ihre historische Entwicklung und wichtige Prinzipien wie das 3R-Prinzip. Die Methodik beschreibt die verwendeten Forschungsmethoden, darunter die qualitative Inhaltsanalyse.
Die Analyse untersucht die Anwendung alternativer Verfahren und Methoden, die Erfolge durch Tierversuche, die ethische Vertretbarkeit von Tierversuchen und die Frage, ob eine Welt ohne Tierversuche denkbar ist. Das Fazit fasst die wichtigsten Ergebnisse der Analyse zusammen und beantwortet die Forschungsfrage.
Schlüsselwörter
Tierversuche, Ethik, Grundlagenforschung, angewandte Forschung, Tierschutz, 3R-Prinzip, alternative Methoden, qualitative Inhaltsanalyse, Wissenschaftsfreiheit.
- Arbeit zitieren
- Alexander Einhardt (Autor:in), 2018, Ethische Betrachtung von Tierversuchen in der Grundlagen- und angewandten Forschung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/540308