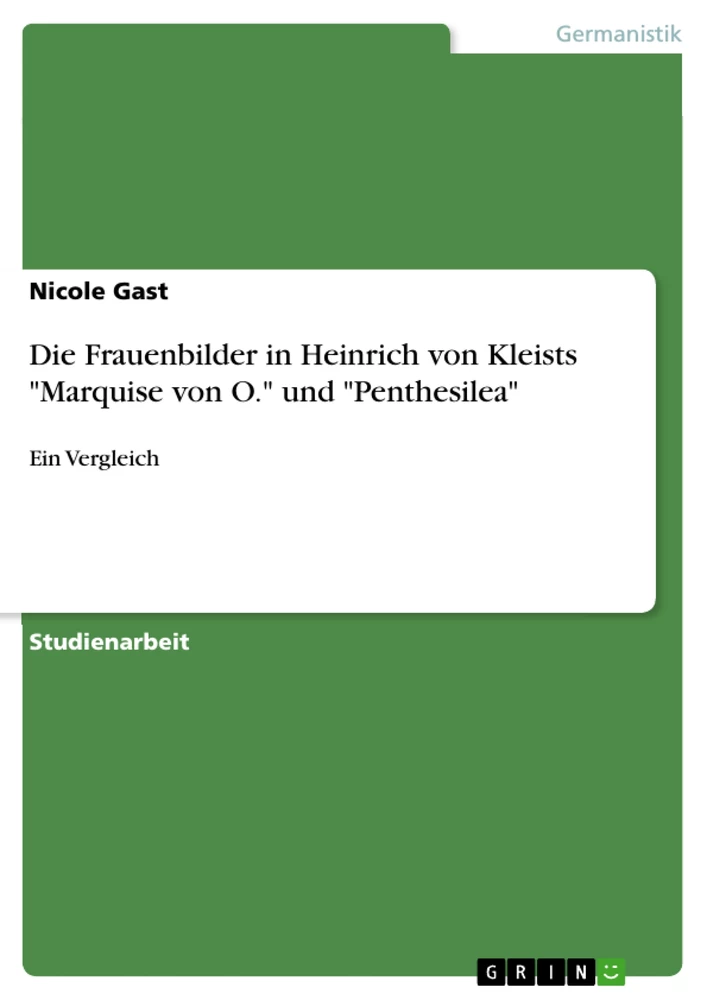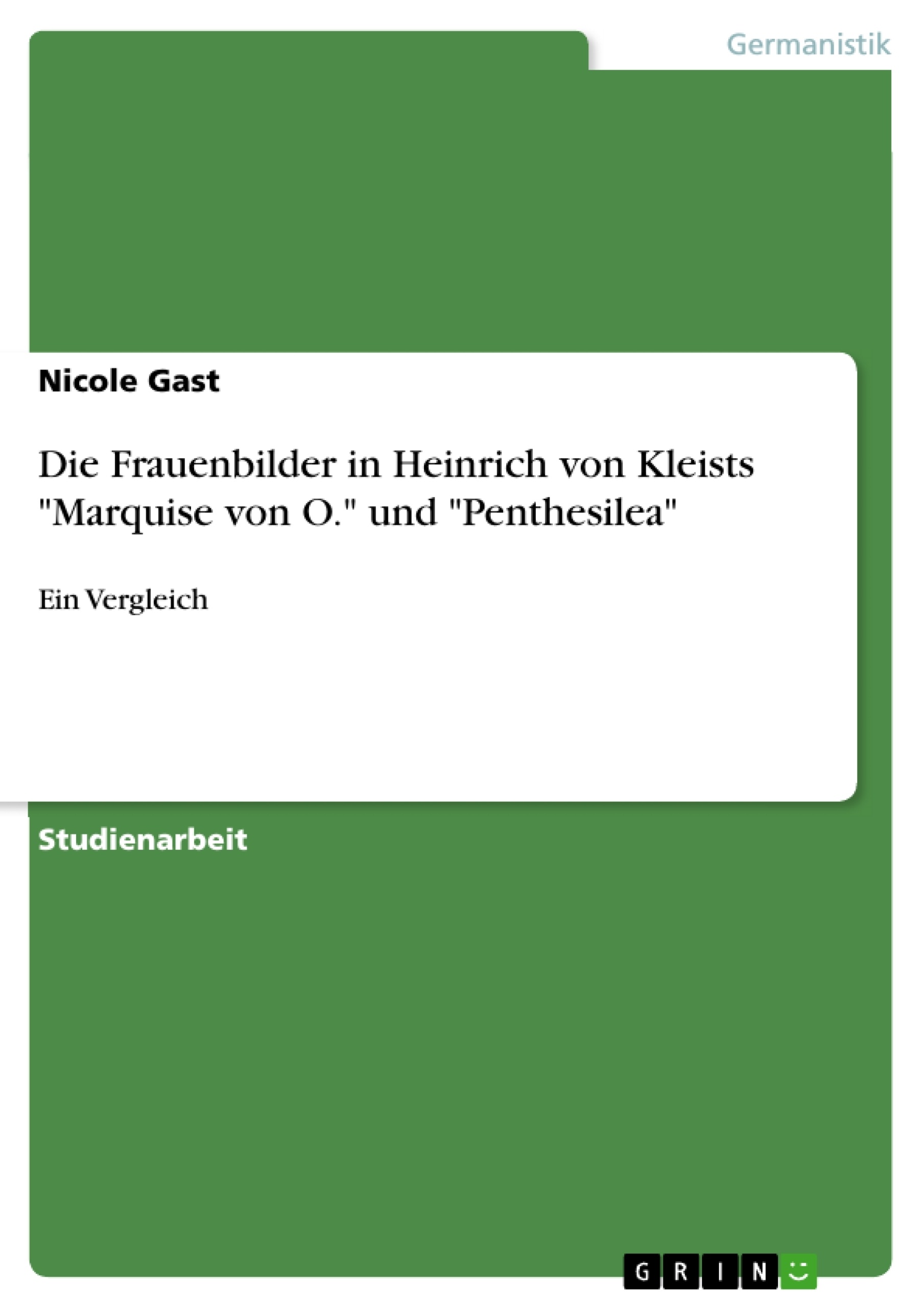Die Arbeit gibt Aufschluss über das gesellschaftliche Frauenideal um 1800 und erläutert den Einfluss von Jean Jaques Rousseau und Johann Gottlieb Fichte auf das (zwiespältige) Frauenbild Heinrich von Kleists, das in der Novelle „Die Marquise von O.“ und dem Trauerspiel „Penthesilea“ besonders deutlich zum Vorschein kommt. Im Fokus der Untersuchung steht ein Vergleich der beiden Frauenbilder, der, mit Hilfe verschiedener Textbeispiele, Aufschluss über die Unterschiede, Gemeinsamkeiten und Wandlungen der Protagonistinnen gibt:
Mit ihrer brav-naiven Besonnenheit und femininen Schüchternheit entspricht die Marquise von O. zu Beginn perfekt den gesellschaftlichen Rollenerwartungen. Ihr Gegenpol ist Penthesilea: Kämpferisch, aktiv und durch ihre mentale und physische Stärke als Führungsperson innerhalb ihrer Gesellschaft anerkannt. Kurz: Die Verkörperung des Unweiblichen. Die Wandlung der beiden Frauen im Verlauf der Novelle bzw. des Trauerspiels ist ebenfalls gegensätzlich: Während die Marquise sich zu einer selbstsicheren, rational denkenden und starken Frau entwickelt, entdeckt Penthesilea die Liebe, die sie emotional und passiv werden lässt. Gegen Ende wird der Kontrast der beiden Frauenbilder erneut besonders deutlich, wenn sich die Marquise zu Gunsten ihrer Familie zurück in eine freiwillig passive Abhängigkeitssituation begibt während Penthesilea sich durch den Mord an Achill nicht nur unweiblich, sondern sogar unmenschlich verhält. Beide Charaktere durchlaufen somit eine Wandlung, um am Ende mit neuem Ich in ihr altes Rollenverhalten zurückzukehren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Frauenbild um 1800
- 2.1 Rousseau über die Regeln der Geschlechterbeziehung
- 2.2 Die Stellung der Frau innerhalb der Ehe
- 2.3 (Schein-)Emanzipationsbestrebungen
- 2.4 Das Frauenbild Kleists
- 2.4.1 Briefe an Ulrike und Wilhelmine
- 3. Die Marquise von O.
- 3.1 Witwe durch Tragik, Tochter aus Zufall, Ehefrau aus Kalkül?
- 3.2 Charakteristische Figurenmerkmale
- 3.2.1 Körpersprache und Wortwahl
- 4. Penthesilea - Wunschbild, Schreckbild, Selbstbild?
- 4.1 Das Amazonentum in ,,Penthesilea"
- 4.2 Penthesilea – Frau, Mann oder beides?
- 4.2.1 Körpersprache und Wortwahl
- 5. Die Frauengestalten Marquise von O. und Penthesilea im Vergleich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frauenbilder in Heinrich von Kleists „Marquise von O.“ und „Penthesilea“ im Kontext des vorherrschenden Frauenbildes um 1800. Ziel ist es, die Darstellung der weiblichen Protagonistinnen mit den gesellschaftlichen Erwartungen und Rollenzuweisungen der damaligen Zeit zu vergleichen und Kleists Auseinandersetzung mit dem traditionellen Rollenverständnis zu analysieren.
- Das Frauenbild um 1800 und dessen Einfluss auf Kleists Werke
- Vergleich der Frauenfiguren Marquise von O. und Penthesilea
- Analyse der charakteristischen Figurenmerkmale beider Protagonistinnen
- Kleists Infragestellung des traditionellen Rollenverständnisses
- Die Rolle der Körpersprache und Wortwahl in der Figurenzeichnung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der Frauenbilder bei Heinrich von Kleist ein und benennt die zentralen Fragestellungen der Arbeit. Sie hebt Kleists kritische Auseinandersetzung mit dem traditionellen Rollenverständnis hervor und kündigt den Vergleich der Frauenfiguren in „Die Marquise von O.“ und „Penthesilea“ an. Die Einleitung skizziert die Methodik der Arbeit und thematisiert die Herausforderungen eines Vergleichs aufgrund der unterschiedlichen Textgattungen und historischen Kontexte.
2. Das Frauenbild um 1800: Dieses Kapitel beschreibt das gängige Frauenbild um 1800, beeinflusst von Philosophen wie Rousseau und Fichte. Es beleuchtet Rousseaus Vorstellung von der Frau als dem leidenden und erduldendem Prinzip der Natur, die dem Mann zu gefallen geschaffen sei. Weiterhin wird die Stellung der Frau innerhalb der Ehe im Kontext der damaligen gesellschaftlichen Normen und Gesetze erläutert, die die Frau weitgehend dem Willen des Mannes unterwarfen. Das Kapitel legt somit die Grundlage für die spätere Einordnung und Interpretation der Frauenfiguren in Kleists Werken.
3. Die Marquise von O.: Dieses Kapitel analysiert die Figur der Marquise von O. Es untersucht ihre ungewöhnliche Situation als ungewollt schwangere Witwe und die gesellschaftlichen Reaktionen auf ihren Zustand. Die Analyse konzentriert sich auf die charakteristischen Figurenmerkmale der Marquise, darunter ihre Körpersprache und Wortwahl, um ihr Handeln und ihre Persönlichkeit zu verstehen. Es wird untersucht, inwieweit die Marquise den Erwartungen des damaligen Frauenbildes entspricht oder diese bewusst unterläuft.
4. Penthesilea - Wunschbild, Schreckbild, Selbstbild?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Figur der Penthesilea. Es untersucht den Kontext des Amazonentums und analysiert Penthesileas widersprüchliche Natur als Kriegerin und Liebende. Die Analyse konzentriert sich auf ihre charakteristischen Figurenmerkmale, einschließlich Körpersprache und Wortwahl, um die Ambivalenz ihrer Persönlichkeit zu beleuchten. Es wird diskutiert, wie Penthesilea das Frauenbild ihrer Zeit in Frage stellt und welche Bedeutung ihre Geschichte im Kontext der damaligen gesellschaftlichen Normen besitzt.
Schlüsselwörter
Heinrich von Kleist, Frauenbild, Marquise von O., Penthesilea, Rollenverständnis, Geschlechterbeziehung, Emanzipation, Körpersprache, Wortwahl, Novelle, Trauerspiel, 18. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen zu: Frauenbilder bei Heinrich von Kleist
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Frauenbilder in Heinrich von Kleists Werken „Die Marquise von O.“ und „Penthesilea“ im Kontext des Frauenbildes um 1800. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der weiblichen Protagonistinnen mit den gesellschaftlichen Erwartungen und Rollenzuweisungen der damaligen Zeit und der Analyse von Kleists Auseinandersetzung mit dem traditionellen Rollenverständnis.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das Frauenbild um 1800, den Vergleich der Frauenfiguren Marquise von O. und Penthesilea, die Analyse ihrer charakteristischen Figurenmerkmale (inkl. Körpersprache und Wortwahl), Kleists Infragestellung des traditionellen Rollenverständnisses und den Einfluss des gesellschaftlichen Kontextes auf die Figuren.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zum Frauenbild um 1800, je ein Kapitel zur Analyse der Marquise von O. und Penthesilea und ein abschließendes Kapitel, welches beide Frauenfiguren vergleicht. Zusätzlich beinhaltet sie ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Welches Frauenbild wird im Kapitel 2 beschrieben?
Kapitel 2 beschreibt das vorherrschende Frauenbild um 1800, beeinflusst von Denkern wie Rousseau und Fichte. Es zeigt die Frau als dem Mann untergeordnete, leidende und erduldende Figur, deren Rolle primär darin bestand, dem Mann zu gefallen. Die gesellschaftlichen Normen und Gesetze, die die Frau dem Willen des Mannes unterwarfen, werden ebenfalls beleuchtet.
Wie wird die Marquise von O. in Kapitel 3 analysiert?
Kapitel 3 analysiert die Marquise von O. als ungewollt schwangere Witwe und die gesellschaftlichen Reaktionen auf ihre Situation. Die Analyse konzentriert sich auf ihre Körpersprache, Wortwahl und ihr Handeln, um ihre Persönlichkeit und ihr Verhältnis zum traditionellen Frauenbild zu verstehen. Es wird untersucht, ob sie den Erwartungen entspricht oder diese unterläuft.
Wie wird Penthesilea in Kapitel 4 dargestellt?
Kapitel 4 behandelt Penthesilea im Kontext des Amazonentums. Es analysiert ihre widersprüchliche Natur als Kriegerin und Liebende und beleuchtet die Ambivalenz ihrer Persönlichkeit durch die Analyse ihrer Körpersprache und Wortwahl. Es wird diskutiert, inwieweit Penthesilea das Frauenbild ihrer Zeit in Frage stellt.
Was ist das Ziel des Vergleichs in Kapitel 5?
Kapitel 5 vergleicht die Frauenfiguren Marquise von O. und Penthesilea, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Charakteren und ihrem Umgang mit den gesellschaftlichen Erwartungen herauszuarbeiten und Kleists kritische Auseinandersetzung mit dem traditionellen Rollenverständnis zu beleuchten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Heinrich von Kleist, Frauenbild, Marquise von O., Penthesilea, Rollenverständnis, Geschlechterbeziehung, Emanzipation, Körpersprache, Wortwahl, Novelle, Trauerspiel, 18. Jahrhundert.
- Quote paper
- M.A. Nicole Gast (Author), 2006, Die Frauenbilder in Heinrich von Kleists "Marquise von O." und "Penthesilea", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/53977