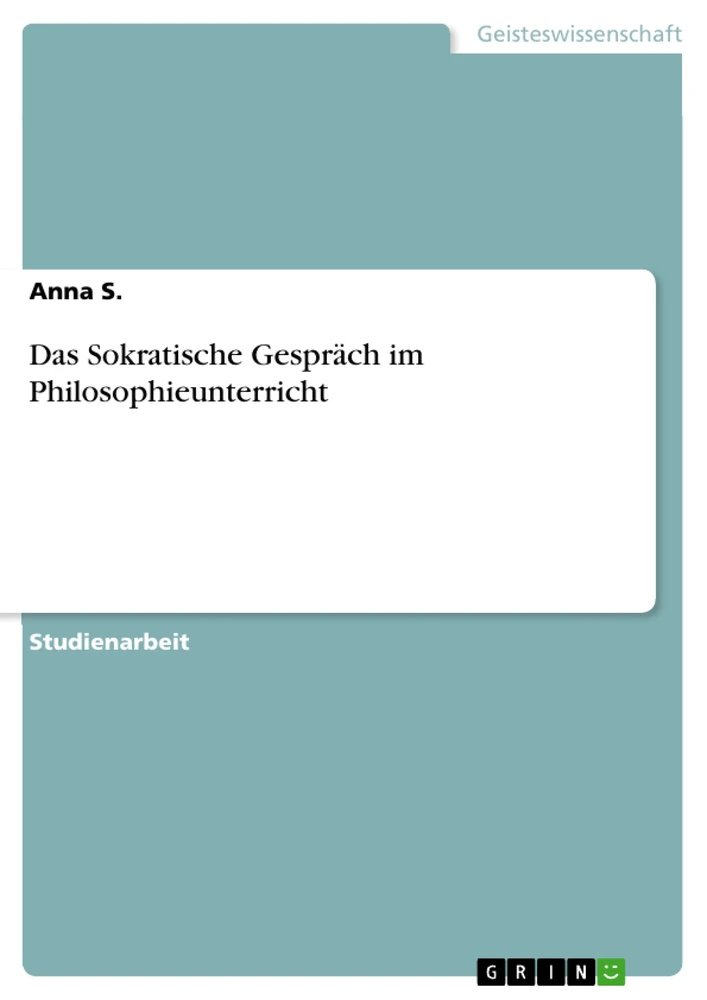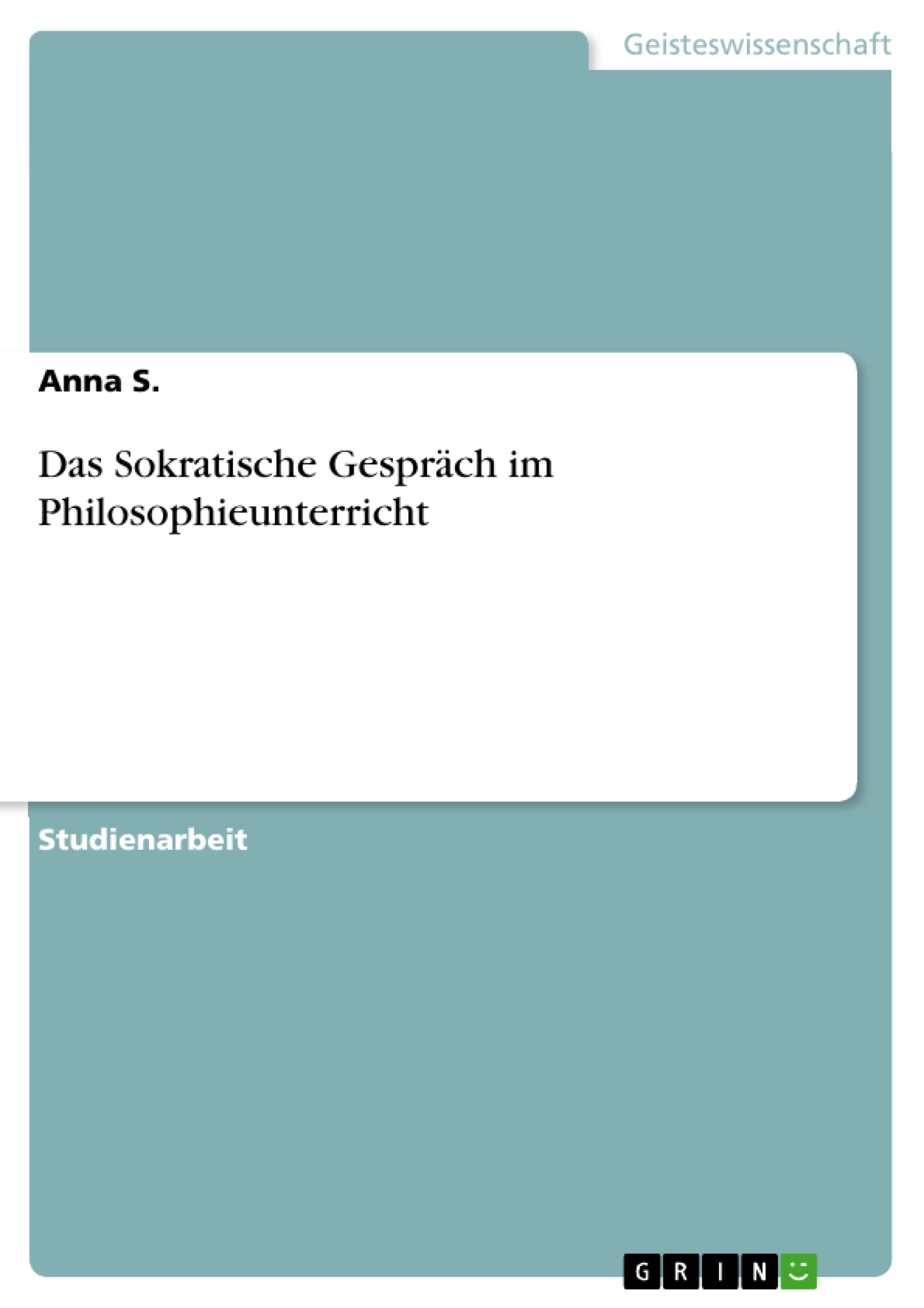Ich werde aufzeigen, dass die richtige Umsetzung des sokratischen Gesprächs eine erfolgsversprechende Methode für den Unterricht darstellt. Das Sokratische Gespräch hat das Potenzial den Philosophieunterricht wieder lebensnaher zu gestalten und die Distanz zwischen Theorie und Praxis aufzulösen. Die SuS lernen mithilfe des Sokratischen Gesprächs philosophieren und nicht bloßes Fachwissen.
Zunächst werde ich die Methode des historischen Sokrates aufzeigen, vor allem was es mit dem Begriff der Maieutik auf sich hat. Daraufhin folgt die modifizierte neo-sokratische Methode von Nelson/Heckmann. Diese haben Sokrates Methode nicht nur aufgegriffen, sondern weiterentwickelt und in Schulen und Universitäten getragen. Anschließend werde ich auf Gisela Raupach-Streys eingehen, welche die Tradition von Nelson/Heckmann fortführt. Diese hat sieben konstitutive Elemente des sokratischen Gesprächs für den Philosophieunterricht eingeführt.
Zum Abschluss werde ich mich auf die Anforderungen des Schulministeriums für die Sekundarstufe II Gymnasium / Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen für das Fach Philosophie beziehen und verdeutlichen, warum das sokratische Gespräch eben die dort genannten Anforderungen erfüllt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Über Sokrates
- 2.1 Die Maieutik
- 3. Die Sokratische Methode in der Tradition von Leonard Nelson und Gustav Heckmann
- 3.1 Nelsons Kritik an der traditionellen Sokratischen Methode
- 3.2 Sokratisches Philosophieren im Unterricht
- 3.3 Konstitutive Elemente der Sokratischen Methode in der Relevanz für den Philosophieunterricht
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Anwendbarkeit der Sokratischen Methode im Philosophieunterricht. Ziel ist es aufzuzeigen, dass eine richtige Umsetzung des sokratischen Gesprächs eine erfolgreiche Unterrichtsmethode darstellt, die den Unterricht lebensnäher gestaltet und die Distanz zwischen Theorie und Praxis verringert. Die Arbeit beleuchtet die Methode des historischen Sokrates, insbesondere die Maieutik, und deren Weiterentwicklung durch Nelson/Heckmann. Schließlich wird die Relevanz der Methode für den heutigen Philosophieunterricht anhand der Anforderungen des Schulministeriums Nordrhein-Westfalen diskutiert.
- Die Sokratische Methode und ihre historische Entwicklung
- Die Maieutik als zentrale Technik des Sokratischen Gesprächs
- Die Adaption der Sokratischen Methode für den Schulunterricht
- Die Relevanz der Sokratischen Methode für die Förderung des selbstständigen Denkens
- Der Vergleich der Sokratischen Methode mit anderen Lehrmethoden
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des Sokratischen Gesprächs im Philosophieunterricht ein und begründet die Relevanz der Methode. Sie stellt die These auf, dass das Sokratische Gespräch das Potential hat, den Philosophieunterricht lebensnäher zu gestalten und die Distanz zwischen Theorie und Praxis zu verringern. Die Autorin kündigt ihren methodischen Ansatz an: Zunächst wird die Methode des historischen Sokrates, einschließlich der Maieutik, beleuchtet. Anschließend folgt die Darstellung der modifizierten neo-sokratischen Methode von Nelson/Heckmann und deren Weiterführung durch Gisela Raupach-Streys. Schließlich wird der Bezug zu den Anforderungen des Schulministeriums Nordrhein-Westfalen hergestellt.
2. Über Sokrates: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Denken und der Pädagogik Sokrates', basierend vor allem auf Platons Apologie. Es werden die zentralen Fragen des sokratischen Philosophierens nach Wissen und Weisheit erörtert, sowie das Ziel der Begriffsklärung und die Bildung einer moralischen Haltung. Im Gegensatz zu den Sophisten betont der Text Sokrates' Fokus auf die Mündigkeit der Menschen und die Verbesserung der Kommunikationskultur durch Dialog. Die berühmte Hebammenkunst (Maieutik) wird als Methode der selbstständigen philosophischen Wissensbildung beschrieben, die durch geschicktes Fragen und Antworten zum Ziel führt. Das Kapitel unterstreicht, dass Sokrates' primäres Interesse nicht auf dem Aufbau theoretischer Lehrgebäude lag, sondern auf Selbstklärung und Selbstprüfung. Es wird darauf hingewiesen, dass sokratische Dialoge oft in einer Aporie enden, was den ethisch-therapeutischen Charakter der Philosophie unterstreicht. Der Dialog selbst wird als zentrales Instrument zur Erreichung von Wahrheit und Erkenntnis hervorgehoben.
3. Die Sokratische Methode in der Tradition von Leonard Nelson und Gustav Heckmann: Dieses Kapitel behandelt die Weiterentwicklung und Adaption der Sokratischen Methode durch Nelson und Heckmann für den schulischen Kontext. Es beinhaltet eine kritische Auseinandersetzung mit Nelsons Kritik an der traditionellen Sokratischen Methode und beschreibt die Umsetzung des Sokratischen Philosophierens im Unterricht. Im Fokus stehen die konstitutiven Elemente der Sokratischen Methode, die für den Philosophieunterricht relevant sind. Die Kapitel verbindet die theoretischen Grundlagen der sokratischen Methode mit ihrer praktischen Anwendung im Unterricht und untersucht deren Bedeutung für die Erreichung der Lernziele im Fach Philosophie.
Schlüsselwörter
Sokratisches Gespräch, Maieutik, Philosophieunterricht, Leonard Nelson, Gustav Heckmann, selbstständiges Denken, begriffliche Klärung, moralische Bildung, Kommunikation, Dialektik, Aporie, Selbstklärung, Nordrhein-Westfalen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Die Sokratische Methode im Philosophieunterricht"
Was ist das Hauptthema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Anwendbarkeit der Sokratischen Methode im Philosophieunterricht. Sie argumentiert, dass eine richtige Umsetzung des sokratischen Gesprächs eine erfolgreiche und lebensnahe Unterrichtsmethode darstellt, welche die Distanz zwischen Theorie und Praxis verringert.
Welche Aspekte der Sokratischen Methode werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Methode des historischen Sokrates, insbesondere die Maieutik (Hebammenkunst), und deren Weiterentwicklung durch Nelson und Heckmann. Es werden die zentralen Elemente des sokratischen Philosophierens, wie Begriffsklärung, moralische Bildung und die Förderung des selbstständigen Denkens, diskutiert. Ein Vergleich mit anderen Lehrmethoden wird angedeutet.
Wer sind die wichtigsten Bezugspersonen in der Arbeit?
Die Arbeit bezieht sich zentral auf Sokrates, Platon (als Quelle für Informationen über Sokrates), Leonard Nelson und Gustav Heckmann, die die Sokratische Methode für den Schulunterricht adaptiert haben. Die Anforderungen des Schulministeriums Nordrhein-Westfalen spielen ebenfalls eine Rolle.
Wie wird die Sokratische Methode im Kontext des Philosophieunterrichts dargestellt?
Die Arbeit zeigt die Relevanz der Sokratischen Methode für den heutigen Philosophieunterricht auf. Sie analysiert die konstitutiven Elemente der Methode und ihre praktische Anwendung im Unterricht, unter Berücksichtigung der Lernziele im Fach Philosophie. Es wird der Versuch unternommen, die theoretischen Grundlagen mit der Praxis zu verbinden.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über Sokrates und seine Maieutik, ein Kapitel zur Weiterentwicklung der Sokratischen Methode durch Nelson und Heckmann mit Fokus auf den Einsatz im Unterricht und ein Fazit. Die Einleitung begründet die Relevanz des Themas. Das Kapitel über Sokrates behandelt dessen Philosophie und Pädagogik. Das dritte Kapitel analysiert die Adaption und Anwendung der Methode im Unterricht. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Was ist die Maieutik und welche Rolle spielt sie in der Arbeit?
Die Maieutik, die „Hebammenkunst“, ist eine zentrale Technik des Sokratischen Gesprächs. Sie beschreibt eine Methode der selbstständigen philosophischen Wissensbildung durch geschicktes Fragen und Antworten. Die Arbeit betont ihre Bedeutung für die Förderung des selbstständigen Denkens und die Selbstklärung.
Welche Kritikpunkte an der traditionellen Sokratischen Methode werden angesprochen?
Die Arbeit geht auf Nelsons Kritik an der traditionellen Sokratischen Methode ein, ohne den genauen Inhalt dieser Kritik im Detail zu spezifizieren. Die Weiterentwicklung der Methode durch Nelson und Heckmann wird als Antwort auf diese Kritik dargestellt.
Welche Rolle spielt das Schulministerium Nordrhein-Westfalen?
Die Arbeit bezieht die Anforderungen des Schulministeriums Nordrhein-Westfalen mit ein, um die Relevanz der Sokratischen Methode im Kontext des offiziellen Lehrplans zu belegen und zu diskutieren.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die Sokratische Methode, richtig umgesetzt, eine erfolgreiche Unterrichtsmethode im Philosophieunterricht ist. Sie fördert das selbstständige Denken und verringert die Distanz zwischen Theorie und Praxis.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Sokratisches Gespräch, Maieutik, Philosophieunterricht, Leonard Nelson, Gustav Heckmann, selbstständiges Denken, begriffliche Klärung, moralische Bildung, Kommunikation, Dialektik, Aporie, Selbstklärung, Nordrhein-Westfalen.
- Quote paper
- Anna S. (Author), 2019, Das Sokratische Gespräch im Philosophieunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/538699