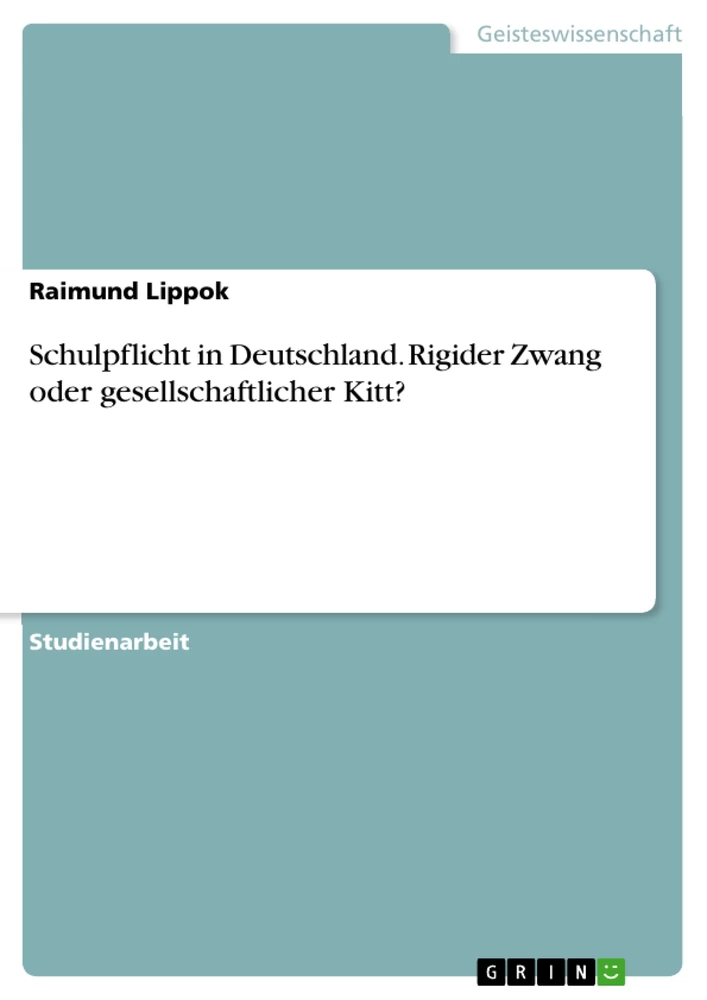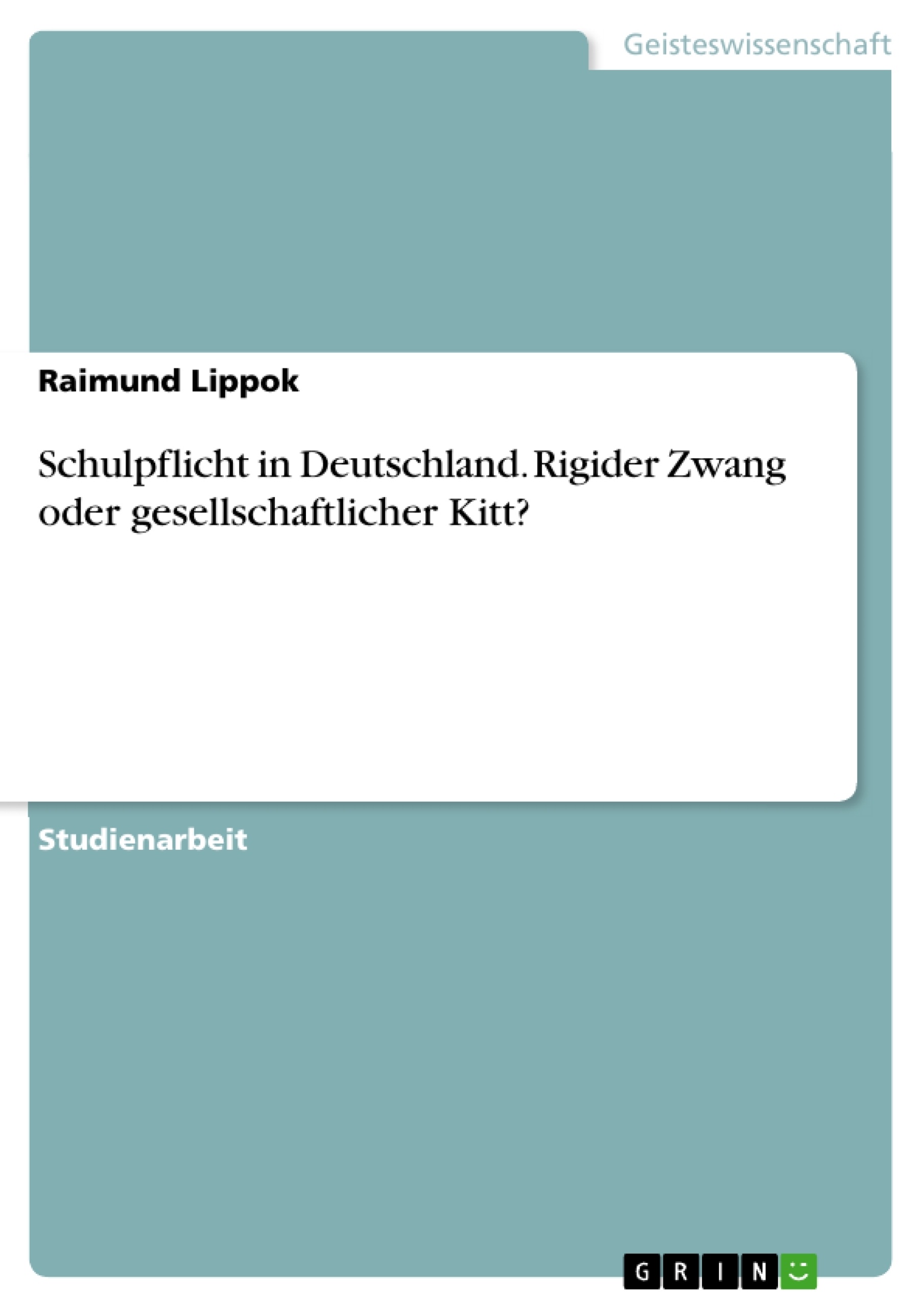Die Schulpflicht war in der Bundesrepublik lange Zeit unumstritten. In den letzten 30 Jahren allerdings nimmt die Kritik zu. Oft aus religiösen, aber auch aus diversen anderen Gründen, wollen Eltern ihre Kinder zuhause unterrichten. Sie glauben, dass die Schule für ihre Kinder nicht der beste Ort ist, um Bildung zu erlangen und sehen sich in ihrem grundgesetzlichen Elternrecht eingeschränkt. Doch sind Eltern wirklich gezwungen, ihre Kinder in die Schule zu schicken, und welche Gründe sprechen für oder gegen eine allgemeine Schulpflicht? Mit diesen Fragen setzt sich diese Arbeit auseinander. Dazu muss zuerst die rechtliche und praktische Situation in Deutschland beschrieben werden. Dann wird aus verschiedenen Perspektiven die Sinnhaftigkeit der Schulpflicht diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Herkunft der Schulpflicht
- Situation in Deutschland
- Rechtslage
- Grundgesetz
- Schulgesetze der Länder
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Praxis
- Rechtslage
- Diskussion
- Soziale Integration
- Schulpflicht als Bildungsgarant
- Mangelnde Entscheidungsfreiheit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Schulpflicht in Deutschland, ihre historische Entwicklung und ihre aktuelle Bedeutung. Sie beleuchtet die rechtlichen Grundlagen und die praktische Umsetzung, sowie die vor- und Nachteile aus verschiedenen Perspektiven. Die Arbeit zielt darauf ab, die Debatte um die Schulpflicht differenziert darzustellen und verschiedene Argumente abzuwägen.
- Historische Entwicklung der Schulpflicht in Deutschland
- Rechtliche Grundlagen der Schulpflicht im Kontext des Grundgesetzes
- Soziale Aspekte der Schulpflicht und ihre Rolle bei der Integration
- Die Schulpflicht als Garant für Bildungsgerechtigkeit
- Die Debatte um die Einschränkung der elterlichen Entscheidungsfreiheit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Schulpflicht in Deutschland ein und beschreibt die zunehmende Kritik an ihr in den letzten 30 Jahren. Sie benennt die zentralen Fragen, mit denen sich die Arbeit auseinandersetzt: die rechtliche und praktische Situation der Schulpflicht in Deutschland und die Diskussion um ihre Sinnhaftigkeit aus verschiedenen Perspektiven. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, diese Fragen zu untersuchen und verschiedene Argumentationslinien abzuwägen.
Herkunft der Schulpflicht: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der Schulpflicht, beginnend mit den Ideen von Plato und dem kommunistischen Manifest, die staatliche Steuerung des Bildungswesens forderten. Es zeigt den Einfluss von Napoleon und Friedrich II. in Preußen auf die Einführung der Schulpflicht, die mit dem preussischen Nationalismus verbunden war. Das Kapitel beschreibt die Rolle von August Hermann Francke bei der Gründung von Privatschulen und seinen Einfluss auf das deutsche Bildungssystem. Weiterhin wird die Einführung der Schulpflicht im Deutschen Kaiserreich 1971 unter Otto von Bismarck thematisiert, wobei die Ausnahmen für Arbeiter- und Bauernkinder in ländlichen Gebieten hervorgehoben werden. Die drei Hauptideen, die zur Schulpflicht führten, werden als Ganzheitlichkeit (Pestalozzi), staatliche Schulaufsicht (Humboldt) und die Einführung der praktischen Pädagogik dargestellt. Schließlich wird der Einfluss des Nationalsozialismus auf das staatliche Schulwesen erläutert.
Situation in Deutschland: Dieses Kapitel beschreibt die allgemeine Schulpflicht in Deutschland als Bildungspolitikum der Länder. Es fokussiert sich auf die rechtlichen Grundlagen und die Umsetzung der Schulpflicht, insbesondere die Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz. Im Detail wird die Rechtslage erläutert, wobei die Unselbständigkeit von Kindern, die elterliche Sorgepflicht und die Verpflichtung der Eltern, für den Schulbesuch ihrer Kinder zu sorgen, im Mittelpunkt stehen. Die Ausnahmefälle einer möglichen Befreiung von der Schulpflicht werden kurz angesprochen. Die Kapitel verbindet die rechtliche Situation mit dem Grundgesetz und den Pflichten der Eltern.
Schlüsselwörter
Schulpflicht, Deutschland, Bildungsgerechtigkeit, Rechtslage, Grundgesetz, elterliche Sorge, soziale Integration, Homeschooling, historische Entwicklung, staatliche Steuerung, Bildungspolitik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Schulpflicht in Deutschland
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Schulpflicht in Deutschland. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Einleitung, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der historischen Entwicklung, den rechtlichen Grundlagen, der praktischen Umsetzung und der gesellschaftlichen Diskussion um die Schulpflicht.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die historische Entwicklung der Schulpflicht in Deutschland, beginnend mit philosophischen Ideen bis hin zum Einfluss des Nationalsozialismus. Es analysiert die rechtlichen Grundlagen im Grundgesetz und den Landesgesetzen, die praktische Umsetzung und die sozialen Aspekte der Schulpflicht, insbesondere ihre Rolle in Bezug auf soziale Integration und Bildungsgerechtigkeit. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Debatte um die elterliche Entscheidungsfreiheit im Kontext der Schulpflicht.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung, Herkunft der Schulpflicht, Situation in Deutschland (inkl. Rechtslage und Praxis), Diskussion (Soziale Integration, Schulpflicht als Bildungsgarant, Mangelnde Entscheidungsfreiheit) und Fazit. Jedes Kapitel wird im Dokument kurz zusammengefasst.
Welche rechtlichen Grundlagen werden behandelt?
Das Dokument beleuchtet die rechtlichen Grundlagen der Schulpflicht in Deutschland, insbesondere im Kontext des Grundgesetzes und der Landesgesetze. Es wird die Rolle des Grundgesetzes, der Schulgesetze der Länder und des Bürgerlichen Gesetzbuches im Zusammenhang mit der Schulpflicht erläutert. Die Unselbständigkeit von Kindern, die elterliche Sorgepflicht und die Verpflichtung der Eltern zum Schulbesuch ihrer Kinder werden thematisiert.
Welche historischen Aspekte werden beleuchtet?
Die historische Entwicklung der Schulpflicht wird von den Ideen von Plato und dem kommunistischen Manifest über den Einfluss von Napoleon und Friedrich II. bis hin zur Einführung der Schulpflicht im Deutschen Kaiserreich unter Otto von Bismarck und dem Einfluss des Nationalsozialismus nachgezeichnet. Die Rolle von August Hermann Francke und die drei Hauptideen (Ganzheitlichkeit, staatliche Schulaufsicht, praktische Pädagogik) werden ebenfalls behandelt.
Welche gesellschaftlichen Aspekte werden diskutiert?
Das Dokument diskutiert die sozialen Aspekte der Schulpflicht, insbesondere ihre Rolle bei der sozialen Integration und als Garant für Bildungsgerechtigkeit. Es thematisiert auch die Debatte um die Einschränkung der elterlichen Entscheidungsfreiheit durch die Schulpflicht.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Schulpflicht, Deutschland, Bildungsgerechtigkeit, Rechtslage, Grundgesetz, elterliche Sorge, soziale Integration, Homeschooling, historische Entwicklung, staatliche Steuerung, Bildungspolitik.
Wo finde ich mehr Informationen zur Schulpflicht in Deutschland?
Weitere Informationen können in den jeweiligen Landesgesetzen zum Schulwesen, im Grundgesetz und im Bürgerlichen Gesetzbuch gefunden werden. Zusätzliche Informationen liefern auch wissenschaftliche Literatur und Berichte zu Bildungspolitik in Deutschland.
- Quote paper
- Raimund Lippok (Author), 2019, Schulpflicht in Deutschland. Rigider Zwang oder gesellschaftlicher Kitt?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/537260