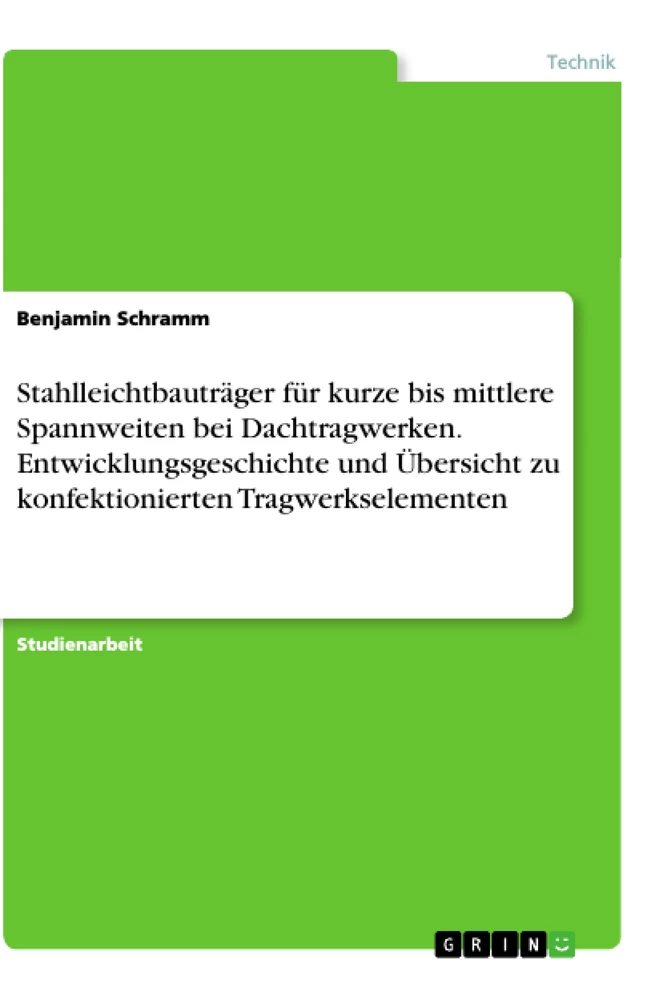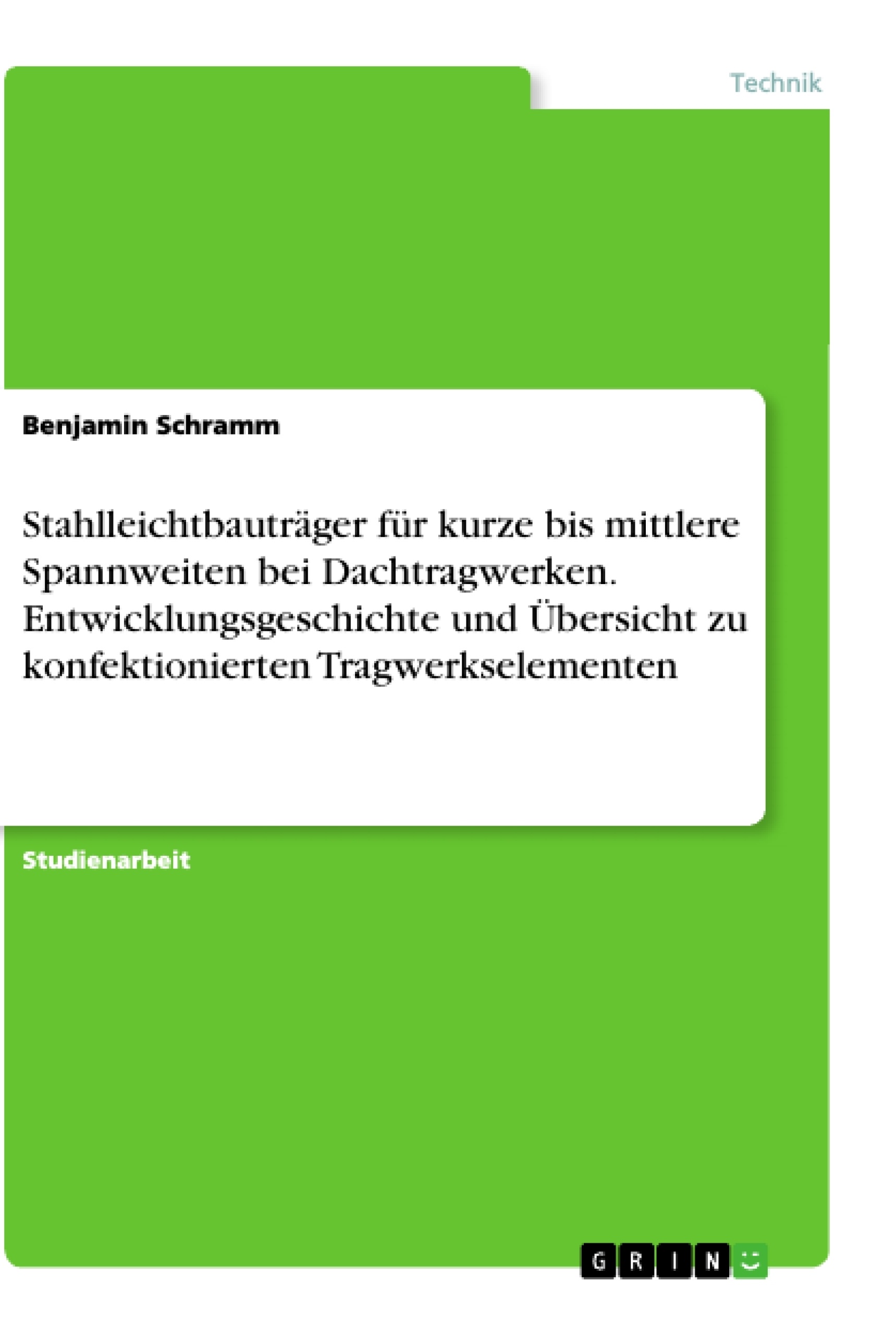Heutzutage tauchen bei Umbauten und Sanierungen von Bestandsgebäuden immer wieder Dachkonstruktionen aus Stahlleichtbau- beziehungsweise Stahlrohrbau auf. Ziel dieser Studienarbeit ist es, die unterschiedlichen Systeme dieser Bauweisen mit einer Spannweite von bis zu 16 Metern aufzuarbeiten, damit zukünftig auftretende Dachkonstruktionen einfacher zugeordnet und besser verstanden werden können.
Im Zuge dessen wird auf die Entstehung, die Einsatzmöglichkeiten beziehungsweise die Anwendungsbereiche, sowie die Vor- und Nachteile eingegangen. Des Weiteren soll auf die relevanten DIN-Normen und die Gründe für die geringe Durchsetzung des Stahlleichtbaus eingegangen werden.
Einer der wesentlichen Gründe, warum es den Stahlleichtbau und die dazugehörige DIN 4115 "Stahlleichtbau und Stahlrohrbau im Hochbau" aus dem Jahr 1950 gibt, liegt im natürlichen Bestreben des Menschen. Schon immer versucht der Mensch Abläufe und Gegenstände durch technische Innovationen zu optimieren, um mit geringeren Arbeits- oder Produktionsmitteln eine gleiche Produktionsmenge bzw. um mit gleichen Arbeits- und Produktionsmitteln eine höhere Produktionsmenge zu erstellen.
Dieser sogenannte technische Fortschritt lässt sich ebenso auf alle Fachbereiche des Bauwesens, unabhängig ob Holz-, Massiv- oder Stahlbau, übertragen. Im Bauwesen wird der technische Fortschritt häufig definiert mit einer Verringerung des Gewichtes der Baukonstruktion sowie der Fertigungs- und Montagekosten, bei einer gleichzeitigen Erhaltung oder gar Erhöhung der Tragfähigkeit und des Nutzwertes. Es war daher nur eine Frage der Zeit, bis der Mensch versuchen würde den Stahlbau mit neuen Methoden und Techniken zu verbessern bzw. effizienter zu machen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Problemstellung und Ziel der Studienarbeit
- 1.2. Gang der Untersuchung
- 2. Allgemeines zum Stahlleicht- und zum Stahlrohrbau
- 2.1. Entstehung und historische Entwicklung
- 2.2. Einsatzmöglichkeiten bzw. Anwendungsbereiche
- 2.3. Vor- und Nachteile von Stahlleichtbaukonstruktionen
- 2.3.1. Vorteile
- 2.3.2. Nachteile
- 2.3.3. Zwischenfazit und abschließender Vergleich
- 2.4. Bewertungskriterien für den Stahlleichtbau
- 3. Stahlbaubestimmungen
- 3.1. Relevante DIN-Normen für den Stahl, Stahlleicht- und Stahlrohrbau
- 3.1.1. Berechnungsgrundlagen für Stahl im Hochbau DIN 1050
- 3.1.2. Vorschriften für geschweißte Stahlhochbauten DIN 4100
- 3.1.3. Stahlleicht- und Stahlrohrbau im Hochbau DIN 4115
- 3.2. Zusammenfassung der Merkmale des Stahlleicht- und Stahlrohrbaus
- 4. Stahldächer
- 4.1. Grundbegriffe des Daches
- 4.2. Dachformen
- 4.3. Allgemeiner Dachaufbau
- 4.4. Dachkonstruktionen
- 4.5. Binderarten und Räumliche Tragwerke
- 4.5.1. Dreieckbinder für Satteldächer
- 4.5.2. Balkenbinder für Satteldächer
- 4.5.3. Dreieck- und Balkenbinder für Pultdächer
- 4.5.4. Räumliche Tragwerke
- 4.6. Profilarten
- 4.7. Konstruktionsgrundlagen
- 4.8. Korrosionsschutz
- 5. Stahlleichtbau- und Stahlrohrbau-Systeme
- 5.1. Dachbinder
- 5.1.1. Jucho-Leichtbaubinder aus Bandstahlprofilen
- 5.1.2. Dachsparren-Binder veränderlicher Stützweite der Fa. Jucho
- 5.1.3. Leichtbau-Rahmenbinder aus Bandstahlprofilen
- 5.1.4. R-Träger aus T-Gurten mit Rundstahlaussteifung
- 5.1.5. Binder des Wuppermann Systems
- 5.1.6. Stran-Steel-System
- 5.1.7. Metsec-Binder
- 5.1.8. Typendachbinder der Deutschen Röhrenwerke aus geschweißten Stahlrohren
- 5.1.9. Stall-Typenbinder aus geschweißten Stahlrohren
- 5.1.10. Doppelwandiger Leichtbaubinder
- 5.1.11. Polonceau-Binder
- 5.1.12. Typisierte Konstruktion einer LKW-Garage
- 5.1.13. Filigran-Binder
- 5.1.14. Fachwerkbinder nach dem Mannesmann-System
- 5.1.15. Geschweißte Rundstahlkonstruktionen der Mannesmannröhren-Werke AG
- 5.2. Räumliche Tragwerke und Skelettkonstruktionen
- 5.2.1. Tezet-Fertighalle der Fa. Wuppermann
- 5.2.2. Unistrut-System
- 5.2.3. Kipszer-Tragwerk
- 5.2.4. Dolesta-Rahmenbinder
- 5.2.5. Metsec-Technique-Halle
- 5.3. Dachdecken
- 5.3.1. LKT-Decke
- 5.3.2. Fenestra-Dachplatte Typ Holorib-Decke
- 5.3.3. Mahon-Dachplatte
- 5.3.4. Tektal-Dach der Hoesch AG
- 5.3.5. Stahl-Gips-Dachplatte
- 5.4. Träger mit Aussparungen
- 5.5. Sonderkonstruktionen und Sonderlösungen
- 5.5.1. Leichtbauträger des Herstellers Alexander Siegel
- 5.5.2. Punktgeschweißter Hohlträger mit X-Querschnitt - Hrst. Alexander Siegel
- 5.5.3. Kaltprofile mit gelochten Wänden (Dexion-Profile)
- 5.5.4. X-Träger der Fa. Filigranbau
- 5.5.5. Dolesta Verbunddachsparren
- 5.5.6. Einwinkelfachwerk (M.E. Binder)
- 5.6. Zwischenfazit
- 6. Mögliche Gründe für eine geringe Durchsetzung des Stahlleichtbaus
- 7. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit untersucht die Entwicklungsgeschichte und die verschiedenen Systeme des Stahlleichtbaus für Dachtragwerke mit kurzen bis mittleren Spannweiten. Ziel ist die Aufarbeitung der unterschiedlichen Systeme, um zukünftige Dachkonstruktionen besser zuordnen und verstehen zu können. Die Arbeit analysiert Entstehung, Anwendungsbereiche, Vor- und Nachteile sowie relevante DIN-Normen.
- Entwicklungsgeschichte des Stahlleichtbaus
- Vor- und Nachteile von Stahlleichtbaukonstruktionen
- Relevante DIN-Normen und deren Auswirkungen
- Übersicht verschiedener Stahlleichtbau-Systeme
- Gründe für die geringe Durchsetzung des Stahlleichtbaus
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Stahlleichtbaus ein und beschreibt die Zielsetzung der Arbeit. Sie hebt die Notwendigkeit hervor, die verschiedenen Stahlleichtbau- und Stahlrohrbausysteme für Dachtragwerke besser zu verstehen und zuordnen zu können, insbesondere im Kontext von Umbauten und Sanierungen. Die Arbeit fokussiert sich auf Systeme mit Spannweiten bis zu 16 Metern.
2. Allgemeines zum Stahlleicht- und zum Stahlrohrbau: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung und historische Entwicklung des Stahlleichtbaus, beginnend mit frühen Versuchen im 20. Jahrhundert, die durch Kriegswirtschaft und Werkstoffknappheit motiviert waren. Es werden Pioniere wie Fritz Leonhardt und Max Mengeringhausen genannt und deren Beiträge zur Optimierung von Stahlkonstruktionen erläutert. Es werden auch die Einsatzmöglichkeiten, Vor- und Nachteile von Stahlleichtbaukonstruktionen im Detail diskutiert, mit besonderem Fokus auf Stahlverbrauch, Montagezeiten und Kosten.
3. Stahlbaubestimmungen: Dieses Kapitel befasst sich mit den relevanten DIN-Normen (DIN 1050, DIN 4100, DIN 4115) für den Stahlbau, Stahlleichtbau und Stahlrohrbau, die im Kontext der 1940er und 1950er Jahre betrachtet werden. Es werden die Unterschiede zwischen den Normen für herkömmlichen Stahlbau und Stahlleichtbau herausgestellt, insbesondere in Bezug auf Mindestquerschnitte, zulässige Werkstoffe und Schweißverfahren. Die DIN 4115 wird detailliert erläutert und deren Bedeutung für die Zulassung und Ausführung von Stahlleichtbauteilen hervorgehoben.
4. Stahldächer: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Einführung in die Grundlagen des Dachbaus. Es werden Grundbegriffe, verschiedene Dachformen (Sattel-, Walm-, Pultdach), der allgemeine Dachaufbau und die gängigsten Dachkonstruktionen (Sparren-, Kehlbalken-, Pfetten- und Binderdach) erläutert. Die Beschreibung der verschiedenen Binderarten (Dreieckbinder, Balkenbinder, räumliche Tragwerke) bildet die Grundlage für das Verständnis der im folgenden Kapitel beschriebenen Stahlleichtbau-Systeme.
5. Stahlleichtbau- und Stahlrohrbau-Systeme: Dieses Kapitel stellt eine Vielzahl an Stahlleichtbau- und Stahlrohrbausystemen verschiedener Hersteller vor und analysiert diese im Detail. Es werden verschiedene Bindertypen (Jucho-Leichtbaubinder, Dachsparrenbinder, R-Träger, Wuppermann-System, Stran-Steel-System, Metsec-Binder, etc.) sowie räumliche Tragwerke und Dachdecken (LKT-Decke, Holorib-Decke, Mahon-Dachplatte, Tektal-Dach, Stahl-Gips-Dachplatte) beschrieben und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile sowie konstruktive Besonderheiten erläutert. Der Kapitel enthält auch Informationen zu Sonderkonstruktionen und -lösungen, die nicht in die vorherigen Kategorien passen.
6. Mögliche Gründe für eine geringe Durchsetzung des Stahlleichtbaus: Dieses Kapitel untersucht die Gründe für die geringe Verbreitung von Stahlleichtbausystemen in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern. Es werden verschiedene Faktoren analysiert, darunter die höhere Anzahl an Zimmereien und Dachdeckereien im Vergleich zu Stahlbauunternehmen, die potenziellen Vorbehalte gegenüber neuen Technologien, die Kostenentwicklung von Stahl im Vergleich zu Holz sowie Aspekte des Brandschutzes. Die Diskussion zeigt, dass es wahrscheinlich keine einzelne Ursache, sondern eine Kombination von Faktoren gab, die zur geringen Durchsetzung beitrugen.
Schlüsselwörter
Stahlleichtbau, Stahlrohrbau, Dachtragwerke, DIN 4115, Leichtbaukonstruktionen, Profilstahl, Bandstahl, Rohrkonstruktionen, Korrosionsschutz, Wirtschaftlichkeit, Montage, Historische Entwicklung, DIN-Normen, Stahleinsparung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studienarbeit: Stahlleichtbau für Dachtragwerke
Was ist der Gegenstand dieser Studienarbeit?
Die Studienarbeit befasst sich mit der Entwicklungsgeschichte und den verschiedenen Systemen des Stahlleichtbaus für Dachtragwerke mit kurzen bis mittleren Spannweiten (bis ca. 16 Meter). Sie analysiert Entstehung, Anwendungsbereiche, Vor- und Nachteile sowie relevante DIN-Normen der verschiedenen Systeme.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die unterschiedlichen Stahlleichtbau- und Stahlrohrbausysteme für Dachtragwerke aufzuarbeiten, um zukünftige Dachkonstruktionen besser zuordnen und verstehen zu können. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der verschiedenen Systeme im Kontext von Umbauten und Sanierungen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklungsgeschichte des Stahlleichtbaus, die Vor- und Nachteile von Stahlleichtbaukonstruktionen, relevante DIN-Normen und deren Auswirkungen, eine Übersicht verschiedener Stahlleichtbau-Systeme und die Gründe für die geringe Durchsetzung des Stahlleichtbaus.
Welche DIN-Normen sind relevant?
Die Arbeit behandelt die DIN 1050 (Berechnungsgrundlagen für Stahl im Hochbau), DIN 4100 (Vorschriften für geschweißte Stahlhochbauten) und insbesondere die DIN 4115 (Stahlleicht- und Stahlrohrbau im Hochbau). Die Bedeutung dieser Normen für die Zulassung und Ausführung von Stahlleichtbauteilen wird detailliert erläutert.
Welche Stahlleichtbau- und Stahlrohrbausysteme werden vorgestellt?
Das Kapitel 5 präsentiert eine Vielzahl an Systemen verschiedener Hersteller, darunter verschiedene Bindertypen (Jucho-Leichtbaubinder, Dachsparrenbinder, R-Träger, Wuppermann-System, Stran-Steel-System, Metsec-Binder, etc.), räumliche Tragwerke, Dachdecken (LKT-Decke, Holorib-Decke, Mahon-Dachplatte, Tektal-Dach, Stahl-Gips-Dachplatte) und Sonderkonstruktionen. Jedes System wird detailliert beschrieben, inklusive Vor- und Nachteile sowie konstruktiver Besonderheiten.
Welche Gründe werden für die geringe Durchsetzung des Stahlleichtbaus genannt?
Die geringe Verbreitung von Stahlleichtbausystemen in Deutschland wird auf verschiedene Faktoren zurückgeführt, darunter die höhere Anzahl an Zimmereien und Dachdeckereien im Vergleich zu Stahlbauunternehmen, potenzielle Vorbehalte gegenüber neuen Technologien, die Kostenentwicklung von Stahl im Vergleich zu Holz und Aspekte des Brandschutzes. Es wird argumentiert, dass es wahrscheinlich keine einzelne Ursache, sondern eine Kombination von Faktoren gibt.
Welche historischen Aspekte werden beleuchtet?
Die Arbeit beleuchtet die Entstehung und historische Entwicklung des Stahlleichtbaus, beginnend mit frühen Versuchen im 20. Jahrhundert, die durch Kriegswirtschaft und Werkstoffknappheit motiviert waren. Sie nennt Pioniere wie Fritz Leonhardt und Max Mengeringhausen und erläutert deren Beiträge zur Optimierung von Stahlkonstruktionen.
Welche Dachkonstruktionen werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Dachformen (Sattel-, Walm-, Pultdach), den allgemeinen Dachaufbau und gängige Dachkonstruktionen (Sparren-, Kehlbalken-, Pfetten- und Binderdach). Verschiedene Binderarten (Dreieckbinder, Balkenbinder, räumliche Tragwerke) werden detailliert erläutert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Stahlleichtbau, Stahlrohrbau, Dachtragwerke, DIN 4115, Leichtbaukonstruktionen, Profilstahl, Bandstahl, Rohrkonstruktionen, Korrosionsschutz, Wirtschaftlichkeit, Montage, Historische Entwicklung, DIN-Normen, Stahleinsparung.
- Quote paper
- Benjamin Schramm (Author), 2019, Stahlleichtbauträger für kurze bis mittlere Spannweiten bei Dachtragwerken. Entwicklungsgeschichte und Übersicht zu konfektionierten Tragwerkselementen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/535365