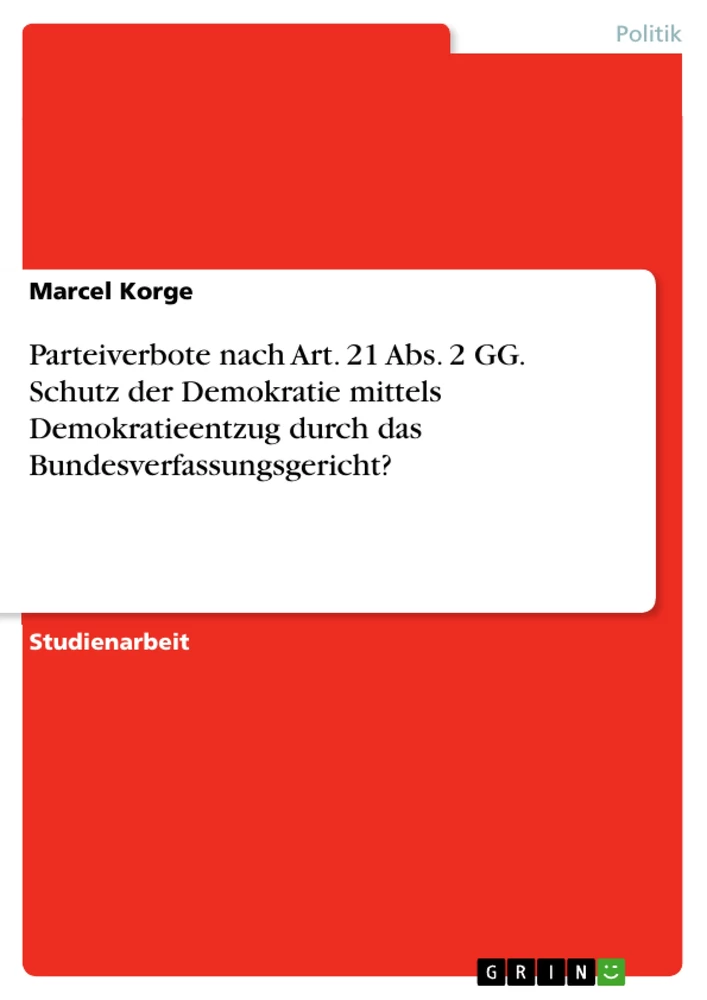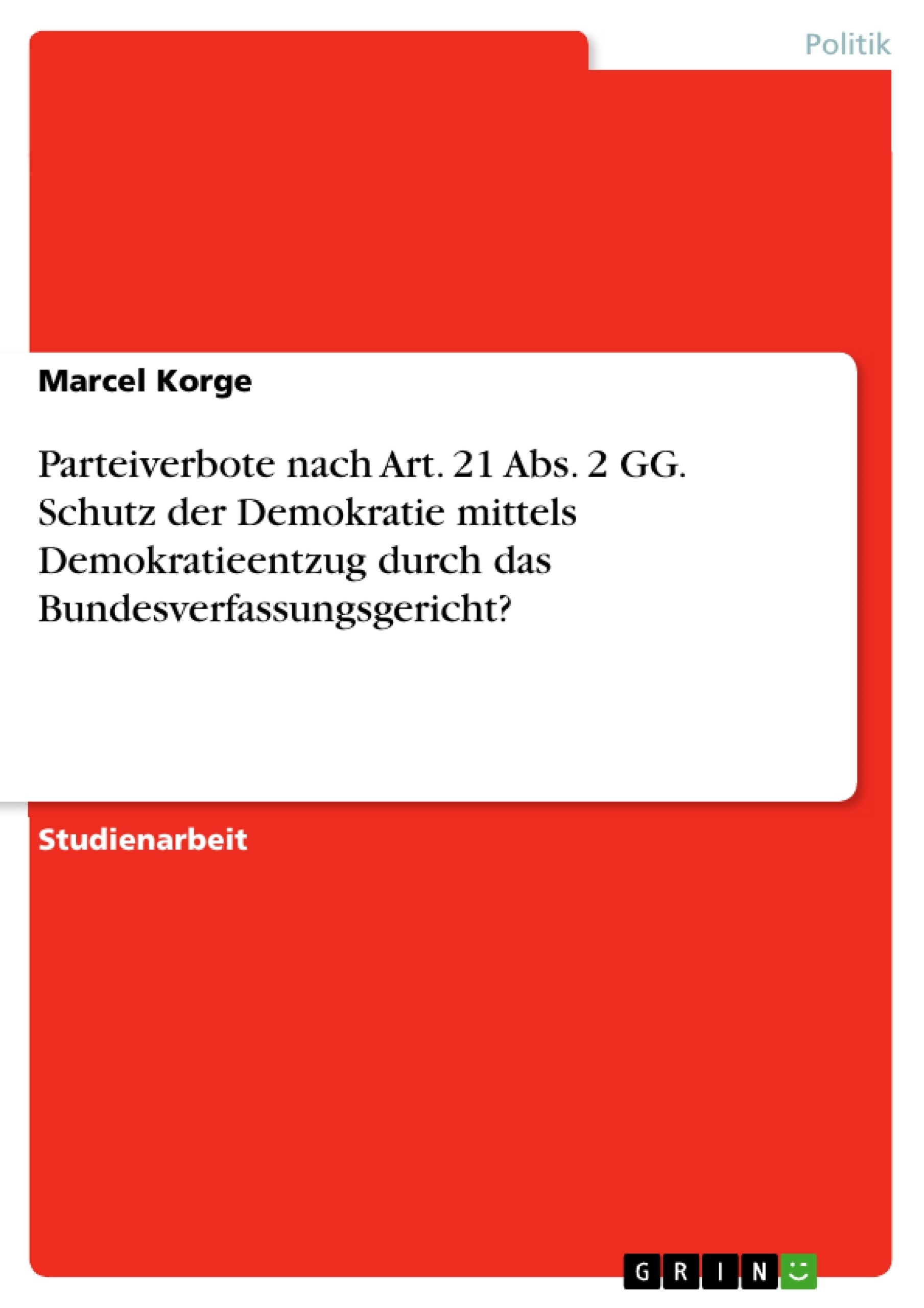„Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Über die Frage der Verfassungswidrigkeit entscheidet das Bundesverfassungsgericht.“ (Art. 21 Abs. 2 Grundgesetz)
In den westlichen Mutterländern Großbritannien und USA kennt man keinerlei vergleichbaren Verfassungsartikel. Dennoch strahlte das deutsche Beispiel Vorbildwirkung auf die Staaten östlich der BRD nach einer Zeit der politischen Transformation aus. Umso wichtiger scheint es zu hinterfragen, inwieweit sich Demokratie schützen lässt, indem ein Teil demokratischer Freiheit verboten wird. Welche Probleme ergeben sich konkret aus der Möglichkeit eines Parteiverbotes? Die vorliegende Arbeit untersucht diese Fragen und versucht darüber hinaus zu klären, ob ein Parteiverbotsverfahren noch zeitgemäß ist und notwendig bleibt.
Als Ausgangspunkt muss nach dem Ziel gefragt werden, welches mit Art. 21 Abs. 2 GG ursprünglich erreicht werden sollte, um anschließend zu prüfen, ob dies heute noch gelingen kann. Dabei werden neben Definitions- und Interpretationsproblematiken sowohl demokratie-theoretische als auch rein praktische Defizite des Parteiverbotsverfahrens dargelegt. Verschiedene Forderungen und Anschauungen diverser Politologen werden berücksichtigt und gegenübergestellt, um schließlich die Funktionalität des Parteiverbots für die Demokratie zu hinterfragen. In einem Fazit werden die Ergebnisse der Erläuterungen knapp zusammengefasst. Darüber hinaus möchte ich dabei meine eigene Meinung einbringen.
Bei den Ausführungen stütze ich mich besonders auf die Monographien zum Parteiverbotsverfahren von Armin Zirn und Horst Meier, in welchen sich insbesondere letzterer mit den kritischen Seiten des Art. 21 Abs. 2 GG auseinandergesetzt hat. Ferner werden die Urteilsbegründungen des Bundesverfassungsgerichts herangezogen, sich ein Bild über die Interpretation des Parteiverbotsverfahrens durch die Instanz zu machen, welche allein über ein mögliches Verbot entscheidet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Demokratieschutz aufgrund historischer Erfahrungen?
- Schutz der Demokratie durch Schutz vor Demokratie?
- Definitions- und Interpretationsprobleme
- ,,Parteien“
- ,,nach ihren Zielen“
- ,,nach dem Verhalten ihrer Anhänger“
- ,,darauf ausgehen“, „beeinträchtigen“, „beseitigen“, „gefährden“
- ,,die freiheitliche demokratische Grundordnung“
- Gefahr einer Instrumentalisierung?
- Unangewandte Drohgebärde?
- Antragstellung nach pflichtgemäßem Ermessen?
- Geheimdienstliche Ermittlungen
- Behandlung noch nicht verbotener Parteien und deren Mitglieder
- Ewige Gerichtsurteile?
- Die Beziehung zum Artikel 139 GG
- Gestörte Funktionalität für die Demokratie?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Problematik des Parteiverbotes nach Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes. Sie befasst sich mit der ursprünglichen Zielsetzung des Artikels und analysiert, ob diese im heutigen Kontext noch erreicht werden kann. Die Arbeit beleuchtet sowohl demokratietheoretische als auch praktische Defizite des Parteiverbotsverfahrens und hinterfragt dessen Funktionalität für die Demokratie.
- Analyse der Zielsetzung von Artikel 21 Absatz 2 GG
- Bewertung der Funktionsfähigkeit des Parteiverbots in der heutigen Zeit
- Identifizierung von demokratietheoretischen und praktischen Defiziten des Verfahrens
- Gegenüberstellung verschiedener Perspektiven von Politologen zum Thema
- Bewertung der Funktionalität des Parteiverbots für die Demokratie
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Problematik des Parteiverbots anhand von Artikel 21 Absatz 2 GG vor und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie betont die Relevanz der Frage, ob Demokratie durch ein Verbot demokratischer Freiheit geschützt werden kann.
- Das zweite Kapitel analysiert den historischen Kontext des Parteiverbots, insbesondere die Erfahrungen der Weimarer Republik. Es wird diskutiert, ob der Untergang der Weimarer Republik tatsächlich auf fehlende politische Instrumente zum Schutz der Verfassung zurückzuführen ist.
- Das dritte Kapitel beleuchtet die Problematik des Schutzes der Demokratie durch ein Verbot eines Teils ihrer eigenen Freiheitsrechte. Es werden die möglichen Folgen und Gefahren einer solchen Vorgehensweise diskutiert.
- Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit den Definitions- und Interpretationsproblemen des Parteiverbots. Es werden die zentralen Begriffe des Artikels 21 Absatz 2 GG, wie „Parteien“, „Ziele“, „Verhalten“, „beeinträchtigen“ und „freiheitliche demokratische Grundordnung“, genauer untersucht.
- Das fünfte Kapitel behandelt die Frage der möglichen Instrumentalisierung des Parteiverbots. Es wird hinterfragt, ob das Verbot einer Partei auch zu einem politischen Instrument zur Unterdrückung von Opposition werden könnte.
Schlüsselwörter
Parteiverbot, Artikel 21 Absatz 2 GG, Demokratie, Freiheitliche demokratische Grundordnung, Weimarer Republik, Verfassungsschutz, Instrumentalisierung, Definitions- und Interpretationsprobleme, Funktionalität, Demokratieentzug
- Quote paper
- Marcel Korge (Author), 2004, Parteiverbote nach Art. 21 Abs. 2 GG. Schutz der Demokratie mittels Demokratieentzug durch das Bundesverfassungsgericht?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/53522