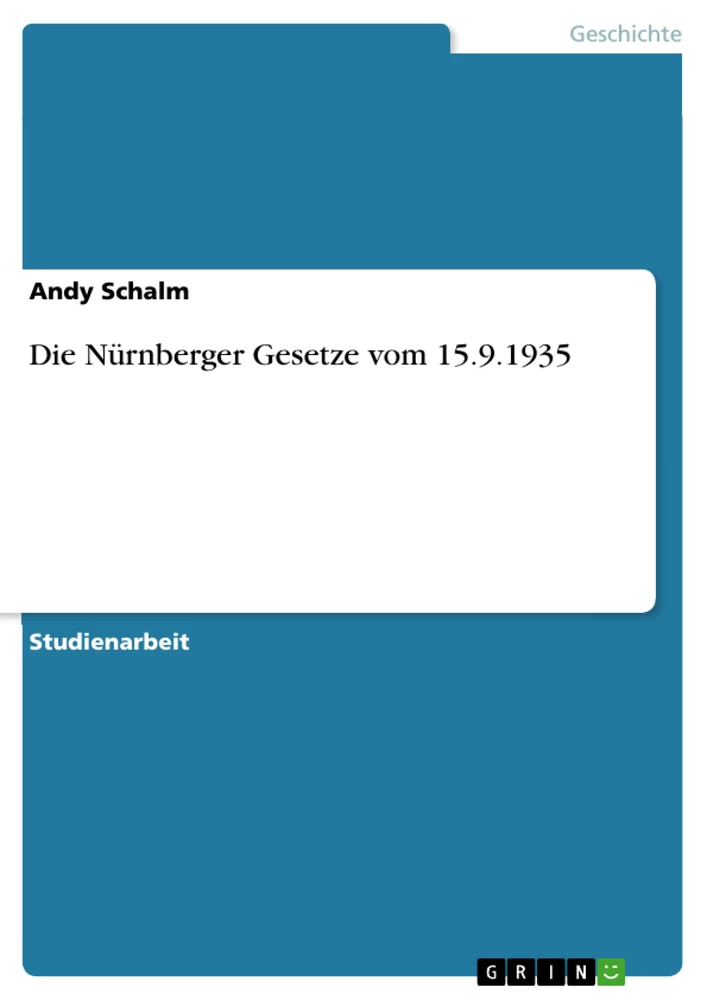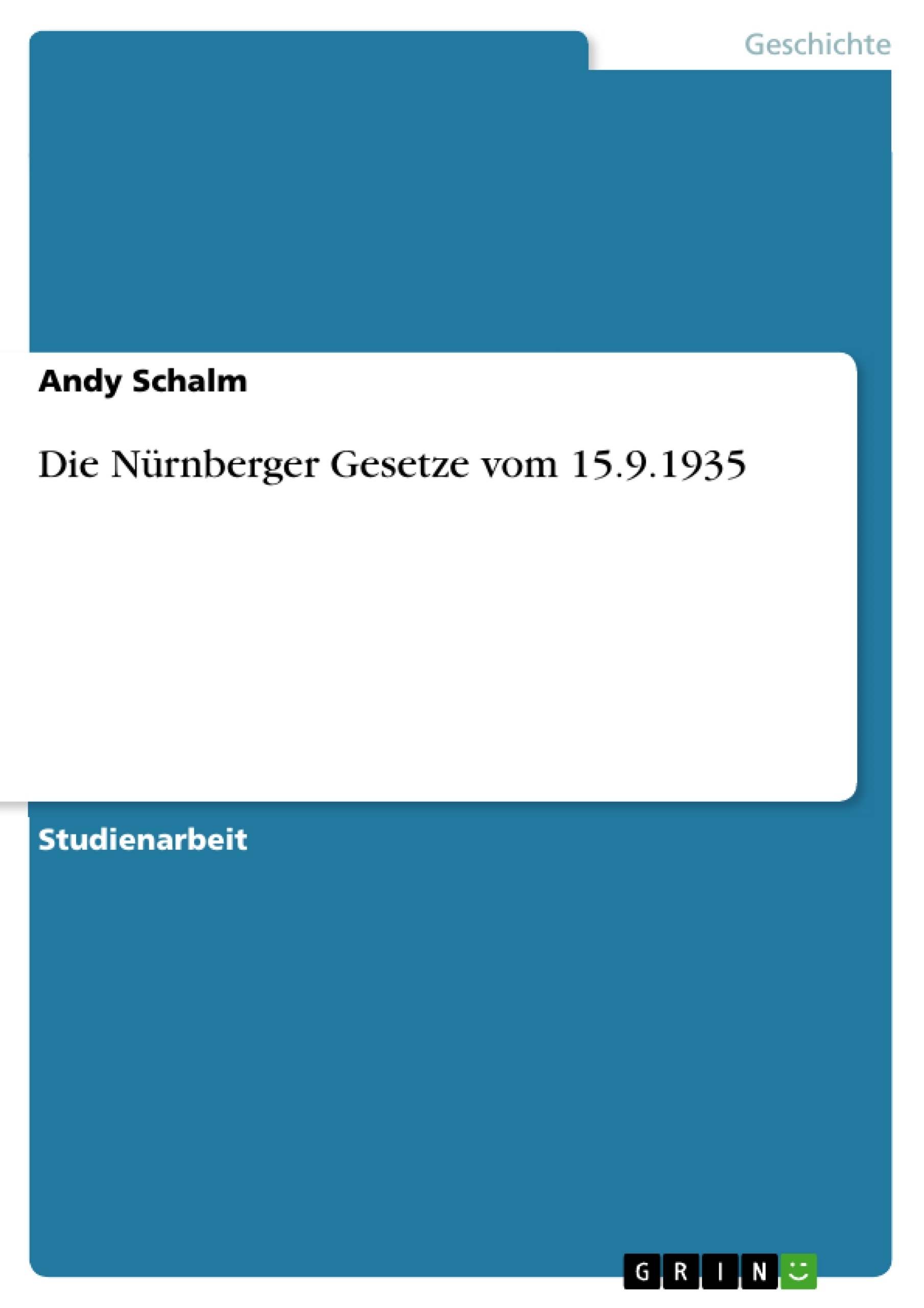Bereits das Parteiprogramm der NSDAP vom 24. Februar 1920 hatte den Ausschluß der Juden aus dem deutschen Wirtschafts– und Kulturleben (Punkt 4,5,8) vorgesehen. Zu diesem Zweck hat der nationalsozialistische Staat insgesamt mehr als 1.500 Gesetze und Verordnungen rassistischen Inhalts erlassen, vom Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums von 1933 bis zum Gesetz „über die Strafrechtspflege gegen Polen und Juden in den eingegliederten Ostgebieten“ von 19411. Das „Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“ und das „Reichsbürgergesetz“ vom 15. November 1935 bildeten den Kern der „Rassegesetze“, mit denen die jüdischen deutschen Bürger und die „Zigeuner“ ausgegrenzt wurden und gelten als Grundlage für den Beginn der systematischen Beseitigung derselben. Warum „Nürnberger“ Gesetze?
Nach Parteitagen in München und Weimar fiel schon 1927 die Wahl der Nationalsozialisten auf Nürnberg als Versammlungsort. Neben der zentralen Lage der Stadt mit ihrer guten Verkehrsanbindung wollte man vor allem die historische Kulisse und die Reichstradition der Stadt zur Selbstdarstellung der NSDAP nutzen. Nach dem Parteitag 1929 weigerte sich zwar die Stadt, in den folgenden beiden Jahren Gebäude für die Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen, doch schon ab 1932 wurde Nürnberg zur „Stadt der Reichsparteitage“.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Quellenkritik
- 1.1. Quellenbeschreibung
- 1.2. Innere Kritik
- 1.2.1. Sprachliche Aufschlüsselung der Quelle
- 1.2.2. Sachliche Aufschlüsselung der Quelle
- 2. Quelleninterpretation
- 2.1. Inhaltsangabe
- 2.2. Einordnung in den historischen Kontext
- 2.2.1. Grundzüge der Judenverfolgung vom Mittelalter bis ins 3. Reich
- 2.2.2. Entstehung der „Nürnberger Gesetze“
- 2.2.3. Zielsetzungen der „Nürnberger Gesetze“
- 3. Weitere Stationen der Judenverfolgung
- 4. Ergebnis und Ausblick
- 5. Auswahlbibliographie
- 5.1. Quellen
- 5.2. Literatur
- 6. Anhang: Die Quelle
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die „Nürnberger Gesetze“ vom 15. September 1935. Ziel ist es, die Gesetze im Kontext der nationalsozialistischen Judenverfolgung zu betrachten und deren Bedeutung zu erläutern. Die Quellenkritik spielt dabei eine zentrale Rolle.
- Quellenkritische Analyse der Nürnberger Gesetze
- Einordnung der Gesetze in den historischen Kontext der Judenverfolgung
- Sprachliche und sachliche Aufschlüsselung der Gesetzestexte
- Definition des Begriffs „Jude“ im nationalsozialistischen Kontext
- Die Auswirkungen der Nürnberger Gesetze auf das Leben jüdischer Bürger
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Diese Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und führt in das Thema der Nürnberger Gesetze ein. Sie zeigt die Einbettung der Gesetze in das Gesamtgeschehen der nationalsozialistischen Judenverfolgung auf und skizziert den weiteren Verlauf der Arbeit.
1. Quellenkritik: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der kritischen Analyse der Quellen, den Nürnberger Gesetzen selbst. Es werden sowohl die Quellen beschrieben (Format, Herkunft etc.) als auch eine innere Kritik durchgeführt. Die sprachliche Analyse beleuchtet die Mehrdeutigkeit des Begriffs „Jude“ und verweist auf klärende Memoranden. Die sachliche Analyse betrachtet die Durchführungsverordnungen und die weitreichenden Auswirkungen der Gesetze auf das Leben jüdischer Bürger.
2. Quelleninterpretation: Dieses Kapitel interpretiert die Nürnberger Gesetze. Die Inhaltsangabe fasst die Einteilung der Bürger in „Reichsbürger“ und „Staatsangehörige“ zusammen und hebt die hierarchische Bewertung hervor. Die Einordnung in den historischen Kontext beleuchtet die Vorgeschichte der Judenverfolgung, die Entstehung der Gesetze und ihre Zielsetzungen. Es werden Verbindungen zu anderen Ereignissen und Gesetzen der NS-Zeit hergestellt, um die Bedeutung der Nürnberger Gesetze im Gesamtkontext deutlich zu machen.
3. Weitere Stationen der Judenverfolgung: Dieses Kapitel (dessen Inhalt im Ausgangstext nicht gegeben ist, und somit nur spekulativ hier dargestellt werden kann) würde vermutlich weitere Maßnahmen der nationalsozialistischen Judenverfolgung nach den Nürnberger Gesetzen beschreiben und analysieren. Es würde den fortschreitenden Prozess der Diskriminierung, Entrechtung und schließlich Vernichtung der Juden beleuchten und die Nürnberger Gesetze als einen entscheidenden Schritt in diesem Prozess darstellen.
Schlüsselwörter
Nürnberger Gesetze, Judenverfolgung, Nationalsozialismus, Quellenkritik, Reichsbürgergesetz, Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre, Rassenideologie, Antisemitismus, Diskriminierung, Deutsches Reich.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu den Nürnberger Gesetzen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Nürnberger Gesetze vom 15. September 1935 im Kontext der nationalsozialistischen Judenverfolgung. Sie untersucht die Gesetze selbst, deren historische Einbettung und deren Bedeutung für das Leben jüdischer Bürger im Deutschen Reich.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Quellenkritik (mit Quellenbeschreibung und innerer Kritik, inkl. sprachlicher und sachlicher Aufschlüsselung), Quelleninterpretation (mit Inhaltsangabe und Einordnung in den historischen Kontext), Weitere Stationen der Judenverfolgung, Ergebnis und Ausblick, Auswahlbibliographie (Quellen und Literatur) und Anhang (mit der Quelle selbst).
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Nürnberger Gesetze im Kontext der nationalsozialistischen Judenverfolgung zu betrachten und deren Bedeutung zu erläutern. Die Quellenkritik spielt dabei eine zentrale Rolle.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Quellenkritische Analyse der Nürnberger Gesetze, Einordnung der Gesetze in den historischen Kontext der Judenverfolgung, Sprachliche und sachliche Aufschlüsselung der Gesetzestexte, Definition des Begriffs „Jude“ im nationalsozialistischen Kontext und die Auswirkungen der Nürnberger Gesetze auf das Leben jüdischer Bürger.
Wie wird die Quellenkritik durchgeführt?
Die Quellenkritik umfasst eine Beschreibung der Quellen (Format, Herkunft etc.) und eine innere Kritik. Die sprachliche Analyse beleuchtet die Mehrdeutigkeit des Begriffs „Jude“ und verweist auf klärende Memoranden. Die sachliche Analyse betrachtet die Durchführungsverordnungen und die weitreichenden Auswirkungen der Gesetze auf das Leben jüdischer Bürger.
Wie wird die Quelleninterpretation vorgenommen?
Die Quelleninterpretation beinhaltet eine Inhaltsangabe, die die Einteilung der Bürger in „Reichsbürger“ und „Staatsangehörige“ zusammenfasst und die hierarchische Bewertung hervorhebt. Die Einordnung in den historischen Kontext beleuchtet die Vorgeschichte der Judenverfolgung, die Entstehung der Gesetze und ihre Zielsetzungen. Verbindungen zu anderen Ereignissen und Gesetzen der NS-Zeit werden hergestellt.
Was wird im Kapitel „Weitere Stationen der Judenverfolgung“ behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt und analysiert weitere Maßnahmen der nationalsozialistischen Judenverfolgung nach den Nürnberger Gesetzen. Es beleuchtet den fortschreitenden Prozess der Diskriminierung, Entrechtung und schließlich Vernichtung der Juden und stellt die Nürnberger Gesetze als entscheidenden Schritt in diesem Prozess dar.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Relevante Schlüsselwörter sind: Nürnberger Gesetze, Judenverfolgung, Nationalsozialismus, Quellenkritik, Reichsbürgergesetz, Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre, Rassenideologie, Antisemitismus, Diskriminierung, Deutsches Reich.
Wo finde ich die Quelle der Nürnberger Gesetze?
Die Quelle der Nürnberger Gesetze befindet sich im Anhang der Arbeit.
- Quote paper
- Andy Schalm (Author), 1999, Die Nürnberger Gesetze vom 15.9.1935, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/53257