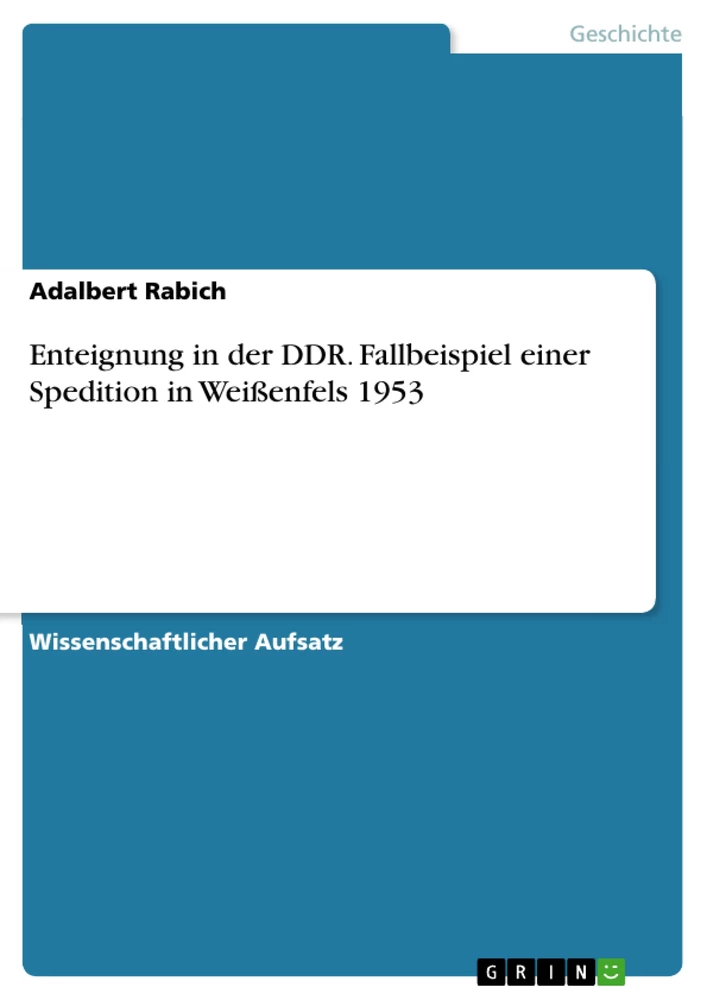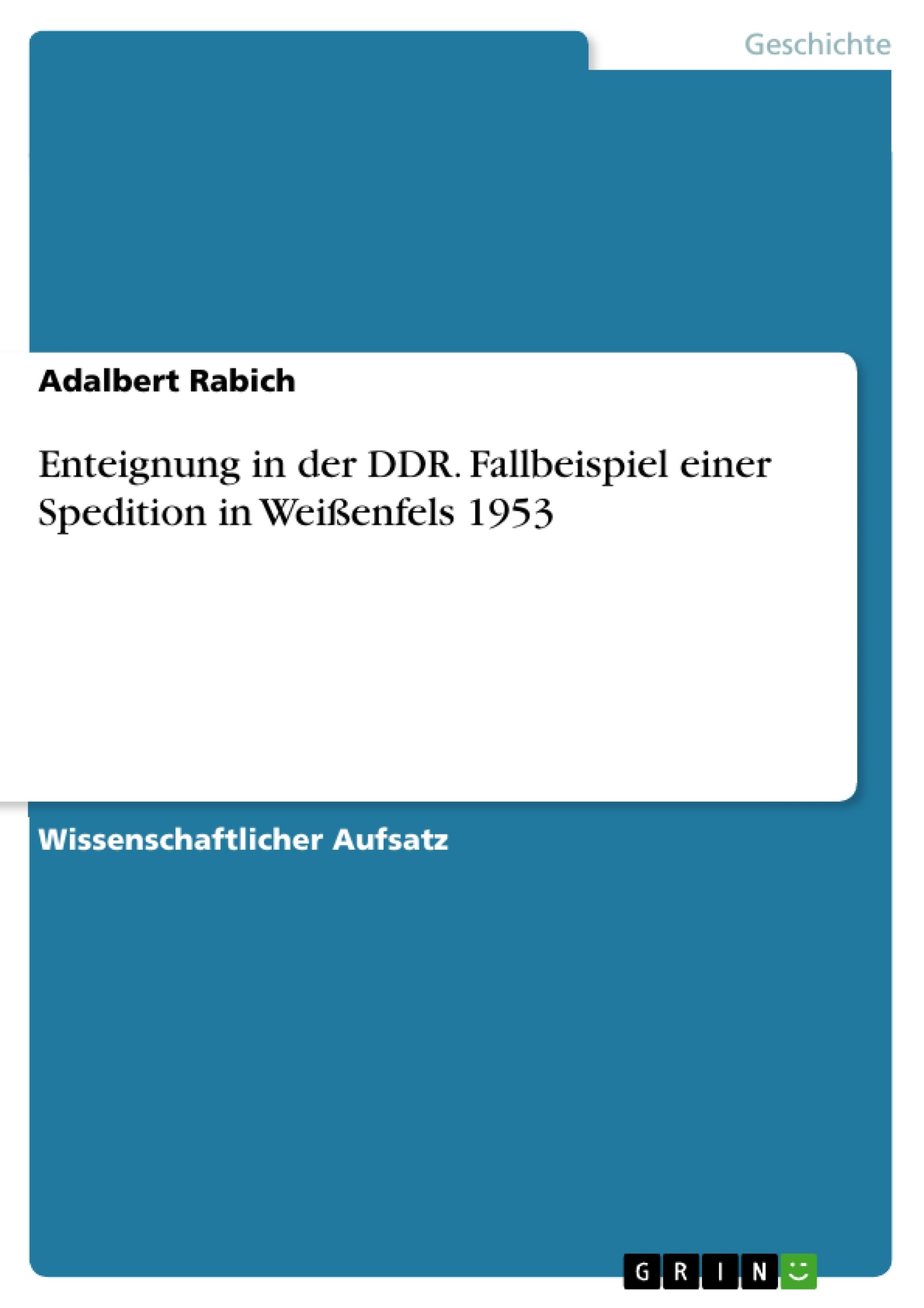Die Gebrüder Löbbert begannen ihre Unternehmungen auf den verschiedensten Gebieten, etwa um 1980 in der Entsorgungswirtschaft, insbesondere auch in dem Bereich des gesicherten Entsorgens und Vernichtens von Informationsträgern. Außerdem befaßten sie sich mit der Entsorgung von Problem- und Sonderabfällen.
Mit der Wiedervereinigung ergriffen sie die Gelegenheit, sich ein Gebiet der Neuen Bundesländern über einen Vertrag mit der Treuhandanstalt als Betätigungsfeld anzueignen. Um größere Vorhaben finanzieren zu können, verfielen sie auf die Idee, aus der eigenen Aktiengesellschaft eine AG an der Börse unterzubringen. Hierbei halfen ihnen verschiedene Banken, so insbesondere die Sachsen-Landesbank in Leipzig. Dort kamen sie als eines der ersten börsennotierten Unternehmens gut an, der gewaltig angestiegene Börsenwert gestattete, weitere Vorhaben zu starten und neue Firmen zuzukaufen - mit Gewinn. Die Banken begnügten sich mit einer einfachen Überprüfung, die Wirtschaftsprüfer halfen ihnen dabei durch testierte Bilanzen. Schließlich ließ sich sogar eine Kapitalbeteiligungsgesellschaft blenden, auch deshalb, weil sich die Geldgeber insgesamt eine hohe Rendite von einem Unternehmen der Wachstumsbranche versprachen.
Von Bedeutung ist, dass die Firma weitgehend auf organisatorischen Improvisationen aufgebaut war und mehrheitlich von den Gebrüdern Löbbert dirigiert wurden. Der Aufsichtsrat übte seine kritischen Überwachungspflichten nur mässig aus. Dadurch war es möglich, über manipulierte Geschäfte die Bilanzen der beiden Aktiengesellschaft SERO und LÖSCH zu schönen. Gegen Mitte der neunziger Jahre wurde die Steuerbehörde stutzig, aber sie sah sich nicht in der Lage, die Vielzahl der aufgelaufenen Rechnungs-Unterlagen akribisch zu sichten und zu bewerten. Sie setzte daher im Laufe eines Jahres die Staatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität in Kenntnis, die wiederum zwei Hausdurchsuchungen durchführte. Erst jetzt tauchte ein konkreterer Verdacht auf Bilanzfälschungen u.a. auf. Die leitenden Mitarbeiter kamen in Untersuchungshaft, die Buchhalter wurden verhört. Nach mehreren Jahren konnte dann Anklage erhoben und vor dem Landgericht Münster ein mehrjähriger Prozess absolviert werden.
Das besondere an dieser Unternehmensgeschichte ist die Verwertung zahlreicher Akten und Gerichtsprotokolle aus den Zeugenvernehmungen. Das Unternehmen wurde gewinnbringend von Finanzhaien verwertet, mit Zustimmung des Generalbevollmächtigten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: der Zusammenhang familiärer Chronik mit der Darstellung
- 1.1 Allgemeines zu Nutzungsrecht und Eigentum
- 1.2 Der Eigentumsübergang bei Erbschaft
- 1.3 Ein spezieller Erbfall (= familiäre Chronik)
- 2. Die Enteignung von Vermögen in Weißenfels (Teumner)
- 2.1 Die regionale Geschichte vom Weißenfelser Land
- 2.2 Gewerbe in Weißenfels
- 2.3 Die Weißenfelser
- 2.4 Weißenfels als Opfer des Krieges
- 2.5 Die Situation in der sowjetisch besetzten SZone und der DDR
- 2.6 Die Eignungen als Voraussetzung von Planwirtschaft
- 2.7 Die Wiedervereinigung beider deutscher Teilstaaten, die THA
- 2.8 Der Niedergang des Weißenfelser Gewerbes
- 3. Die Geschichte der Enteignung Teumner in Weißenfels
- 4. Der Gang nach der Verurteilung
- 5. Das Wohngebäude Naumburger Straße 20
- 6. Des Gebäude Große Kalandstraße 31, Weißenfels
- 7. Das landwirtschaftliche Grundstück in Gröben (Runthal)
- 8. Andere Erbanwartschaften und ihr Ende
- 9. Der Rückgängigmachen der Enteignung in der DDR
- 9.1 Allgemeines
- 9.2 Die Rehabilitation, der Wiederherstellversuch zu altem Rechtszustand
- 10. Der unvermeidliche Abriß Naumburger Straße 20
- 11. Das Verschwinden des (beweglichen) Privatvermögens
- 12. Die Unternehmens-„Entschädigung“
- 13. Das faule Projekt Gröben (s. Nr. 7)
- 14. Die Erkenntnis
- 15. Das Nachwort; Ermittlungen, das Persönliche
- 16. Die Quintessenz
- 17. Andere Aktivitäten in der DDR nach der „Wende“
- 18. Die Löbbert-Geschichte, der Löbbert-Prozeß
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Enteignung einer Spedition in Weißenfels im Jahr 1953 im Kontext der DDR-Geschichte zu analysieren und die anschließenden Versuche der Restitution und Rehabilitation zu dokumentieren. Sie dient als Fallstudie zur Erforschung der Auswirkungen der Planwirtschaft und der politischen Repression auf Privatunternehmen und deren Eigentümer.
- Enteignung von Privatvermögen in der DDR
- Die Rechtslage und -praxis in der DDR bezüglich Eigentum und Enteignung
- Der Prozess der Restitution und Rehabilitation nach der Wende
- Die Herausforderungen der wirtschaftlichen Transformation in Ostdeutschland
- Die Rolle der Treuhandanstalt
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: der Zusammenhang familiärer Chronik mit der Darstellung: Diese Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit, der in der familiären Geschichte des Verfassers und der Enteignung seines Stiefmütterlichen Vermögens in der DDR begründet ist. Sie führt in die Thematik von Nutzungsrechten und Eigentum ein und legt den Grundstein für die folgenden Kapitel.
2. Die Enteignung von Vermögen in Weißenfels (Teumner): Dieses Kapitel bietet einen umfassenden historischen Überblick über Weißenfels, von seinen Anfängen bis zur DDR-Zeit. Es beleuchtet die Entwicklung des Gewerbes, insbesondere der Schuhindustrie, und beschreibt die wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen durch Krieg und Nachkriegszeit sowie die Auswirkungen der Sowjetisierung und Planwirtschaft. Das Kapitel skizziert die politischen und wirtschaftlichen Bedingungen, die zur Enteignung führten.
3. Die Geschichte der Enteignung Teumner in Weißenfels: Dieses Kapitel konzentriert sich auf den detaillierten Ablauf der Enteignung der Spedition Teumner. Es beschreibt die politischen Maßnahmen der DDR-Regierung, die zur Enteignung führten, inklusive der Rolle der Volkspolizei und der juristischen Prozesse gegen die Eigentümerin. Der Kapitel analysiert die Methoden der Enteignung und ihre Auswirkungen auf das Privatvermögen der Familie.
4. Der Gang nach der Verurteilung: Dieses Kapitel schildert die Folgen der Verurteilung der Eigentümerin, einschließlich ihrer Inhaftierung und die anschließende Einziehung und Verwertung ihres privaten und betrieblichen Vermögens. Es beschreibt den Verlust der Immobilie und das Verschwinden beweglicher Güter und dokumentiert die Versuche der Eigentümerin, das Unrecht rückgängig zu machen.
5. Das Wohngebäude Naumburger Straße 20: Dieses Kapitel konzentriert sich auf das Wohngebäude der Familie Teumner und seine fortschreitende Vernachlässigung unter DDR-Regime. Es beschreibt den baulichen Verfall und die Unwirtschaftlichkeit einer Sanierung, was letztendlich zum Abriß des Gebäudes führte.
6. Des Gebäude Große Kalandstraße 31, Weißenfels: Hier wird ein weiteres Gebäude der Familie beschrieben, das ebenfalls enteignet wurde. Das Kapitel schildert den Verkauf des Gebäudes an neue Eigentümer nach der Wende und die damit verbundenen rechtlichen Auseinandersetzungen.
7. Das landwirtschaftliche Grundstück in Gröben (Runthal): Dieses Kapitel behandelt das landwirtschaftliche Grundstück der Familie in Gröben und die Schwierigkeiten bei der Rückgabe nach der Wende. Es beleuchtet die rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte des Verkaufs des Grundstückes an die Gemeinde und die anschließenden Rechtsstreitigkeiten.
8. Andere Erbanwartschaften: Dieses Kapitel setzt die Thematik der Erbfolge und der damit verbundenen Schwierigkeiten fort, die die Familie Rabich in verschiedenen Kontexten erlebt hat. Es veranschaulicht weitere Fälle von Enteignung und ungerechter Vermögensverteilung.
9. Der Rückgängigmachen der Enteignungen in der DDR: Dieses Kapitel beschreibt den allgemeinen Rahmen der Restitution und Rehabilitation in der DDR nach der Wende. Es erläutert die rechtlichen Grundlagen und die Herausforderungen bei der Rückgabe von enteignetem Eigentum. Die Kapitel analysiert die Rolle der Treuhandanstalt.
10. Der unvermeidliche Abriß Naumburger Straße 20: Das Kapitel dokumentiert den Prozess, der zum Abriß des Wohngebäudes führte, einschließlich der Auseinandersetzungen mit den Denkmalbehörden und der wirtschaftlichen Unmöglichkeit einer Sanierung.
11. Das Verschwinden des (beweglichen) Privatvermögens: Detaillierte Darstellung des Verlusts des beweglichen Privatvermögens der Familie, einschließlich der Schwierigkeiten bei der Rekonstruktion des Verbleibs und der Wertermittlung der beschlagnahmten Gegenstände.
12. Die Unternehmens-„Entschädigung“: Dieses Kapitel analysiert den Prozess der Entschädigung für den Verlust des Unternehmens und beschreibt die Schwierigkeiten bei der Wertermittlung und die letztendliche Entschädigungssumme, die als unzureichend empfunden wird.
13. Das faule Projekt Gröben: Dieses Kapitel beschreibt die Versuche, das landwirtschaftliche Grundstück in Gröben zu verkaufen und die damit verbundenen rechtlichen und wirtschaftlichen Probleme.
14. Die Erkenntnis: Eine zusammenfassende Betrachtung der gesamten Ereignisse und die Schlussfolgerungen des Verfassers bezüglich der Restitution, der wirtschaftlichen Transformation in Ostdeutschland und der Rolle des Staates.
15. Das Nachwort; Ermittlungen, das Persönliche: Dieses Kapitel bietet einen Einblick in den Rechercheprozess des Verfassers und seine persönlichen Erlebnisse und Erinnerungen im Zusammenhang mit der Enteignung und den anschließenden Bemühungen um Restitution und Rehabilitation.
16. Die Quintessenz: Zusammenfassende Schlussfolgerungen des Verfassers zu den Ereignissen und deren Bedeutung.
17. Andere Aktivitäten in der DDR nach der „Wende“: Der Verfasser beschreibt sein Engagement in der DDR nach der Wende im Bereich der Abfallentsorgung und des Recyclings, unter anderem in Zusammenarbeit mit den Gebrüdern Löbbert.
18. Die Löbbert-Geschichte, der Löbbert-Prozeß: Dieses Kapitel schildert die Geschichte des Unternehmens der Gebrüder Löbbert und den darauf folgenden Wirtschaftskriminalitätsprozess.
Schlüsselwörter
Enteignung, DDR, Restitution, Rehabilitation, Planwirtschaft, Treuhandanstalt, Privatisierung, Volkseigentum, Wiedervereinigung, Wirtschaftskriminalität, Schuhindustrie, Spedition, Weißenfels, Rechtsbruch, Vermögensgesetz, Entschädigungsgesetz.
Häufig gestellte Fragen zur Familienchronik und Enteignung in Weißenfels
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Enteignung einer Spedition in Weißenfels im Jahr 1953 während der DDR-Zeit und die darauf folgenden Versuche der Restitution und Rehabilitation. Sie dient als Fallstudie zur Erforschung der Auswirkungen der Planwirtschaft und der politischen Repression auf Privatunternehmen und deren Eigentümer.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Enteignung von Privatvermögen in der DDR, die Rechtslage und -praxis bezüglich Eigentum und Enteignung, den Prozess der Restitution und Rehabilitation nach der Wende, die Herausforderungen der wirtschaftlichen Transformation in Ostdeutschland und die Rolle der Treuhandanstalt. Sie beleuchtet auch die regionale Geschichte von Weißenfels, die Entwicklung des Gewerbes und die Auswirkungen von Krieg und Nachkriegszeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit ist in 18 Kapitel gegliedert. Kapitel 1 ist eine Einleitung, die den Kontext der Arbeit beschreibt. Kapitel 2 bis 7 konzentrieren sich auf die Enteignung und die betroffenen Immobilien und Grundstücke. Kapitel 8 beleuchtet weitere Erbanwartschaften. Kapitel 9 behandelt den Rückgängigmachungsprozess der Enteignungen in der DDR nach der Wende. Die Kapitel 10 bis 13 befassen sich mit den Folgen der Enteignung, der Entschädigung und den damit verbundenen Schwierigkeiten. Kapitel 14 fasst die Erkenntnisse zusammen, während Kapitel 15 ein persönliches Nachwort des Verfassers enthält. Kapitel 16 gibt die Quintessenz der Arbeit wieder. Kapitel 17 und 18 behandeln weitere Aktivitäten des Verfassers in der DDR nach der Wende und die Geschichte der Gebrüder Löbbert.
Welche Rolle spielt die Familiengeschichte des Autors?
Die Familiengeschichte des Autors, insbesondere die Enteignung des Vermögens seiner Stiefmutter, bildet den Ausgangspunkt und den persönlichen Kontext der Arbeit. Die Arbeit ist somit auch eine familiäre Chronik.
Welche konkreten Beispiele von enteignetem Eigentum werden genannt?
Es werden mehrere Beispiele genannt, darunter ein Wohngebäude in der Naumburger Straße 20, ein Gebäude in der Großen Kalandstraße 31, ein landwirtschaftliches Grundstück in Gröben (Runthal) und das bewegliche Privatvermögen der Familie.
Welche Rolle spielt die Treuhandanstalt?
Die Rolle der Treuhandanstalt im Prozess der Restitution und Rehabilitation nach der Wende wird analysiert und in den Kontext der wirtschaftlichen Transformation in Ostdeutschland eingeordnet.
Welche Schlussfolgerungen zieht der Autor?
Der Autor zieht Schlussfolgerungen bezüglich der Restitution, der wirtschaftlichen Transformation in Ostdeutschland und der Rolle des Staates bei der Enteignung und den darauffolgenden Ereignissen. Die Quintessenz der Arbeit wird in einem eigenen Kapitel zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Enteignung, DDR, Restitution, Rehabilitation, Planwirtschaft, Treuhandanstalt, Privatisierung, Volkseigentum, Wiedervereinigung, Wirtschaftskriminalität, Schuhindustrie, Spedition, Weißenfels, Rechtsbruch, Vermögensgesetz, Entschädigungsgesetz.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Historiker, Juristen, Wirtschaftswissenschaftler und alle, die sich für die Geschichte der DDR, die Enteignung von Privatvermögen, die Restitution und die wirtschaftliche Transformation in Ostdeutschland interessieren.
- Quote paper
- Dr.-Ing. Adalbert Rabich (Author), 2006, Enteignung in der DDR. Fallbeispiel einer Spedition in Weißenfels 1953, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/52914