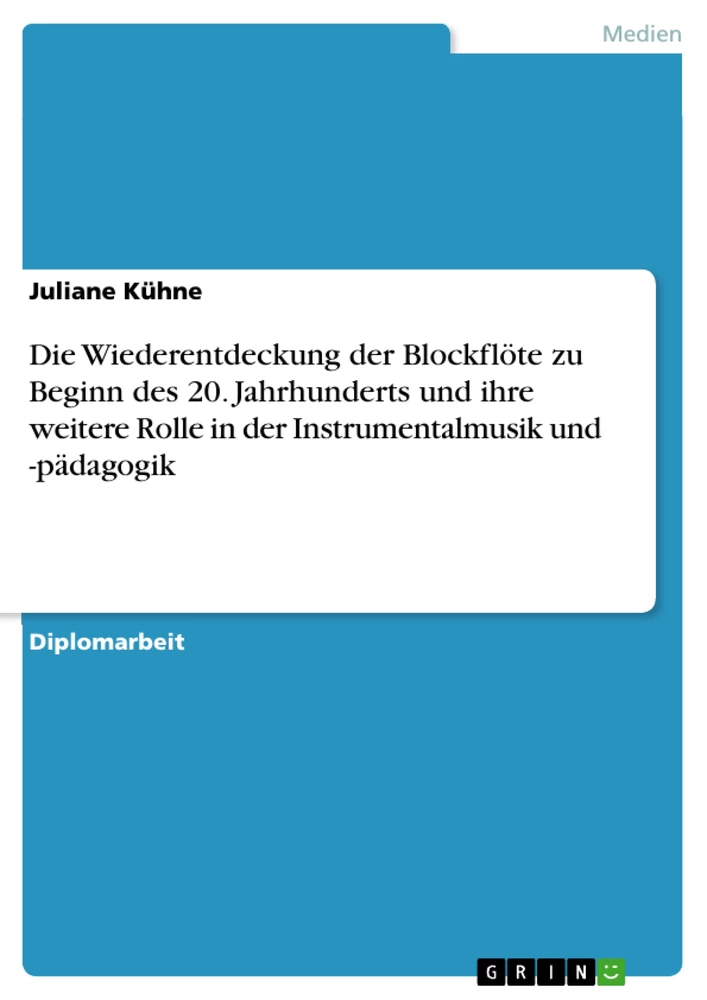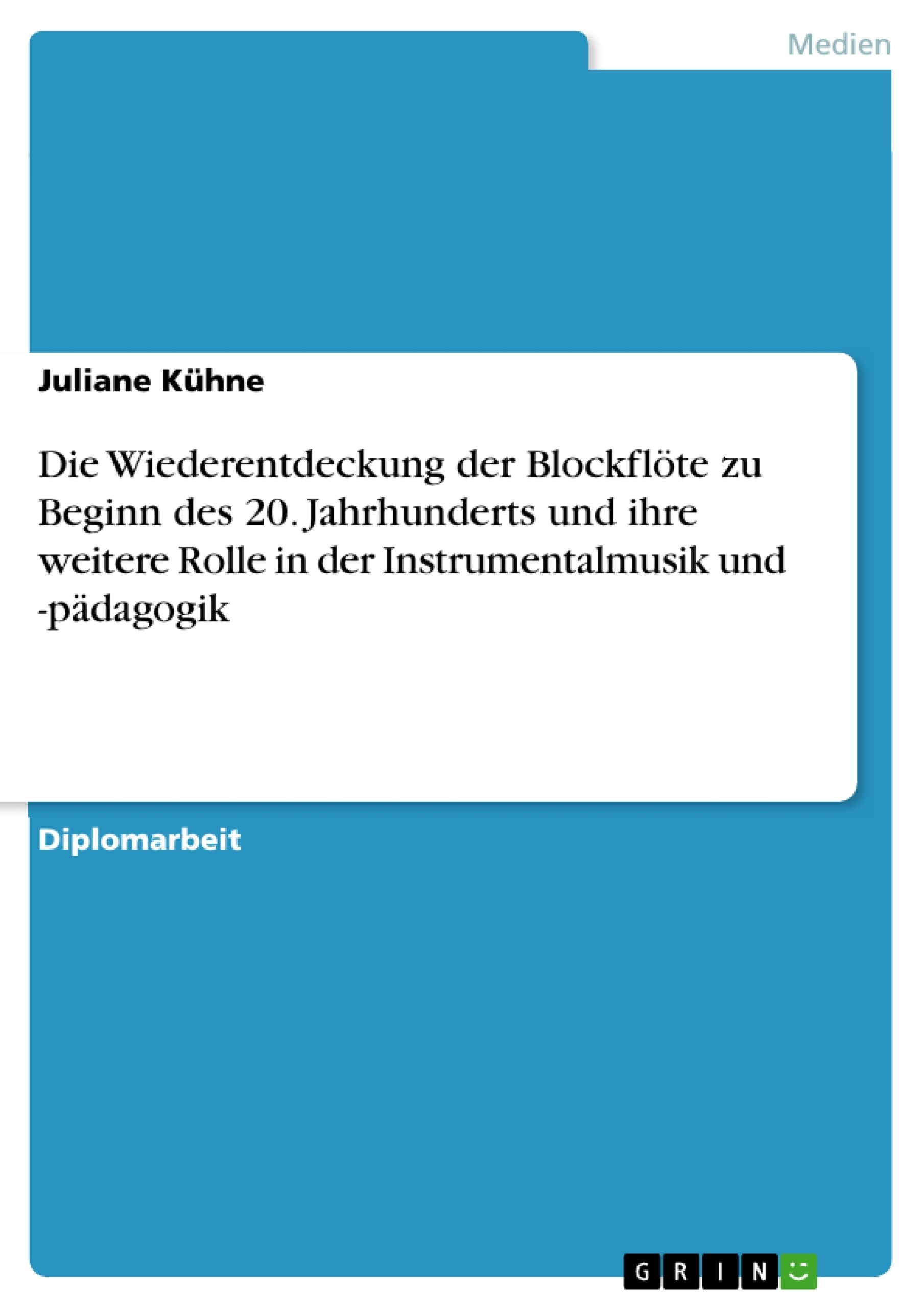Als Blockflötenspielerin komme ich immer wieder in Situationen, in denen ich - nach Beruf oder Studium befragt - gespannt auf die Reaktion warte, die meine Antwort auslöst: „Ich studiere Musik. Blockflöte.“ - Die Entgegnung darauf ist mit hoher Wahrscheinlichkeit: „Blockflöte?! Das habe ich früher auch mal gespielt ...“ Genauso kann meiner erwartungsvollen Antwort aber auch ein ungläubiges Staunen folgen (nicht selten auch von Musik Studierenden), dass man dieses Instrument tatsächlich an einer Musikhochschule studieren kann: „Gibt es denn überhaupt Literatur dafür?“ In meiner Arbeit möchte ich der Frage nachgehen, wie die Blockflöte zu solch einem „Massen-Instrument“ werden konnte, welches so viele Menschen, vor allem in Deutschland, „früher auch mal gespielt“ haben. Was ist die Blockflöte für ein Instrument? Hans Maria Kneihs formulierte diese Frage in seinem Artikel zur „Blockflöte“ im Handbuch der Musikpädagogik sehr treffend:
„Vor 200 Jahren, wie es schien, ausgestorben, in diesem Jahrhundert wiederentdeckt: ein historisches Instrument? Ein Kinderspielzeug? Nazipfeiferl? Vorstufe vor dem Erlernen eines „richtigen“ Instruments? [...] Bei kaum einem anderen Instrument klaffen Bekanntheitsgrad und Beurteilung so sehr auseinander wie bei der Blockflöte. [...] massenweise verbreitet, gespielt und unzulänglich unterrichtet ist die Blockflöte bekannt -und nicht selten auch wohl verabscheut. Die Blockflöte als Instrument der Musikerziehung (und nicht der Musikwiedergabe)“.
Ich möchte im Folgenden versuchen, einige Ursachen dieser Vorurteile, die der Blockflöte entgegengebracht werden, historisch zu klären - auch um bei mir selbst (und vielleicht bei anderen BlockflötenspielerInnen) ein besseres Verständnis der langen und wechselvollen Geschichte dieses Instruments - und hier hauptsächlich bezogen auf das 20. Jahrhundert - zu schaffen. Denn wie lange wurde „der wirkliche Klangreichtum und die Ausdrucksvielfalt eines Instruments mit jahrhundertelanger Geschichte verdeckt [...] durch Mißverständnisse, ideologische Vereinnahmungen, schlichte Zufälle“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Blockflötentypen in der Zeit zwischen 1750 – 1900
- Die Blockflöte
- Nebentypen der Blockflöte: Das französische und das englische Flageolett
- Csakan und Czakan
- Die Renaissance der Blockflöte seit Ende des 19. Jahrhunderts
- Die Anfänge
- Die Entwicklung in England: Arnold Dolmetsch
- Die Entwicklung in Deutschland: Collegia musica
- Voraussetzungen für die Entwicklung der Blockflöte zum industriellen Masseninstrument
- Instrumentenbau
- England
- Deutschland
- Ein Blockflötenbauer in Deutschland: Peter Harlan
- Blockflötenbauer, Firmen und Verlage
- Historische und moderne Griffweisen
- Verschiedene Stimmungssysteme
- Instrumentenbau
- Exkurs: Die Jugendmusikbewegung und die Blockflöte
- Hausmusik kontra Konzertmusik
- Laienmusik kontra Berufsmusiker
- Musikanschauung der Jugendmusikbewegung
- Instrumente der Jugendmusikbewegung
- Jugendmusikbewegung und Faschismus
- Die Blockflöte in der Instrumentalpädagogik
- Die Blockflöte als „organisches“ Volks- und Hausmusikinstrument
- Das organische Klangideal
- Die „ideale“ Flötenform
- Kindergarten und Schule
- Die Blockflöte im Kindergarten
- Die Blockflöte in der Schule
- Die Blockflöte ein „multifunktionales Erziehungsmittel“
- Die Blockflöte als Selbstbauinstrument
- Gender-Aspekte der Blockflöte
- Musikschulen und Privatunterricht
- Blockflötenunterricht an Musikschulen
- Privater Blockflötenunterricht
- Musizierkreise, Singwochen und Instrumentalkurse
- Hitlerjugend und Bund Deutscher Mädel
- Die Blockflöte als „organisches“ Volks- und Hausmusikinstrument
- (Neue) Musik für die Blockflöte in den 30er und 40er Jahren
- Neue Kompositionen aus England
- Das Blockflötenrepertoire in Deutschland
- Der improvisatorische Ansatz von Carl Orff und Gunhild Keetmann
- Carl Orff und das „elementare Prinzip“
- Kompositionen für Blockflöte von Gunhild Keetmann
- „Spielmusik“
- Anspruch und „Neue Sachlichkeit“
- Ein Komponist: Helmut Bornefeld
- Der improvisatorische Ansatz von Carl Orff und Gunhild Keetmann
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Blockflöte im 20. Jahrhundert, insbesondere ihren Aufstieg zum Masseninstrument in Deutschland. Sie beleuchtet die Faktoren, die zu ihrer Wiederentdeckung, Verbreitung und Verwendung in der Instrumentalpädagogik beigetragen haben.
- Die Wiederentdeckung der Blockflöte zu Beginn des 20. Jahrhunderts
- Die Rolle der Jugendmusikbewegung in der Popularisierung der Blockflöte
- Die Entwicklung des Blockflötenbaus und der industriellen Massenproduktion
- Der Einfluss der Jugendmusikbewegung auf die Instrumentalpädagogik
- Die Entstehung neuer Kompositionen für Blockflöte im 20. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht die kontroversen Wahrnehmungen der Blockflöte und beleuchtet ihre Entwicklung im 20. Jahrhundert, insbesondere ihren Weg zum Masseninstrument und die damit verbundenen Vorurteile. Sie zitiert diverse Musiktheoretiker und Komponisten, um die unterschiedlichen Perspektiven auf das Instrument zu verdeutlichen.
1. Blockflötentypen in der Zeit zwischen 1750-1900: Dieses Kapitel beschreibt den Niedergang der Blockflöte im 18. Jahrhundert aufgrund der Konkurrenz durch die Traversflöte und die Veränderungen im musikalischen Geschmack. Es beleuchtet verschiedene Blockflötentypen wie das französische und englische Flageolett sowie den Csakan, die trotz des Rückgangs der traditionellen Blockflöte weiterhin populär waren, vor allem im Bereich der Hausmusik.
2. Die Renaissance der Blockflöte seit Ende des 19. Jahrhunderts: Dieses Kapitel beschreibt die Wiederbelebung der Blockflöte, beginnend mit dem wachsenden Interesse an alter Musik und den Bemühungen von Musikwissenschaftlern und Musikern wie Arnold Dolmetsch in England und den Collegia musica in Deutschland. Es hebt die unterschiedlichen Ansätze in England und Deutschland hervor, wobei Dolmetsch den Instrumentenbau stark beeinflusste, während die deutschen Collegia musica eher auf die Aufführungspraxis fokussierten.
3. Voraussetzungen für die Entwicklung der Blockflöte zum industriellen Masseninstrument: Dieses Kapitel analysiert die technischen und wirtschaftlichen Faktoren, die zur Massenproduktion von Blockflöten führten. Es diskutiert die Herausforderungen des exakten Nachbaus historischer Instrumente, die Entwicklung in England und Deutschland, die Rolle von Peter Harlan als wichtiger Impulsgeber, verschiedene Griffweisen und Stimmungssysteme und den Einfluss der Industrialisierung auf die Klangqualität.
Exkurs: Die Jugendmusikbewegung und die Blockflöte: Dieser Exkurs untersucht den starken Einfluss der Jugendmusikbewegung auf die Verbreitung der Blockflöte. Er beschreibt die Ideologie der Bewegung, ihre Ablehnung von Konzertmusik und Berufsmusikern, ihre Ansichten zur Musikästhetik und die Auswahl von Instrumenten, die den Idealen der Gemeinschaft und des „organischen“ Klangs entsprachen. Der Exkurs analysiert auch die problematische Nähe der Jugendmusikbewegung zum Nationalsozialismus.
4. Die Blockflöte in der Instrumentalpädagogik: Dieses Kapitel behandelt die Rolle der Blockflöte in der Instrumentalpädagogik, insbesondere im Kindergarten und in der Schule. Es beschreibt die musikpädagogischen Ansätze der Zeit, die Verwendung der Blockflöte als „multifunktionales Erziehungsmittel“, den Selbstbau von Instrumenten, Gender-Aspekte und den Einfluss der Jugendmusikbewegung. Es beleuchtet auch die oft unzureichende Ausbildung der Lehrkräfte und die Folgen für die Qualität des Blockflötenunterrichts.
5. (Neue) Musik für die Blockflöte in den 30er und 40er Jahren: Dieses Kapitel diskutiert die Entwicklung des Repertoires für die Blockflöte in England und Deutschland während der 30er und 40er Jahre. Es analysiert die Einflüsse von Neoklassizismus und „Neuer Sachlichkeit“, den improvisatorischen Ansatz von Carl Orff und Gunhild Keetmann und die Herausforderungen, die sich aus den unterschiedlichen Stimmungen und Bauweisen der Blockflöten ergaben. Es beleuchtet auch die Kompositionen von Komponisten wie Helmut Bornefeld.
Schlüsselwörter
Blockflöte, Instrumentalpädagogik, Jugendmusikbewegung, Nationalsozialismus, Instrumentenbau, Massenproduktion, Alte Musik, Neue Musik, Spielmusik, Neue Sachlichkeit, Griffweisen, Stimmungssysteme, Gemeinschaft, Volksinstrument, Gunhild Keetmann, Carl Orff, Arnold Dolmetsch, Peter Harlan.
FAQ: Entwicklung der Blockflöte im 20. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Blockflöte im 20. Jahrhundert, insbesondere ihren Aufstieg zum Masseninstrument in Deutschland. Sie beleuchtet die Faktoren, die zu ihrer Wiederentdeckung, Verbreitung und Verwendung in der Instrumentalpädagogik beigetragen haben, und analysiert die damit verbundenen gesellschaftlichen und politischen Kontexte.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Wiederentdeckung der Blockflöte zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die Rolle der Jugendmusikbewegung in ihrer Popularisierung, die Entwicklung des Blockflötenbaus und der industriellen Massenproduktion, den Einfluss der Jugendmusikbewegung auf die Instrumentalpädagogik, und die Entstehung neuer Kompositionen für Blockflöte im 20. Jahrhundert. Zusätzlich werden verschiedene Blockflötentypen, Griffweisen, Stimmungssysteme und der Einfluss von wichtigen Persönlichkeiten wie Arnold Dolmetsch und Peter Harlan behandelt.
Welche Zeitspanne wird betrachtet?
Der Fokus liegt auf dem 20. Jahrhundert, mit einem Rückblick auf die Entwicklung der Blockflöte bis ins 18. Jahrhundert und einem Ausblick auf die Kompositionslandschaft der 1930er und 1940er Jahre.
Welche Rolle spielte die Jugendmusikbewegung?
Die Jugendmusikbewegung spielte eine entscheidende Rolle bei der Popularisierung der Blockflöte. Ihre Ideologie, die Betonung von Gemeinschaftssinn und „organischem“ Klang, und die Auswahl einfacher Instrumente begünstigte die Verbreitung der Blockflöte, insbesondere im pädagogischen Bereich. Die Arbeit analysiert jedoch auch die problematische Nähe der Jugendmusikbewegung zum Nationalsozialismus.
Wie wird die Entwicklung des Blockflötenbaus dargestellt?
Die Arbeit untersucht die technischen und wirtschaftlichen Faktoren, die zur Massenproduktion von Blockflöten führten. Sie diskutiert die Herausforderungen des exakten Nachbaus historischer Instrumente, die Entwicklung in England und Deutschland, und die Rolle von wichtigen Blockflötenbauern wie Peter Harlan. Der Einfluss der Industrialisierung auf die Klangqualität wird ebenfalls thematisiert.
Welche Rolle spielte die Blockflöte in der Instrumentalpädagogik?
Die Arbeit beschreibt die Rolle der Blockflöte in der Instrumentalpädagogik, insbesondere im Kindergarten und in der Schule. Sie beleuchtet die musikpädagogischen Ansätze der Zeit, die Verwendung der Blockflöte als „multifunktionales Erziehungsmittel“, den Selbstbau von Instrumenten, Gender-Aspekte, und den Einfluss der Jugendmusikbewegung. Die oft unzureichende Ausbildung der Lehrkräfte und die Folgen für die Qualität des Blockflötenunterrichts werden ebenfalls thematisiert.
Welche Komponisten und ihre Werke werden erwähnt?
Die Arbeit erwähnt unter anderem Carl Orff und Gunhild Keetmann mit ihrem improvisatorischen Ansatz, und Helmut Bornefeld als Vertreter der „Neuen Sachlichkeit“. Der Einfluss dieser Komponisten auf das Blockflötenrepertoire der 1930er und 1940er Jahre wird analysiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind wichtig?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Blockflöte, Instrumentalpädagogik, Jugendmusikbewegung, Nationalsozialismus, Instrumentenbau, Massenproduktion, Alte Musik, Neue Musik, Spielmusik, Neue Sachlichkeit, Griffweisen, Stimmungssysteme, Gemeinschaft, Volksinstrument, Gunhild Keetmann, Carl Orff, Arnold Dolmetsch, und Peter Harlan.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit zitiert diverse Musiktheoretiker und Komponisten, um die unterschiedlichen Perspektiven auf das Instrument zu verdeutlichen (genaue Quellenangaben sind im Volltext enthalten).
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel Einleitung, Blockflötentypen 1750-1900, Renaissance der Blockflöte, Voraussetzungen für Massenproduktion, Exkurs: Jugendmusikbewegung, Blockflöte in der Instrumentalpädagogik, und (Neue) Musik für die Blockflöte in den 30er und 40er Jahren.
- Quote paper
- Juliane Kühne (Author), 2002, Die Wiederentdeckung der Blockflöte zu Beginn des 20. Jahrhunderts und ihre weitere Rolle in der Instrumentalmusik und -pädagogik, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/52904