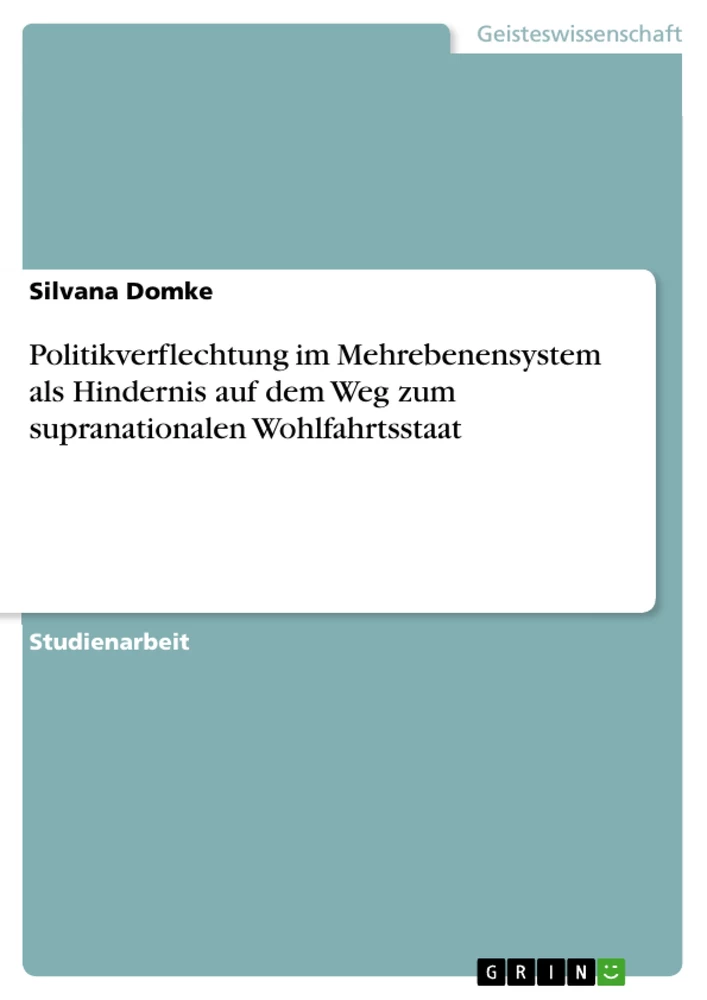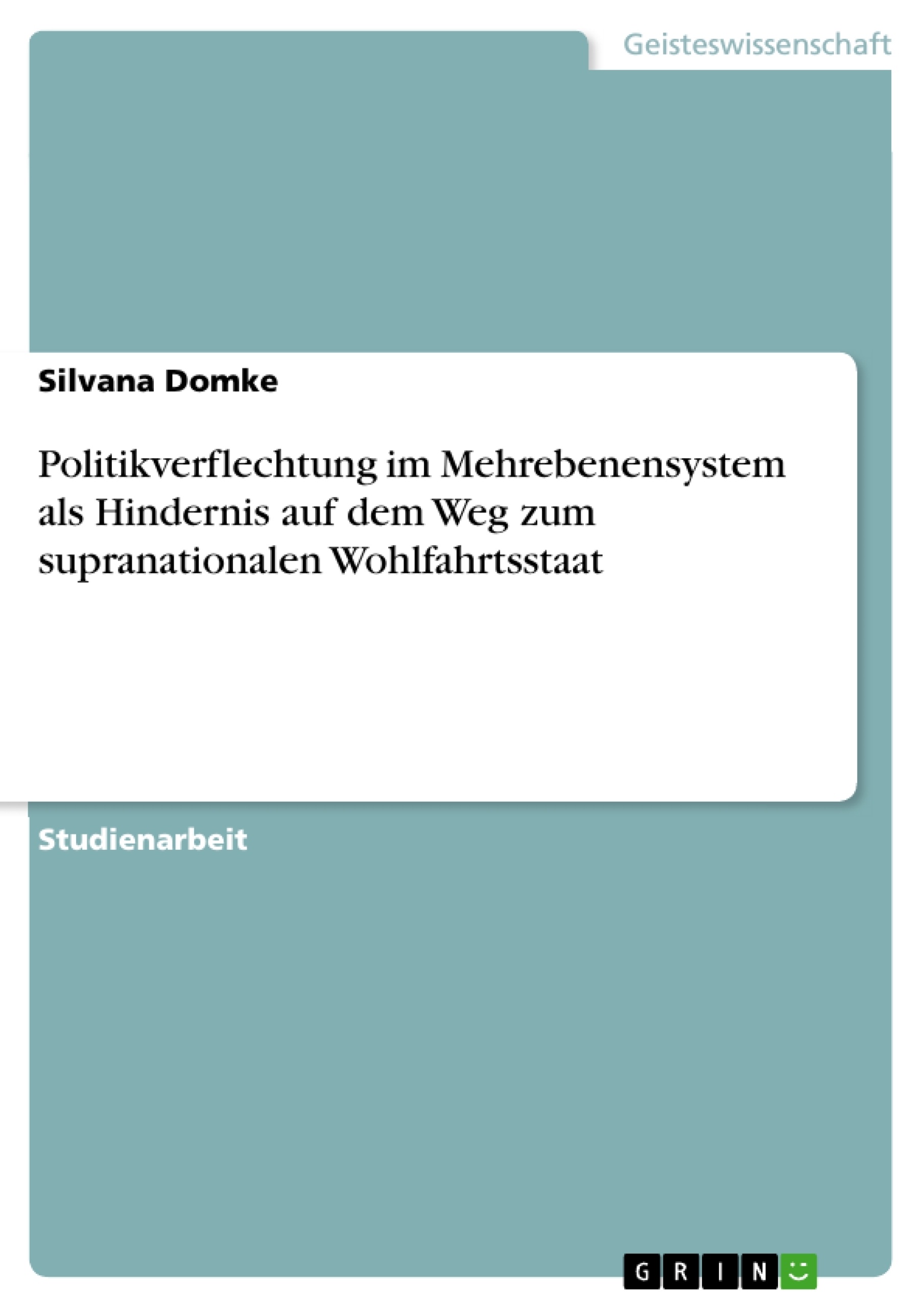„Die bisherige Vorstellung eines europäischen Bundesstaates, der als neuer Souverän die alten Nationalstaaten und ihre Demokratien ablöst, erweist sich als ein synthetisches Konstrukt jenseits der gewachsenen europäischen Realitäten.“(Joschka Fischer).
Mit dieser Einschätzung der Zukunft des europäischen Integrationsprojektes, wies der ehemalige deutsche Außenminister jede Form von Supranationalität als Endziel der Gemeinschaft zurück. Für ihn ist Europa nur denkbar in Verbindung mit starken und souveränen Nationalstaaten denen im Zuge von Kompetenzzuteilungen der Vorrang gegeben wird.
In der modernen politikwissenschaftlichen Integrationsforschung ist es gängige Praxis, die EU als ein politisches System „ sui generis“ zu bezeichnen. Ein frühes Modell innerhalb der Mehrebenentheorie stellt die Politikverflechtung dar, die Interaktionen dezentraler und zentraler Entscheidungseinheiten sowie die daraus resultierenden Problematiken in den Fokus der Forschung rückt.
In dieser Ausarbeitung werde ich zeigen, weshalb die unzureichende Fähigkeit sozialpolitische Probleme auf supranationaler Ebene adäquat zu lösen, der Entstehung eines supranationalen Wohlfahrtsstaates entgegenstehen.
Dabei wird zu klären sein, warum die Politikverflechtung Probleme erzeugt, wie sich diese auf europäischer Ebene auswirken und weshalb eine adäquate Lösung nicht gewährleistet ist. Außerdem ist nach der Rolle der dezentralen Akteure in diesem Prozess zu fragen und weshalb ihre divergierenden Interessen die Entwicklung des supranationalen Wohlfahrtsstaates verhindern.
Dazu erläutere ich zunächst die zentralen Begriffe Politikverflechtung und Sozialpolitik. Anschließend gehe ich auf die aus der Politikverflechtung resultierenden Problemverarbeitungskapazitäten auf supranationaler Ebene ein und skizziere, weshalb positive und negative Integration, Produkt- und Prozessregulierung sowie die sozialregulative Politik der Gemeinschaft unüberwindbare Hindernisse für die Entwicklung eines supranationalen Wohlfahrtsstaates darstellen. Dass die divergierenden Interessen der im Mehrebenensystem miteinander verflochtenen Nationalstaaten und Klassen weitere schwierige Hürden sind, wird im folgenden Schritt untersucht. Neben unterschiedlichen Interessen stehen hier auch diverse Konflikte im Mittelpunkt die einen Konsens unmöglich erscheinen lassen. Abschließend erörtere ich einige Kritikpunkte an Scharpf´s Theorieansatz, die eine neofunktionalistische Argumentationsweise verfolgen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Definition und Merkmale einer Politikverflechtung sowie deren Übertragung auf die europäische Ebene
- C. Definition und Merkmale von Sozialpolitik
- D. Begrenzte Problemlösungskapazitäten
- D.1. Problemformen
- D.2. Negative und positive Integration
- D.3. Produkt- und Prozessregulierung
- D.4. Regulative und redistributive Politik
- E. Divergierende Interessen der Nationalstaaten und der Klassen
- E.1. Nicht verhandelbare Konflikte
- E.2. Das politische System europäischer Sozialpolitik
- F. Kritik
- G. Schlussfolgerung
- H. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, warum die Europäische Union Schwierigkeiten hat, sozialpolitische Probleme auf supranationaler Ebene effektiv zu lösen, und welche Folgen dies für die Entwicklung eines supranationalen Wohlfahrtsstaates hat. Sie argumentiert, dass die unzureichende Problemlösungskapazität der EU in der Politikverflechtung begründet liegt, die zu einer Verzahnung nationaler und supranationaler Akteure mit divergierenden Interessen führt.
- Politikverflechtung in der Europäischen Union und ihre Auswirkungen
- Begrenzte Problemlösungskapazitäten der EU in Bezug auf Sozialpolitik
- Divergierende Interessen der Nationalstaaten und Klassen
- Die Rolle des Mehrebenenansatzes in der europäischen Integration
- Hindernisse für die Entwicklung eines supranationalen Wohlfahrtsstaates
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Politikverflechtung in der Europäischen Union ein und stellt die Forschungsfrage nach den Hindernissen für die Entwicklung eines supranationalen Wohlfahrtsstaates. Kapitel B definiert den Begriff der Politikverflechtung und überträgt ihn auf die europäische Ebene. Kapitel C beleuchtet die Merkmale und Definition von Sozialpolitik. Kapitel D analysiert die Problemformen, die aus der Politikverflechtung resultieren, und argumentiert, dass positive und negative Integration sowie die Produkt- und Prozessregulierung der EU zu unüberwindbaren Hindernissen für die Entwicklung eines supranationalen Wohlfahrtsstaates führen. Kapitel E untersucht die divergierenden Interessen der Nationalstaaten und Klassen, die durch die Politikverflechtung entstehen, und zeigt auf, dass diese weiteren Schwierigkeiten für die Entwicklung eines supranationalen Wohlfahrtsstaates darstellen. In Kapitel F werden Kritikpunkte an Scharpfs Theorieansatz erörtert, die eine neofunktionalistische Argumentationsweise verfolgen.
Schlüsselwörter
Politikverflechtung, Mehrebenenansatz, Europäische Union, supranationaler Wohlfahrtsstaat, Sozialpolitik, negative Integration, positive Integration, Produkt- und Prozessregulierung, divergierende Interessen, Nationalstaaten, Klassen, neofunktionalistische Argumentationsweise.
- Arbeit zitieren
- Silvana Domke (Autor:in), 2004, Politikverflechtung im Mehrebenensystem als Hindernis auf dem Weg zum supranationalen Wohlfahrtsstaat, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/52767