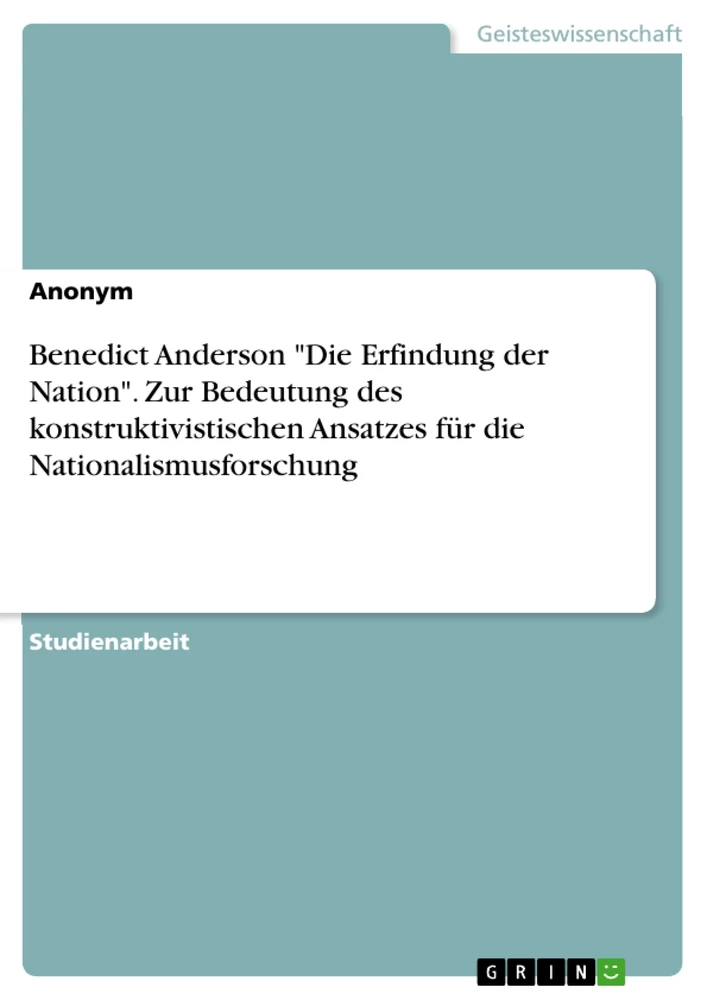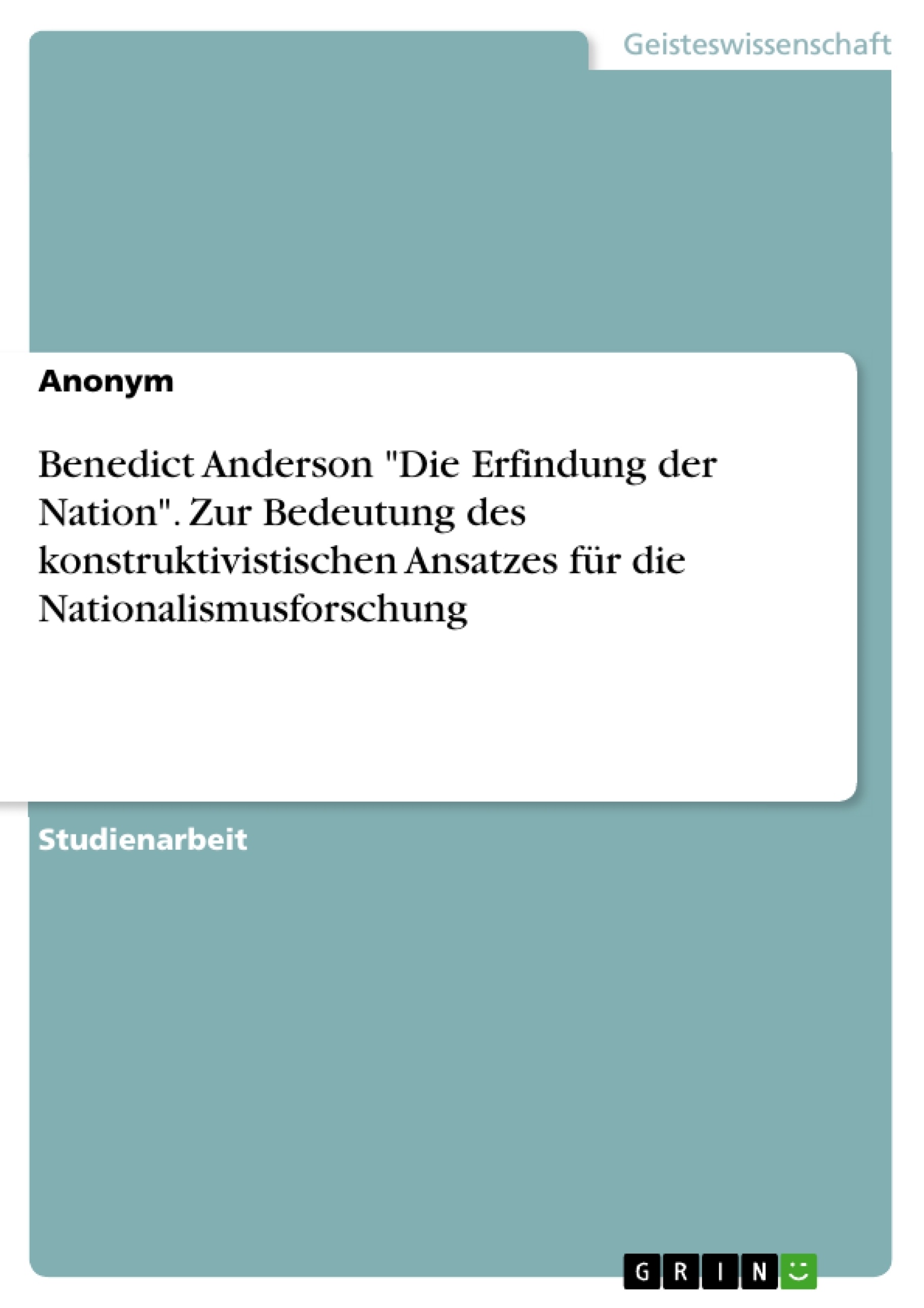Seit ihrer Entstehung Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Nationalismusforschung von historisch-politischen und sozialwissenschaftlichen Herangehensweisen dominiert.
Im Mittelpunkt des Forschungsinteresses stand dabei anfangs die Legitimation nationaler Bewegungen; später dann die Typologisierung (v.a. Schieder) verschiedener Ausprägungen des Nationsverständnisses. Weiteren Erkenntnisgewinn für die Nationalismusforschung der Nachkriegszeit lieferten der kommunikationstheoretische Ansatz des amerikanischen Politikwissenschaftlers Karl W. Deutsch und der sozialanthropologische Ansatz des englischen Historikers Ernest Gellner.
Einen neuen Impuls erhielt die Nationalismusforschung schließlich 1983, als der amerikanische Historiker/Politikwissenschaftler und Ostasienexperte Benedict Anderson mit seinem Buch Imagined Communities (dt.: Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts) die “konstruktivistische Wende“ einleitet.
Anderson geht davon aus, dass Nationen „kulturelle Produkte einer besonderen Art“ sind; quasi das Resultat einer prozessualen Wahrnehmungsveränderung kultureller Identität. Demnach sind es nicht die Nationen, d.h. bereits bestehende Gemeinschaften, die Staaten und Nationalismen hervorbringen, sondern umgekehrt: Nationalismen erfinden Nationen und wirken somit sinnstiftend auf deren Konstruktion.
Die folgende Arbeit soll dazu dienen die Kausalitäten B. Andersons Nationsverständnisses zu erläutern, um auf dieser Grundlage eine Aussage über den Erklärungsgehalt des konstruktivistischen Ansatzes innerhalb der Nationalismusforschung treffen zu können. Im Mittelpunkt des Forschungsinteresses steht die Kontextualisierung der Hauptaussagen dieses Ansatzes mit denen von Karl W. Deutsch. Dabei wird der Fokus auf die kulturellen Ursprünge des Nationalbewußtseins gerichtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Die konstruktivistische Wende in der Nationalismusforschung
- Benedict Andersons Begrifflichkeit und Definition von Nation
- Die drei begrifflichen Paradoxa in der Nationalismusforschung
- Andersons Definition von Nation
- Kulturelle Wurzeln
- Verlust religiöser Vormachtstellung
- Niedergang der Dynastien
- Veränderung der Wahrnehmung von Zeit
- Ursprünge des Nationalbewußtseins
- Die Karriere des kapitalistischen Buchdrucks
- Die Rolle der „weltlichen“ Schriftsprachen
- Erklärungsgehalt und Grenzen
- Vorteile des konstruktivistischen Ansatzes
- Erklärungsdefizite
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Benedict Andersons konstruktivistischen Ansatz in der Nationalismusforschung. Ziel ist es, die Kausalitäten seines Nationsverständnisses zu erläutern und den Erklärungsgehalt dieses Ansatzes im Vergleich zu anderen, insbesondere dem Ansatz von Karl W. Deutsch, zu bewerten. Der Fokus liegt auf den kulturellen Ursprüngen des Nationalbewusstseins.
- Andersons konstruktivistische Wende in der Nationalismusforschung
- Die begrifflichen Paradoxa des Nationalismus nach Anderson
- Andersons Definition von Nation als "vorgestellte politische Gemeinschaft"
- Kulturelle Wurzeln des Nationalbewusstseins
- Bewertung des Erklärungsgehalts des konstruktivistischen Ansatzes
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die konstruktivistische Wende in der Nationalismusforschung: Die Einleitung beschreibt die Entwicklung der Nationalismusforschung bis zur „konstruktivistischen Wende“, die durch Andersons Werk „Imagined Communities“ eingeleitet wurde. Anderson's Ansatz, Nationen als „kulturelle Produkte“ zu betrachten und die These, dass Nationalismen Nationen erfinden, wird als zentraler Punkt hervorgehoben. Die Arbeit erläutert die Zielsetzung, Andersons Ansatz zu analysieren und mit dem von Karl W. Deutsch zu vergleichen, wobei der Fokus auf den kulturellen Ursprüngen des Nationalbewusstseins liegt.
Benedict Andersons Begrifflichkeit und Definition von Nation: Dieses Kapitel analysiert Andersons Begrifflichkeiten. Es wird auf die drei von Anderson identifizierten Paradoxa der Nationalismusforschung eingegangen: die Diskrepanz zwischen der objektiven Neuheit von Nationen und ihrem subjektiv empfundenen Alter, die Spannung zwischen der Universalität und der Besonderheit nationaler Ausprägungen sowie die philosophische Armut des Nationalismus im Gegensatz zu seiner politischen Macht. Andersons Definition der Nation als „vorgestellte politische Gemeinschaft“ wird detailliert erläutert und kritisch hinterfragt, insbesondere im Vergleich zu Gellners Ansatz.
Kulturelle Wurzeln: Dieses Kapitel befasst sich mit den kulturellen Ursprüngen des Nationalbewusstseins. Es werden der Verlust religiöser Vormachtstellung, der Niedergang der Dynastien und die veränderte Wahrnehmung von Zeit als wichtige Faktoren behandelt. Die Zusammenhänge zwischen diesen Entwicklungen und der Entstehung des Nationalismus werden analysiert, um den Hintergrund von Andersons Theorie zu beleuchten.
Ursprünge des Nationalbewußtseins: Hier werden die Rolle des kapitalistischen Buchdrucks und die Bedeutung der „weltlichen“ Schriftsprachen für die Entstehung des Nationalbewusstseins untersucht. Anderson's Argumentation, wie diese Faktoren zur Schaffung einer „vorgestellten Gemeinschaft“ beitrugen, wird im Detail erläutert und analysiert.
Erklärungsgehalt und Grenzen: Dieses Kapitel bewertet den Erklärungsgehalt und die Grenzen des konstruktivistischen Ansatzes. Es werden die Vorteile und die Defizite dieses Ansatzes im Vergleich zu anderen Theorien erörtert und diskutiert, um ein umfassendes Bild der Stärken und Schwächen von Andersons Ansatz zu liefern.
Schlüsselwörter
Nationalismus, Nation, konstruktivistischer Ansatz, Benedict Anderson, Imagined Communities, Karl W. Deutsch, kulturelle Identität, Nationalbewusstsein, vorgestellte Gemeinschaft, Imaginierte Gemeinschaften, Buchdruck, Schriftsprache.
Häufig gestellte Fragen zu: Benedict Andersons konstruktivistischer Ansatz in der Nationalismusforschung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Benedict Andersons konstruktivistischen Ansatz in der Nationalismusforschung. Sie untersucht die Ursachen seines Nationsverständnisses und bewertet den Erklärungsgehalt im Vergleich zu anderen Ansätzen, insbesondere dem von Karl W. Deutsch. Der Fokus liegt auf den kulturellen Ursprüngen des Nationalbewusstseins.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Andersons konstruktivistische Wende in der Nationalismusforschung; die begrifflichen Paradoxa des Nationalismus nach Anderson; Andersons Definition von Nation als "vorgestellte politische Gemeinschaft"; die kulturellen Wurzeln des Nationalbewusstseins; und die Bewertung des Erklärungsgehalts des konstruktivistischen Ansatzes.
Welche zentralen Begriffe werden erklärt?
Zentrale Begriffe sind Nationalismus, Nation, konstruktivistischer Ansatz, Benedict Anderson, Imagined Communities, Karl W. Deutsch, kulturelle Identität, Nationalbewusstsein, vorgestellte Gemeinschaft, Buchdruck und Schriftsprache.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, die die konstruktivistische Wende in der Nationalismusforschung beschreibt; ein Kapitel zu Andersons Begrifflichkeit und Definition von Nation, inklusive der drei von ihm identifizierten Paradoxa; ein Kapitel zu den kulturellen Wurzeln des Nationalbewusstseins; ein Kapitel zu den Ursprüngen des Nationalbewusstseins mit Fokus auf Buchdruck und Schriftsprache; und abschließend ein Kapitel zur Bewertung des Erklärungsgehalts und der Grenzen des konstruktivistischen Ansatzes.
Welche sind die drei Paradoxa des Nationalismus nach Anderson?
Anderson identifiziert drei Paradoxa: die Diskrepanz zwischen der objektiven Neuheit von Nationen und ihrem subjektiv empfundenen Alter; die Spannung zwischen der Universalität und der Besonderheit nationaler Ausprägungen; und die philosophische Armut des Nationalismus im Gegensatz zu seiner politischen Macht.
Wie definiert Anderson Nation?
Anderson definiert Nation als "vorgestellte politische Gemeinschaft", eine Gemeinschaft, die zwar imaginär ist, aber dennoch tiefgreifende Auswirkungen auf das Denken und Handeln der Menschen hat.
Welche kulturellen Wurzeln des Nationalbewusstseins werden untersucht?
Die Arbeit untersucht den Verlust religiöser Vormachtstellung, den Niedergang der Dynastien und die veränderte Wahrnehmung von Zeit als wichtige Faktoren für die Entstehung des Nationalbewusstseins.
Welche Rolle spielen Buchdruck und Schriftsprache?
Der kapitalistische Buchdruck und die Verbreitung von "weltlichen" Schriftsprachen werden als entscheidende Faktoren für die Schaffung einer "vorgestellten Gemeinschaft" und damit für die Entstehung des Nationalbewusstseins betrachtet.
Wie wird der Erklärungsgehalt des konstruktivistischen Ansatzes bewertet?
Das letzte Kapitel bewertet den Erklärungsgehalt und die Grenzen des konstruktivistischen Ansatzes im Vergleich zu anderen Theorien, um die Stärken und Schwächen von Andersons Ansatz aufzuzeigen.
Mit welchem Ansatz wird Andersons Ansatz verglichen?
Der Ansatz von Karl W. Deutsch dient als Vergleichsmaßstab für die Bewertung des Erklärungsgehalts von Andersons konstruktivistischem Ansatz.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2005, Benedict Anderson "Die Erfindung der Nation". Zur Bedeutung des konstruktivistischen Ansatzes für die Nationalismusforschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/52318