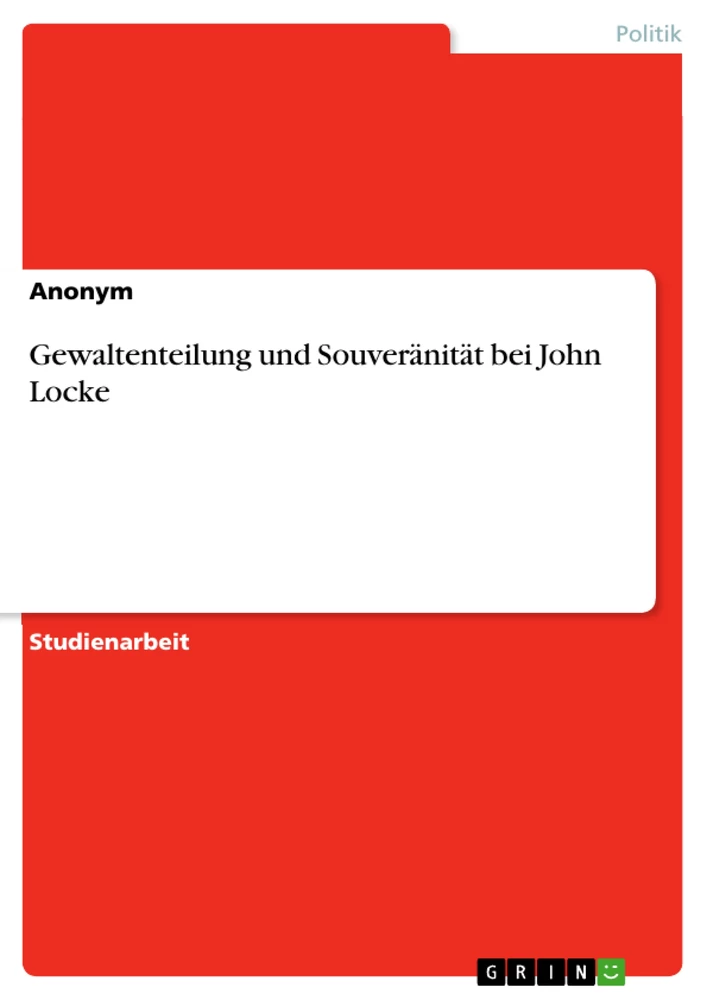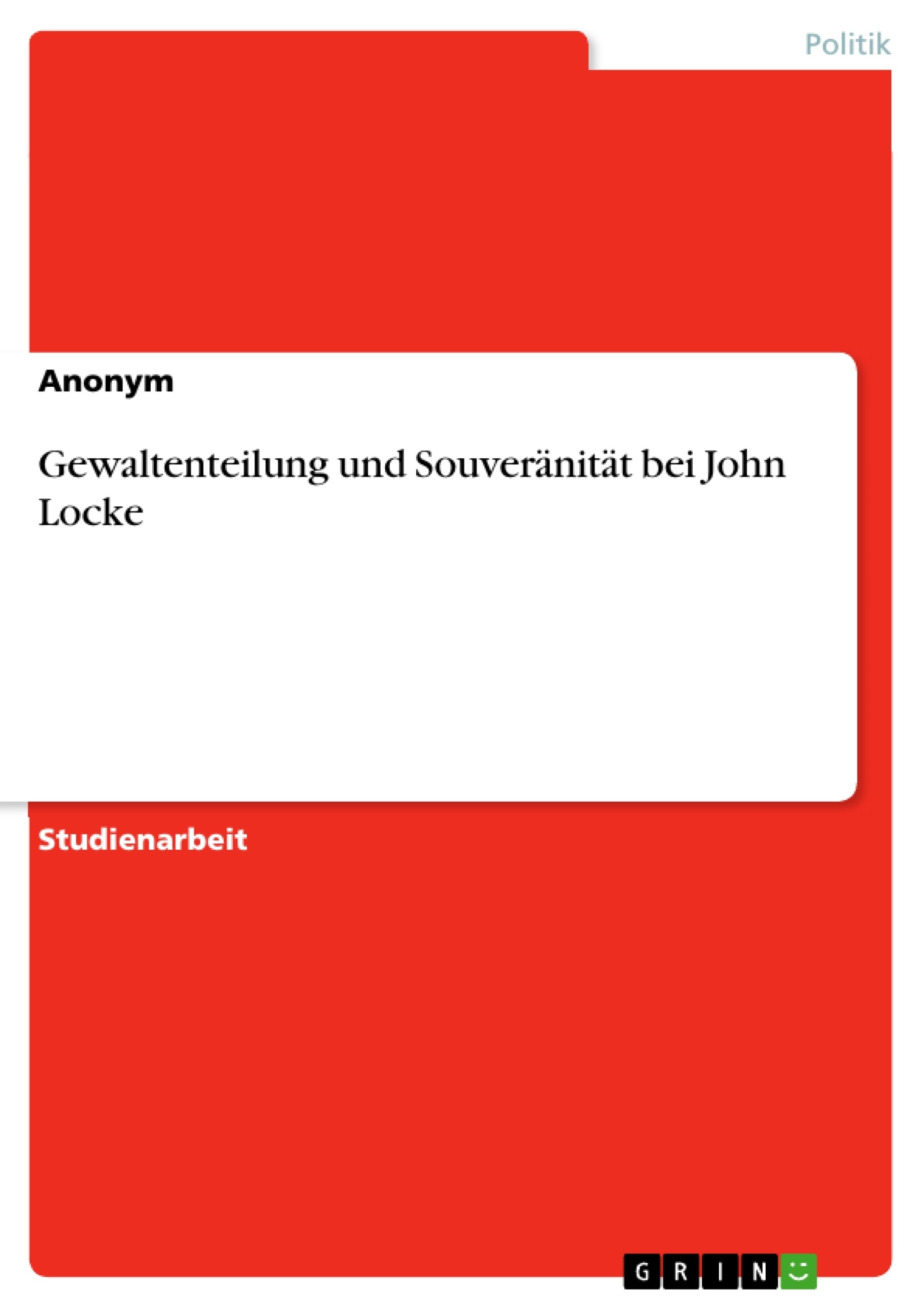John Lockes politisches Denken und Handeln kann nur im Kontext der gesellschafts-politischen Veränderungen im England des 17.Jahrhunderts verstanden werden. Aus einer bürgerlichen Familie stammend, ist Locke nicht zuletzt aufgrund seiner engen Freundschaft zu Lord Ashley (ab 1672 Earl of Shaftesbury) dem politischen Lager der Whigs zuzuordnen. Zuvor hatte sich das Parlament während der exclusion crisis (1679-1681) in zwei Lager gespalten. Die bürgerliche Klasse (Whigs) kämpfte darum, den Aristokraten (Tories) des überkommenen Feudalsystems politischen Einfluß zu entziehen. Dabei treten die Whigs für konstitutionelle Freiheiten und einen naturrechtlich begründeten Gesellschaftsvertrag ein und wollen den Ausschluß (exclusion) des zum Katholizismus konvertierten James II. von der Thronfolge erreichen.
Genau in dieser Zeit, also mehrere Jahre vor der Glorious Revolution 1688/89, schreibt Locke sein politisches Hauptwerk “Two Treatises of Government“, jedoch erst 1690 anonym veröffentlicht. Mit diesem Werk formuliert Locke als einer der ersten die Postulate der bürgerlichen Freiheitsbewegung. Während er in der ersten Abhandlung Filmers Rechtfertigung des Absolutismus destruiert, konstruiert er in der zweiten Abhandlung einen Staat, der von der Volkssouveränität ausgeht und die Konzentration politischer Macht durch Gewaltenteilung und Widerstandsrecht verhindern will.
Ziel dieser Arbeit ist es, das Verhältnis von Volkssouveränität und Gewaltenteilung innerhalb der Lockschen Staatslehre - und daraus resultierende Widersprüche - aufzuzeigen. Dabei soll die grundsätzliche Frage, ob und gegebenenfalls wie Souveränität bei Locke teilbar ist, diskutiert und beantwortet werden. Grundlage für folgende Untersuchung ist dabei der zweite Teil der “Two Treatises of Government“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Gewaltenteilung bei John Locke
- Die Legislative
- Begründung der Legislative als höchste Gewalt
- Begrenzung der Kompetenzen der Legislative
- Die Exekutive
- Die Notwendigkeit und das Wesen der Exekutive
- Föderative und Prärogative
- Das Verhältnis von Legislative und Exekutive
- Die Legislative
- Die Souveränitätskonzeption
- Die naturrechtliche Volkssouveränität bei Locke
- Das Widerstandsrecht als Instrument der Volkssouveränität
- Volkssouveränität versus Gewaltenteilung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis von Volkssouveränität und Gewaltenteilung in John Lockes Staatslehre und die daraus resultierenden Widersprüche. Die zentrale Frage ist, ob und wie Souveränität bei Locke teilbar ist. Die Analyse basiert auf dem zweiten Teil der "Two Treatises of Government".
- Die Begründung und Legitimation der Legislative bei Locke
- Die Grenzen der legislativen Gewalt und ihre Bindung an das Naturrecht
- Die Rolle der Exekutive und ihr Verhältnis zur Legislative
- Die Konzeption der Volkssouveränität im Naturzustand
- Das Widerstandsrecht als Ausdruck der Volkssouveränität
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung erläutert den historischen Kontext von Lockes politischem Denken im England des 17. Jahrhunderts, seine Zugehörigkeit zu den Whigs und die politische Auseinandersetzung zwischen Whigs und Tories während der Exclusion Crisis. Sie führt in Lockes "Two Treatises of Government" ein und beschreibt das Ziel der Arbeit: die Untersuchung des Verhältnisses von Volkssouveränität und Gewaltenteilung in Lockes Werk.
Die Gewaltenteilung bei John Locke: Dieses Kapitel analysiert Lockes Gewaltenteilungskonzept. Es beginnt mit der Begründung der Legislative als höchste Gewalt, die durch das Staatsziel des friedlichen Genusses des Eigentums gerechtfertigt wird. Die Legislative ist an das Naturrecht gebunden und nicht absolut. Die Grenzen ihrer Kompetenzen werden detailliert erläutert. Das Kapitel beschreibt auch die Exekutive, ihre Notwendigkeit und ihr Verhältnis zur Legislative, einschließlich der Unterscheidung zwischen föderativer und prärogativer Macht.
Die Souveränitätskonzeption: Dieser Abschnitt befasst sich mit Lockes Konzept der Volkssouveränität, das auf dem Naturrecht basiert. Er untersucht das Widerstandsrecht als Instrument zur Sicherung der Volkssouveränität und analysiert das Spannungsverhältnis zwischen Volkssouveränität und der Gewaltenteilung. Es wird diskutiert, wie die Teilbarkeit der Souveränität im Lockschen System funktioniert und welche Implikationen sich daraus ergeben.
Schlüsselwörter
John Locke, Gewaltenteilung, Volkssouveränität, Naturrecht, Legislative, Exekutive, Widerstandsrecht, Gesellschaftsvertrag, Eigentum, Glorious Revolution, Two Treatises of Government.
Häufig gestellte Fragen zu: John Lockes Staatslehre - Volkssouveränität und Gewaltenteilung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Verhältnis von Volkssouveränität und Gewaltenteilung in John Lockes Staatslehre, insbesondere die Frage, ob und wie Souveränität bei Locke teilbar ist. Die Analyse basiert auf dem zweiten Teil der "Two Treatises of Government" und untersucht die daraus resultierenden Widersprüche.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Begründung und Legitimation der Legislative bei Locke, die Grenzen der legislativen Gewalt und ihre Bindung an das Naturrecht, die Rolle der Exekutive und ihr Verhältnis zur Legislative, die Konzeption der Volkssouveränität im Naturzustand, und das Widerstandsrecht als Ausdruck der Volkssouveränität.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Gewaltenteilung bei Locke (Legislative und Exekutive, inklusive ihrer gegenseitigen Beziehung), ein Kapitel zur Souveränitätskonzeption (naturrechtliche Volkssouveränität, Widerstandsrecht, Verhältnis von Volkssouveränität und Gewaltenteilung) und ein Fazit. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter.
Welche Rolle spielt die Legislative bei Locke?
Die Legislative wird bei Locke als höchste Gewalt dargestellt, gerechtfertigt durch das Staatsziel des friedlichen Genusses des Eigentums. Ihre Macht ist jedoch nicht absolut, sondern an das Naturrecht gebunden. Die Arbeit erläutert detailliert die Grenzen der legislativen Kompetenzen.
Welche Rolle spielt die Exekutive?
Die Arbeit beschreibt die Notwendigkeit der Exekutive und ihr Verhältnis zur Legislative. Es wird die Unterscheidung zwischen föderativer und prärogativer Macht behandelt.
Wie beschreibt Locke die Volkssouveränität?
Lockes Konzept der Volkssouveränität basiert auf dem Naturrecht. Das Widerstandsrecht wird als Instrument zur Sicherung dieser Souveränität dargestellt. Die Arbeit analysiert das Spannungsverhältnis zwischen Volkssouveränität und der Gewaltenteilung und diskutiert die Teilbarkeit der Souveränität im Lockschen System.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: John Locke, Gewaltenteilung, Volkssouveränität, Naturrecht, Legislative, Exekutive, Widerstandsrecht, Gesellschaftsvertrag, Eigentum, Glorious Revolution, Two Treatises of Government.
Welchen historischen Kontext beleuchtet die Einleitung?
Die Einleitung beleuchtet den historischen Kontext von Lockes politischem Denken im England des 17. Jahrhunderts, seine Zugehörigkeit zu den Whigs und die politische Auseinandersetzung zwischen Whigs und Tories während der Exclusion Crisis. Sie führt in Lockes "Two Treatises of Government" ein und beschreibt das Ziel der Arbeit.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Frage der Arbeit ist, ob und wie Souveränität bei Locke teilbar ist.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2005, Gewaltenteilung und Souveränität bei John Locke, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/52317