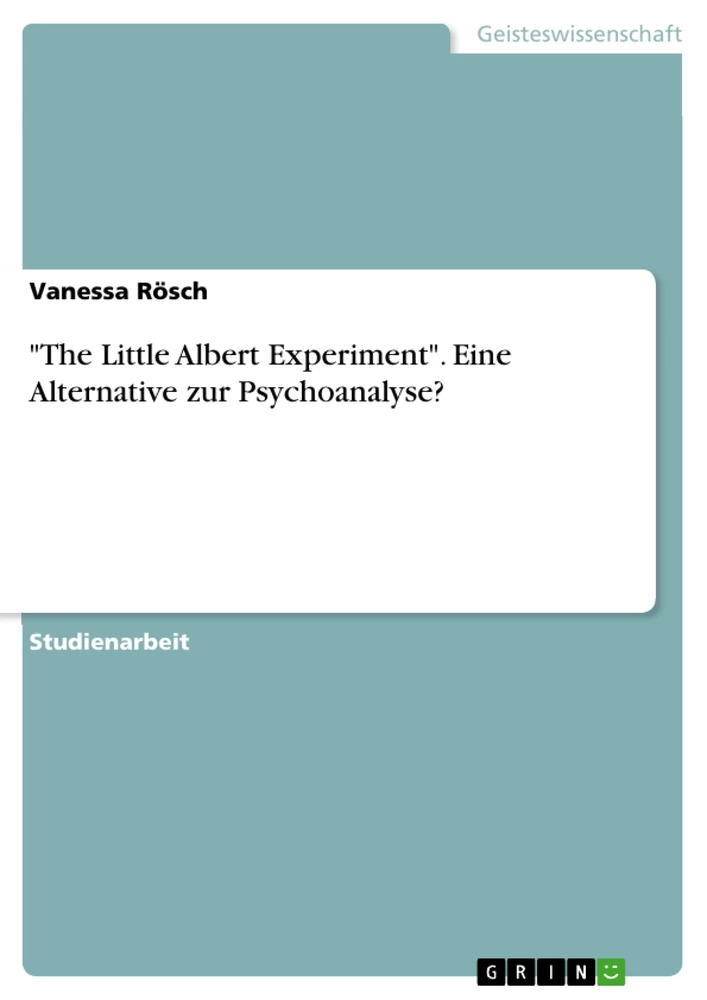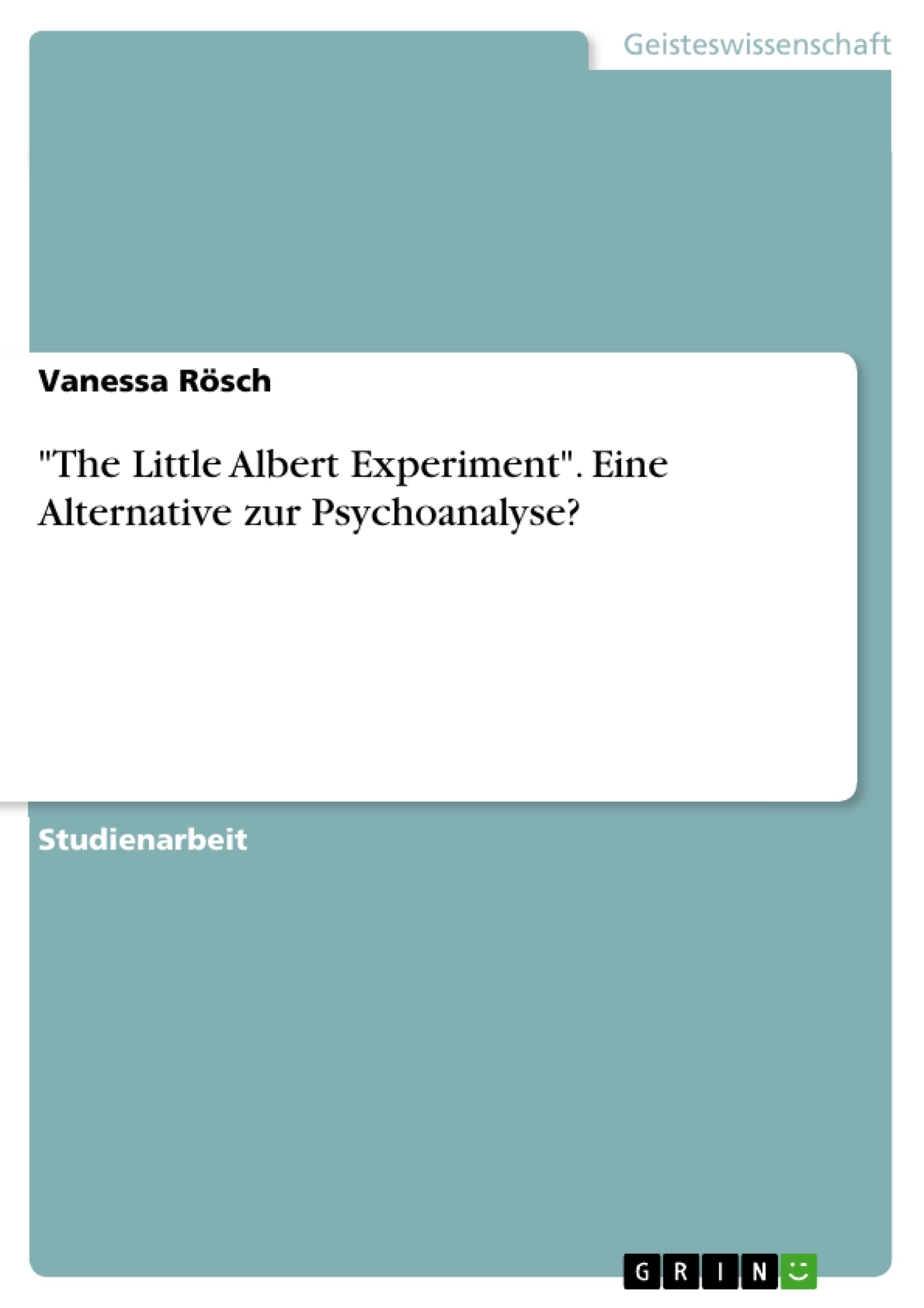Wie können wir ein bestimmtes Verhalten von Menschen erklären? Das ist eine vieler Grundfragen der Wissenschaften. Im Laufe der Zeit wurden zahlreiche Theorien, zur Beantwortung dieser Frage, aufgestellt. Einen entscheidenden Ansatz, der die Verhaltensforschung beherrschen sollte brachte im 19. Jahrhundert der Behaviorismus. Nach erstmaligen Nachweisen von Konditionierungen durch Pawlow wurden schon kurze Zeit danach weitere Untersuchen vorangetrieben.
Als einer der ersten Wissenschaftlicher und „Vater des Behaviorismus” (Bodenmann et al., 2004) entwickelte John B. Watson mithilfe der Klassischen Konditionierung einen neuen Aspekt der Verhaltenspsychologie. Mit der Veröffentlichung des Artikels „Psychology as the Behaviorist views it“ (Watson,1913) in der Psychological Review legte er den Grundstein für eine, noch bis heute weltweit anerkannte Lerntheorie. Watson bekam großen Zuspruch und seine theoretischen Ansätze wurden, unter anderem von B.F Skinner, weiterentwickelt.
Doch was waren die Grundgedanken und Ideen des Behaviorismus? Wie konnte der Behaviorismus als Verhaltenstheorie des Menschen empirisch belegt werden? Welche Kritikpunkte lassen sich feststellen?
Die vorangegangenen Leitfragen sollen Anhand einer der wichtigsten Verhaltenstheorien, von John B. Watsons Grundannahmen und seinem wohl bekanntesten Experiment “The Little Albert”, in der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit, näher betrachtet werden. Um diese Thematik genauer in den Blick zu nehmen, werde ich zunächst einige Eckdaten zum Leben des Behavioristen Watson erörtern und diese in den Zusammenhang mit seiner späteren Arbeit bringen. Im Zweiten und umfangreichsten Teil meiner Arbeit werde ich das Laborexperiment von Watson, das „Little-Albert Experiment”, als Beispiel der empirischen Anwendung, untersuchen. Welchen Einfluss letztendlich die Theorie Watsons auf die Psychologie hatte und welche, auch kritischen, Auswirkungen die Untersuchungen mithilfe des Reiz- Reaktions- Modell auf die Entwicklung des kleinen Albert hatten, wird im dritten Abschnitt dargelegt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung und Grundfragen
- 2 John Broadus Watson
- 3 Die Emotionstheorie des klassischen Behaviorismus
- 4 Das Lernen von Angst – der kleine Albert
- 4.1 Vorgeschichte und Ziel
- 4.2 Versuchsbedingungen
- 4.3 Versuchsablauf
- 4.4 Versuchsergebnisse
- 5 Kritik an dem Experiment
- 5.1 Inhaltliche Kritik
- 5.2 Ein Leben nach dem Experiment
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht John B. Watsons Behaviorismus und sein berühmtes „Little Albert“-Experiment. Ziel ist es, Watsons Grundannahmen zu erläutern, das Experiment im Detail zu analysieren und die Kritikpunkte an diesem zu beleuchten. Der Fokus liegt auf der empirischen Überprüfung des Behaviorismus und seinen Auswirkungen.
- John B. Watson und seine Beiträge zum Behaviorismus
- Die Emotionstheorie des klassischen Behaviorismus
- Das „Little Albert“-Experiment: Methodik und Ergebnisse
- Kritik an Watsons Experiment und dessen ethischen Implikationen
- Der Einfluss des Experiments auf die Psychologie
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung und Grundfragen: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Erklärung menschlichen Verhaltens und die Bedeutung des Behaviorismus als Ansatz zur Beantwortung dieser Frage dar. Sie skizziert die Bedeutung von John B. Watson und seinem "Little Albert"-Experiment als Fallstudie für die empirische Überprüfung behavioristischer Theorien und kündigt die Struktur der Arbeit an, beginnend mit einer biografischen Skizze Watsons, gefolgt von einer detaillierten Analyse des Experiments und einer abschließenden kritischen Betrachtung.
2 John Broadus Watson: Dieses Kapitel bietet einen biografischen Überblick über John B. Watson, seinen Werdegang und seine akademische Karriere. Es beleuchtet seine frühen Begegnungen mit Konflikten und seinem Bezug zu Iwan Pawlows Arbeiten. Watsons wissenschaftliche Theorien, die auf der Annahme beruhen, menschliches Verhalten sei einzig und allein auf Konditionierungen zurückzuführen, werden vorgestellt und seine Grundannahmen detailliert erläutert. Das Kapitel verdeutlicht Watsons Fokus auf objektive Verhaltensstudien und die Bedeutung von Laborexperimenten für seine Forschung, schließlich wird auch sein späterer Werdegang nach dem Verlust seiner Professur durch einen Skandal beleuchtet.
3 Die Emotionstheorie des klassischen Behaviorismus: (Anmerkung: Da der bereitgestellte Text keinen eigenständigen Abschnitt 3 enthält, kann an dieser Stelle keine Zusammenfassung erstellt werden. Dieser Abschnitt müsste im Originaltext vorhanden sein, um eine adäquate Zusammenfassung zu liefern.)
4 Das Lernen von Angst – der kleine Albert: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das „Little Albert“-Experiment. Es beinhaltet eine Darstellung der Vorgeschichte, der Zielsetzung, der Versuchsbedingungen, des Ablaufs und der Ergebnisse. Der Fokus liegt auf der Methode der klassischen Konditionierung, die Watson anwandte, um eine Angstkonditionierung bei dem Kleinkind hervorzurufen. Die detaillierte Beschreibung des Experiments ermöglicht es, die Methodik zu verstehen und die Ergebnisse kritisch zu bewerten. Die Ausführungen zu den einzelnen Unterpunkten (4.1-4.4) bieten einen umfassenden Einblick in den Versuchsaufbau und die gewonnenen Daten.
5 Kritik an dem Experiment: Dieses Kapitel widmet sich der Kritik am „Little Albert“-Experiment. Es werden sowohl inhaltliche Kritikpunkte als auch die langfristigen Auswirkungen auf das Leben des „kleinen Albert“ beleuchtet. Die ethischen Aspekte des Experiments, insbesondere der Mangel an Schutz des Kindes, werden hier kritisch hinterfragt und diskutiert. Die Kapitel analysiert die methodischen Schwächen und die ethischen Bedenken, die mit dem Experiment verbunden sind, und setzt sie in den Kontext der damaligen wissenschaftlichen Praxis.
Schlüsselwörter
Behaviorismus, John B. Watson, Klassische Konditionierung, Little Albert Experiment, Reiz-Reaktions-Modell, Angstkonditionierung, Empirische Forschung, Verhaltenspsychologie, Ethische Kritik.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu: John B. Watsons "Little Albert"-Experiment
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert John B. Watsons Behaviorismus und sein berühmtes „Little Albert“-Experiment. Sie erläutert Watsons Grundannahmen, analysiert das Experiment detailliert und beleuchtet die Kritikpunkte. Der Fokus liegt auf der empirischen Überprüfung des Behaviorismus und seinen Auswirkungen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: John B. Watson und seine Beiträge zum Behaviorismus; die Emotionstheorie des klassischen Behaviorismus; das „Little Albert“-Experiment: Methodik und Ergebnisse; Kritik an Watsons Experiment und dessen ethischen Implikationen; sowie der Einfluss des Experiments auf die Psychologie.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung und Grundfragen; John Broadus Watson; Die Emotionstheorie des klassischen Behaviorismus; Das Lernen von Angst – der kleine Albert (mit Unterkapiteln zur Vorgeschichte, Versuchsbedingungen, Ablauf und Ergebnissen); Kritik an dem Experiment (mit Unterkapiteln zur inhaltlichen Kritik und den Auswirkungen auf das Leben von „Little Albert“); und Fazit.
Wer war John B. Watson?
Kapitel 2 bietet einen biografischen Überblick über John B. Watson, seinen Werdegang und seine akademische Karriere. Es erläutert seine frühen Begegnungen mit Konflikten, seinen Bezug zu Iwan Pawlows Arbeiten und seine wissenschaftlichen Theorien, die auf der Annahme beruhen, menschliches Verhalten sei einzig und allein auf Konditionierungen zurückzuführen. Sein Fokus auf objektive Verhaltensstudien und Laborexperimente wird ebenso beleuchtet wie sein späterer Werdegang nach einem Skandal.
Was war das „Little Albert“-Experiment?
Kapitel 4 beschreibt detailliert das „Little Albert“-Experiment: die Vorgeschichte, die Zielsetzung, die Versuchsbedingungen, den Ablauf und die Ergebnisse. Es zeigt die Methode der klassischen Konditionierung, mit der Watson eine Angstkonditionierung bei dem Kleinkind hervorrief. Die detaillierte Beschreibung ermöglicht es, die Methodik zu verstehen und die Ergebnisse kritisch zu bewerten.
Welche Kritikpunkte werden am „Little Albert“-Experiment geäußert?
Kapitel 5 widmet sich der Kritik am Experiment. Es werden sowohl inhaltliche Kritikpunkte als auch die langfristigen Auswirkungen auf das Leben von „Little Albert“ beleuchtet. Die ethischen Aspekte des Experiments, insbesondere der Mangel an Schutz des Kindes, werden kritisch hinterfragt und diskutiert. Methodische Schwächen und ethische Bedenken werden analysiert und in den Kontext der damaligen wissenschaftlichen Praxis gesetzt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Behaviorismus, John B. Watson, Klassische Konditionierung, Little Albert Experiment, Reiz-Reaktions-Modell, Angstkonditionierung, Empirische Forschung, Verhaltenspsychologie, Ethische Kritik.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit untersucht John B. Watsons Behaviorismus und sein berühmtes „Little Albert“-Experiment. Ziel ist es, Watsons Grundannahmen zu erläutern, das Experiment im Detail zu analysieren und die Kritikpunkte zu beleuchten. Der Fokus liegt auf der empirischen Überprüfung des Behaviorismus und seinen Auswirkungen.
- Quote paper
- Vanessa Rösch (Author), 2018, "The Little Albert Experiment". Eine Alternative zur Psychoanalyse?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/516730