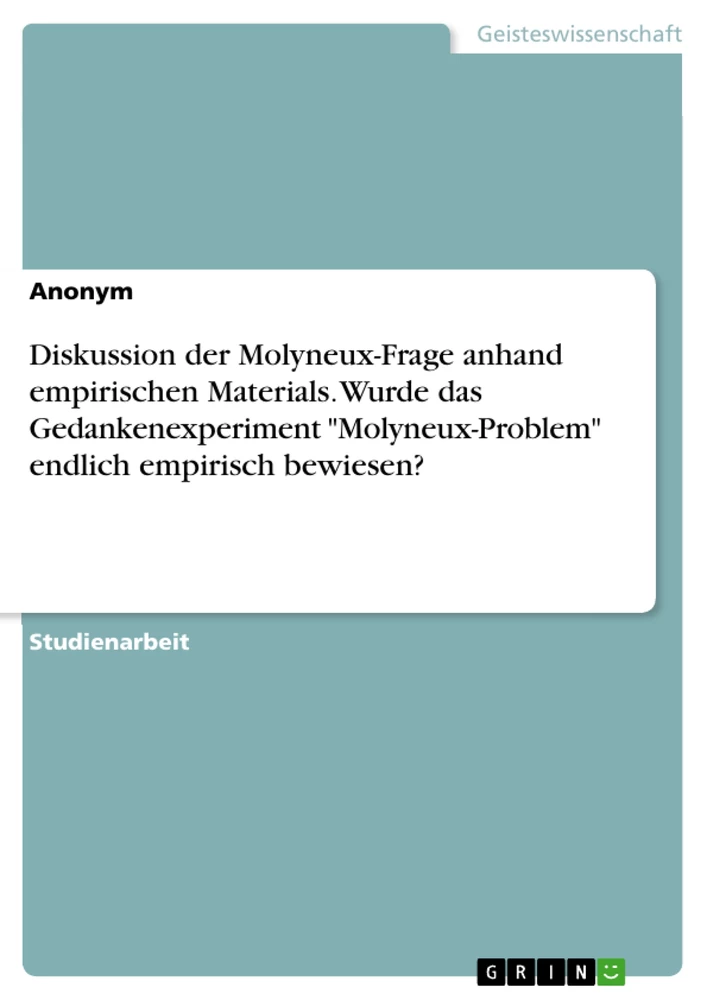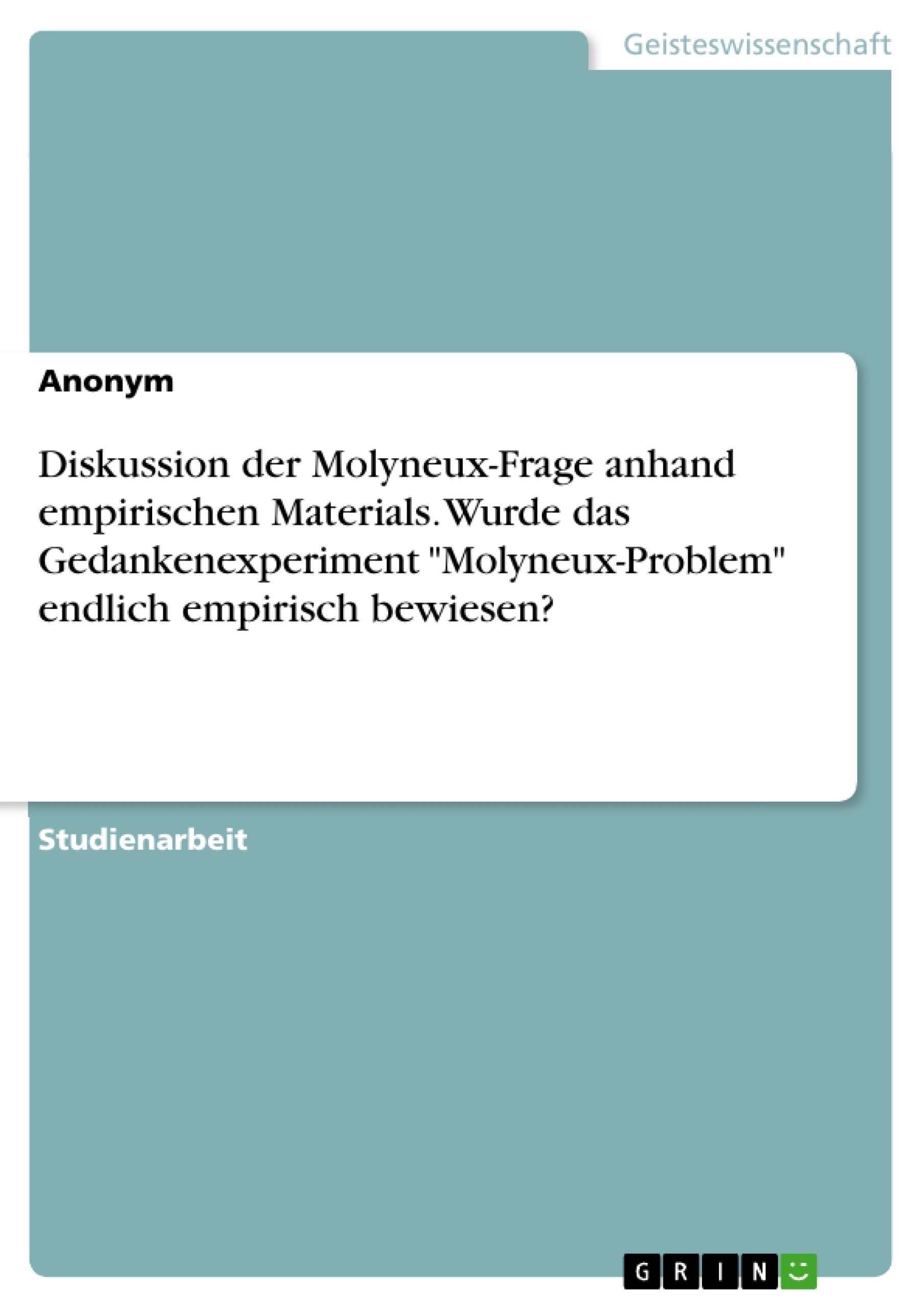Das Molyneux-Problem befasst sich mit der Entstehung der menschlichen Erkenntnis und stellt zudem eine wichtige, philosophische Frage im Bereich der Wahrnehmungstheorie. Kurz angerissen, handelt es sich beim Molyneux-Problem um einen von Geburt an Blinden, der die Fähigkeit erhält, sehen zu können. Dabei stellt sich die Frage, ob er zwischen zwei visuell gebotenen Stimuli (Kugel und Würfel) nur mithilfe seines neuen Sehsinns unterscheiden kann, wenn man davon ausgeht, dass er als Blinder beide Stimuli bereits durch Tasten unterscheiden konnte.
Historisch wurde das Molyneux-Problem erstmals 1688 durch einen Brief von William Molyneux an John Locke angestoßen und sorgte bei Kognitionspsychologen und Wahrnehmungstheoretikern beziehungsweise Philosophen für mehr als drei Jahrhunderte für Diskussionsstoff und Forschungsdrang. Angestoßen durch die These, dass die Molyneux-Frage beantwortet werden kann, soll am Ende der vorliegenden Arbeit gezeigt werden, welche Antwort das empirische Material auf die Molyneux-Frage gibt, aber auch, welche weiteren Fragen daraus entstehen könnten. Die Antwort auf die Molyneux-Frage soll Nein lauten und damit der gängigen Meinung der Empiristen entsprechen. Als möglicher Grund für die negative Antwort auf das Molyneux-Problem soll Lockes Argument dienen, das ausführt, dass die Beziehung der verschiedenen Sinne zueinander durch Erfahrung erlernt werden muss, da es keine natürliche Beziehung der verschiedenen Sinne zueinander gibt. Die vorliegende Arbeit schließt somit direkt an die bereits im Forschungsgebiet erschlossenen empirischen Studien an, indem sie vergleichend das darin gesammelte Material hingehend auf das Molyneux-Problem diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zielsetzung
- Aufbau der Arbeit
- Das Molyneux-Problem
- Positive Antwort
- Negative Antwort
- Empirische Studien über das Molyneux-Problem
- Problematik der Voraussetzungen an die Probanden
- Empirische Studien zum Molyneux-Problem
- Wiliam Cheselden
- Mike May
- Die Richard Held-Studie
- Diskussion empirischen Materials
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht anhand von empirischem Material die Frage, ob ein von Geburt an Blinder, der die Fähigkeit erhält, sehen zu können, zwischen zwei visuell dargebotenen Stimuli (Kugel und Würfel) unterscheiden kann, wenn er diese Stimuli bereits durch Tasten unterscheiden konnte. Das Ziel ist es, die Antwort auf die Molyneux-Frage zu beleuchten und mögliche weitere Fragen aufzuwerfen, die sich aus dem empirischen Material ergeben.
- Die Entstehung der menschlichen Erkenntnis
- Die Rolle der Erfahrung in der Wahrnehmung
- Die Verknüpfung verschiedener Sinneskanäle
- Die Beziehung zwischen Tast- und Sehsinn
- Die Interpretation empirischer Studien zum Molyneux-Problem
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Molyneux-Problem vor und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Sie skizziert die Bedeutung der Molyneux-Frage für die Wahrnehmungstheorie und die Forschungsgeschichte.
- Das Molyneux-Problem: Dieses Kapitel definiert das Molyneux-Problem und beschreibt die beiden gegensätzlichen Antworten: die positive Antwort, die von den Rationalisten vertreten wurde, und die negative Antwort, die von den Empiristen favorisiert wurde.
- Empirische Studien über das Molyneux-Problem: Dieses Kapitel analysiert verschiedene empirische Studien zum Molyneux-Problem. Es beleuchtet die Problematik der Voraussetzungen an die Probanden und diskutiert wichtige Studien wie die von William Cheselden, Mike May und Richard Held. Die Diskussion des empirischen Materials befasst sich mit den verschiedenen Perspektiven auf die Frage, ob die Molyneux-Frage mithilfe des empirischen Materials beantwortet werden kann.
Schlüsselwörter
Molyneux-Problem, Molyneux-Frage, Wahrnehmung, Empirismus, Rationalismus, Sinneskanäle, Tastsinn, Sehsinn, intermodale Wahrnehmung, Erfahrung, empirische Studien, Blindheit, Cheselden, May, Held.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2018, Diskussion der Molyneux-Frage anhand empirischen Materials. Wurde das Gedankenexperiment "Molyneux-Problem" endlich empirisch bewiesen?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/516724