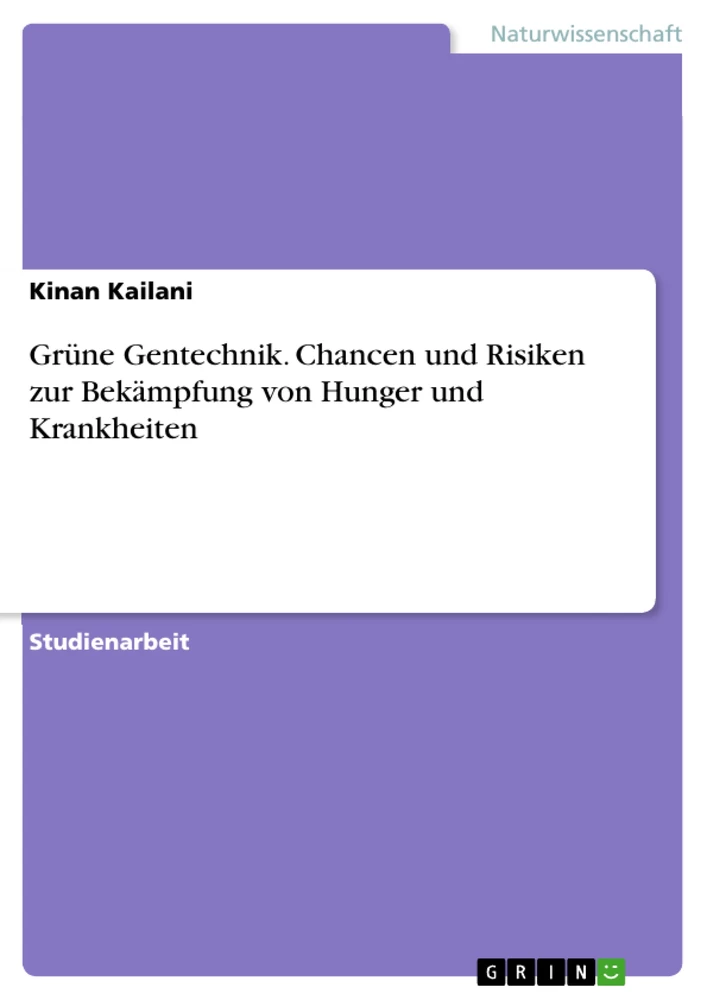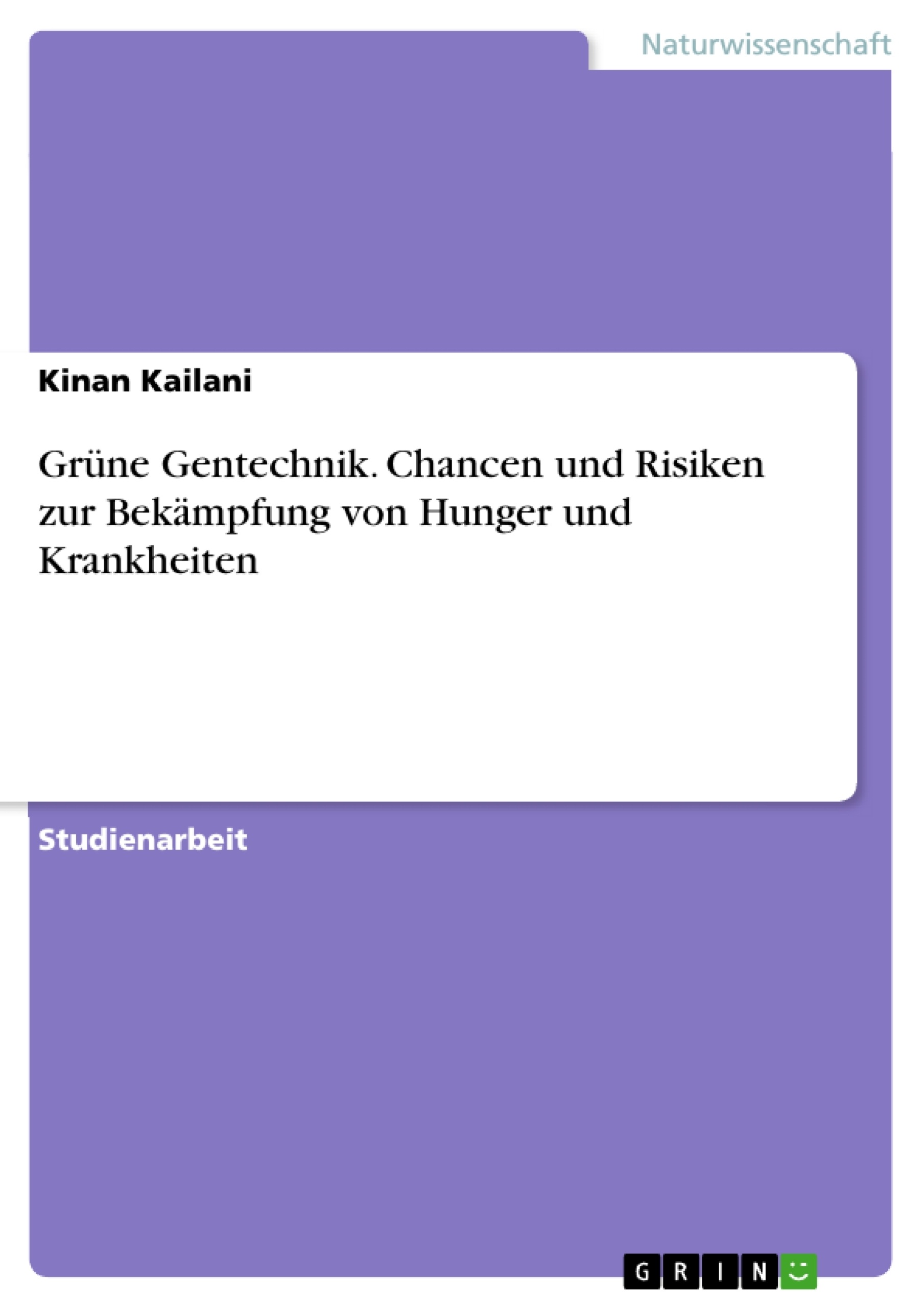Die Gentechnik wird mittlerweile auf vielerlei Weise angewandt. Grundsätzlich verfolgt sie das Ziel, Bakterien, Säugetiere und Pflanzen so zu verändern, dass diese größeren Nutzen für den Menschen erhalten. Insbesondere in Europa aber bleibt die Gentechnik ein umstrittenes Thema, das zudem sehr polarisierend wirkt: Auf der einen Seite gibt es unerbittliche Gegner, welche nicht müde werden, auf die ihrer Ansicht nach damit verbundenen Risiken hinzuweisen. Vor allem befürchten sie, dass der Konsument in nicht allzu ferner Zukunft keine Wahl mehr zwischen gentechnisch veränderten und konventionellen Lebensmitteln haben werde. Bei einer zu großen Verbreitung würden - wie sie hervorheben - alle Möglichkeiten der Kontrolle und Steuerung versagen. Der Willkür wäre damit Tür und Tor geöffnet.
Auf der anderen Seite steht ihnen eine zahlenmäßig kleinere Gruppe ebenso überzeugter Befürworter gegenüber, welche die Gentechnik als entscheidenden Schritt für die Lösung vieler, nicht zuletzt gesundheitlicher Probleme namentlich in den Entwicklungs- und Schwellenländern ansehen. Mit der Weiterentwicklung der Gentechnik verbinden sie die Hoffnung, wirksam gegen den Hunger in der Welt vorzugehen. Gegenwärtig leiden laut einem UN-Bericht 800 Millionen Menschen auf der Erde an Mangel- oder Unterernährung. Prognosen zufolge werden im Jahr 2100 rund 11 Milliarden Menschen zu ernähren sein - eine Herausforderung, der wir uns alle stellen sollten.
Gleichzeitig müssen wir uns aber auch der ethischen Dimension der Gentechnik bewusst werden und uns fragen, wo ihr Grenzen zu setzen sind. Dies gilt insbesondere dann, wenn entsprechende Versuche an Menschen durchgeführt werden, wie erst 2018 im Fall jener Zwillinge, die noch vor ihrer Geburt durch Genmanipulation HIV-resistent gemacht wurden. Obwohl es hierbei um die Bekämpfung einer Krankheit ging, stimmt dieses Beispiel sehr nachdenklich, zumal dasselbe Verfahren auch dafür eingesetzt werden kann, sogenannte "Designer-Babys" zu erschaffen.
Der Journalist Wolfgang J. Reus hat diese Dichotomie anschaulich und eindringlich in Worte gefasst: "Ebenso wie die Atomphysik öffnet die Gentechnik dem Menschen sowohl ein Tor zum Himmel als auch zur Hölle."
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG
- 2 KONVENTIONELLE PFLANZENZÜCHTUNG
- 2.1 Begriffsklärung
- 2.2 Selektionszüchtung
- 2.3 Kombinationszüchtung
- 2.4 Klonzüchtung
- 2.5 Mutationszüchtung
- 3 ZÜCHTUNG MIT DER, GRÜNEN GENTECHNIK
- 3.1 Begriffsklärung
- 3.2 Agrobacterium tumefaciens vermittelte Transformation
- 3.3 Die biolistische Transformation
- 3.4 CRISPR-Cas9
- 4 RISIKEN DER GRÜNEN GENTECHNIK
- 5.1 Unkontrollierte Ausbreitung von Pflanzen
- 5.2 Allergie auslösendes Potenzial
- 5.3 Auswirkungen auf andere Tiere im Ökosystem
- 5.4 Patentrecht auf Saatgut
- 6 CHANCEN DER GRÜNEN GENTECHNIK
- 6.1 Herbizidresistenz
- 6.2 Schutz vor Schadinsekten
- 6.3 Resistenz gegen umweltbedingte Stressfaktoren
- 6.3 Qualitätssteigerung anhand des Fallbeispiels, Golden Rice'
- 6 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert die Anwendung der grünen Gentechnik im Kontext der Bekämpfung von Hunger und Krankheiten. Dabei werden sowohl die Chancen als auch die Risiken dieser Technologie beleuchtet. Die Arbeit befasst sich mit den verschiedenen Methoden der Pflanzenzüchtung, einschließlich konventioneller Verfahren und gentechnischer Ansätze.
- Entwicklung neuer Pflanzenarten zur Steigerung der Erträge und Lebensmittelqualität
- Risiken der grünen Gentechnik wie z.B. unkontrollierte Ausbreitung von Pflanzen und allergische Reaktionen
- Chancen der grünen Gentechnik zur Bekämpfung von Hunger und Krankheiten durch z.B. Herbizidresistenz und Resistenz gegen Schadinsekten
- Ethische und rechtliche Aspekte der grünen Gentechnik, insbesondere das Patentrecht auf Saatgut
- Aktuelle Entwicklungen und Fallbeispiele wie z.B. „Golden Rice“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Bedeutung der Gentechnik im Kontext der Nahrungsmittelproduktion und der Herausforderungen durch den Hunger in der Welt beleuchtet. Anschließend wird die konventionelle Pflanzenzüchtung in ihren verschiedenen Formen vorgestellt, um den Hintergrund für die Diskussion der grünen Gentechnik zu schaffen. Im dritten Kapitel werden die verschiedenen Methoden der grünen Gentechnik erläutert, einschließlich der Agrobacterium tumefaciens vermittelten Transformation, der biolistischen Transformation und der CRISPR-Cas9-Technologie. Das vierte Kapitel behandelt die Risiken der grünen Gentechnik, wie z.B. die unkontrollierte Ausbreitung von Pflanzen, allergische Reaktionen, Auswirkungen auf andere Tiere im Ökosystem und das Patentrecht auf Saatgut. Im fünften Kapitel werden die Chancen der grünen Gentechnik im Detail besprochen, darunter die Steigerung der Erträge durch Herbizidresistenz und Resistenz gegen Schadinsekten sowie die Verbesserung der Nährstoffqualität von Pflanzen, wie am Beispiel des „Golden Rice“ gezeigt.
Schlüsselwörter
Grüne Gentechnik, Pflanzenzüchtung, Hunger, Krankheiten, Biodiversität, Herbizidresistenz, Schadinsekten, Golden Rice, Patentrecht, Risiken, Chancen, ethische Aspekte, gesellschaftliche Debatte, Entwicklungshilfe.
- Quote paper
- Kinan Kailani (Author), 2019, Grüne Gentechnik. Chancen und Risiken zur Bekämpfung von Hunger und Krankheiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/514313