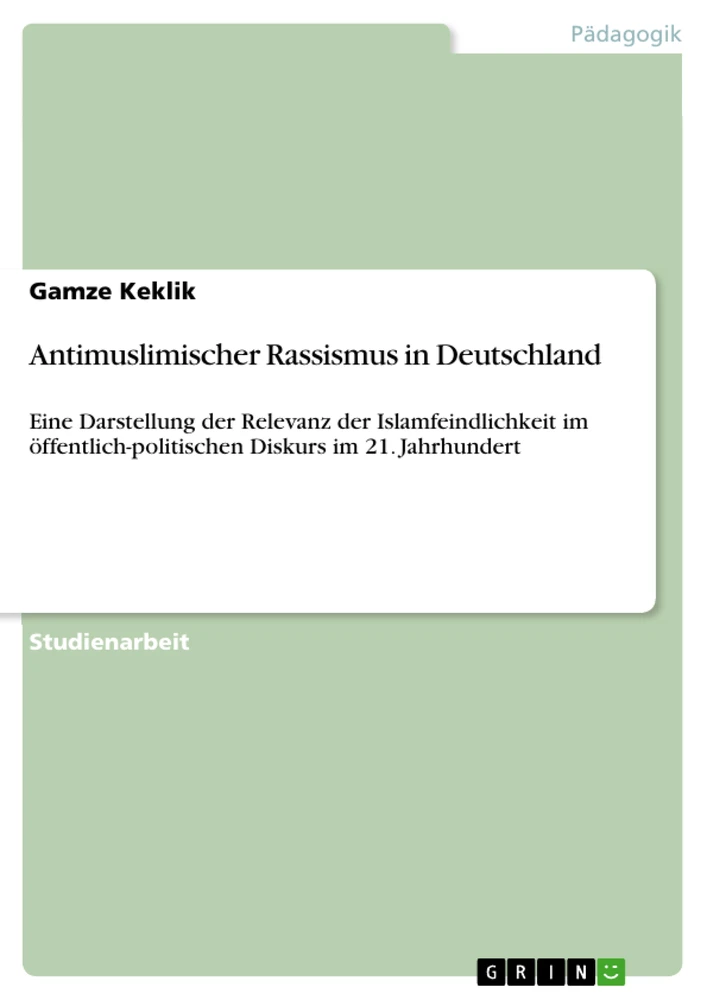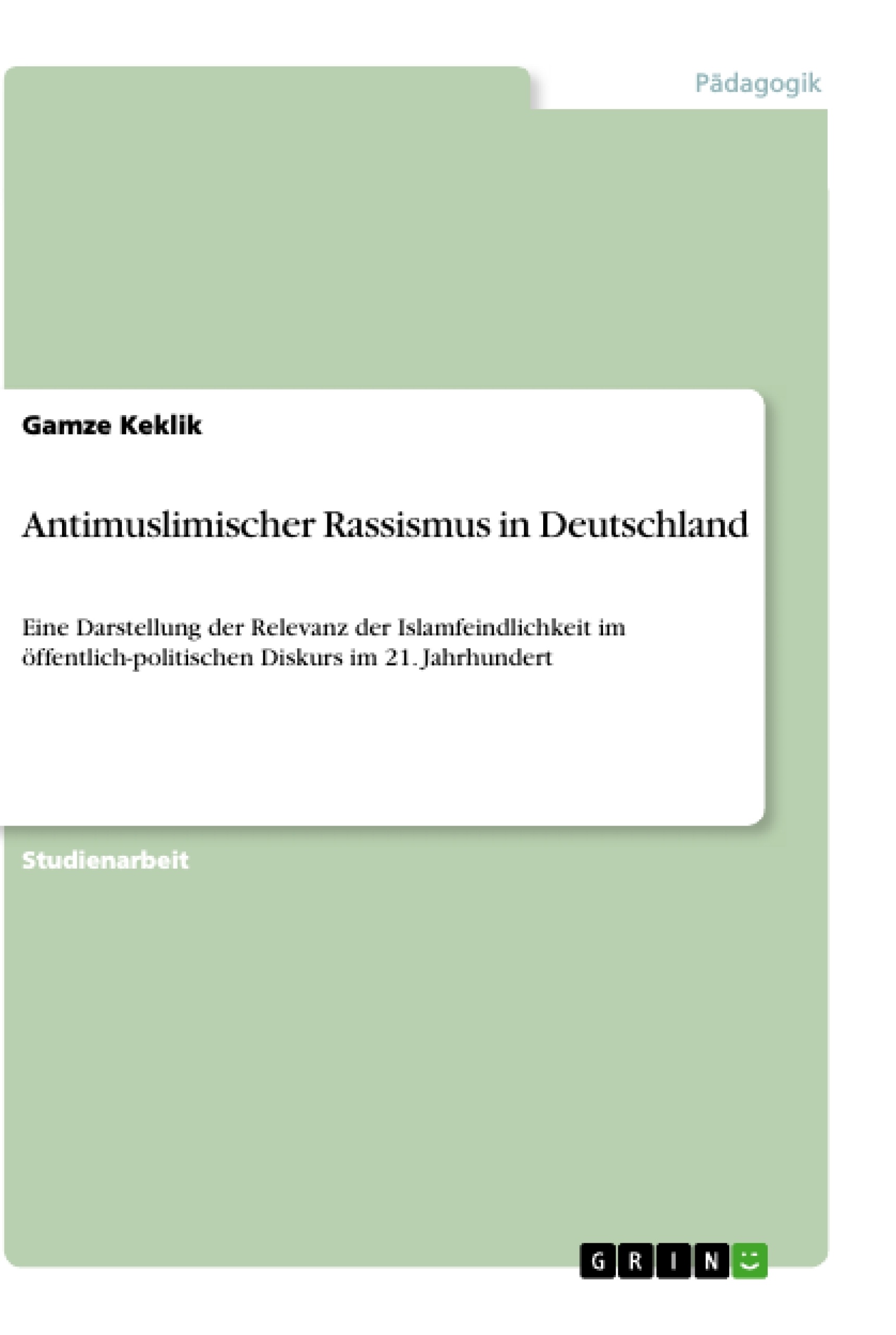Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema des antimuslimischen Rassismus im öffentlich-politischen Diskurs im 21. Jahrhundert, überwiegend in Deutschland. Betroffen sind hierbei Menschen, die einer islamischen Religion oder „Kultur“ angehören. Dieser Diskurs ist in der Bundesrepublik Deutschland aktuell und gesamtgesellschaftlich relevant. Doch warum ist dies relevant? Aufgrund der erhöhen Einwanderung aus muslimisch geprägten Ländern ist die Angst vor dem „Islam“ und vor „muslimisch“ geprägten Anschlägen erhöht. Belegt wird dies mit dem Teilergebnis des zweiten European Islamophobia Reports 2016 (vgl. Bayrakli; Hafez 2017), die wiederum mit den Ergebnissen von Studien in Deutschland zu Islamophobie, Islamfeindlichkeit und antimuslimischen Rassismus übereinstimmen (vgl. Heitmeyer 2012). Weiterführende Literatur weist unter anderem auch auf die Instrumentalisierung des „Feindbild Islams“ zur Legitimation von politischen Interventionen hin (vgl. Ruf 2012). Auch populistische Politiker_innen befürworten eine Untersagung von muslimischen Einwander_innen mit Migrations- bzw. Fluchterfahrung. Solch eine Forderung werde nach dem European Islamophobia Report von über 53% der Befragten befürwortet (vgl. Bayrakli; Hafez 2017:6). Ebenso zeigt eine Studie der LMU München zu dem Konzept der „gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ ein homogenes Ergebnis im rassistischen Spektrum. Denn neun von zehn befragten Münchener_innen haben eine ablehnende Einstellung gegenüber Menschen mit muslimischer Religionszugehörigkeit oder „Kultur“ (vgl. LMU 2016).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Aktueller Diskurs
- 2.1 Antimuslimischer Rassismus
- 2.2 Historie zu antimuslimischer Rassismus
- 2.3 Marginalisierung der Benennungspraxis
- 2.4 Zurückweisung der Benennung von antimuslimischen Rassismus
- 3. Analyse
- 3.1 Sprechen gleich Handeln?
- 3.2 Widerstandspraktiken
- 4. Fazit
- 5. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den antimuslimischen Rassismus im öffentlich-politischen Diskurs des 21. Jahrhunderts in Deutschland, insbesondere die Relevanz der Islamfeindlichkeit. Ziel ist es, die Mechanismen der Konstruktion und Aufrechterhaltung dieses Diskurses zu beleuchten sowie Widerstandspraktiken dagegen zu untersuchen.
- Die Entstehung und Relevanz von antimuslimischem Rassismus im Kontext von Einwanderung und politischer Instrumentalisierung
- Die Rolle von Sprache und Benennungspraxen in der Konstruktion von antimuslimischem Rassismus
- Die Entstehung von Feindbildern und die Konstruktion eines „Wir“ und „Ihr“ im öffentlichen Diskurs
- Die Analyse von Widerstandsstrategien gegen antimuslimischen Rassismus
- Die Bedeutung der Sprechakttheorie zur Einordnung von diskriminierendem Sprechen als bewusste Handlung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung - Die Einleitung stellt die Relevanz des antimuslimischen Rassismus im öffentlichen Diskurs in Deutschland dar. Sie beleuchtet die Rolle von Einwanderung und die Verbreitung von Islamophobie und analysiert die Instrumentalisierung des "Feindbild Islams" in der Politik.
- Kapitel 2: Aktueller Diskurs - Dieses Kapitel definiert den Begriff des "Diskurses" im Sinne von Michel Foucault und beleuchtet die Konstruktion von Machtverhältnissen durch gezielte sprachliche Praktiken. Es analysiert die Zuschreibung von "islamischer Kultur" als identitätsstiftend und die daraus resultierende Diskriminierung.
- Kapitel 2.1 Antimuslimischer Rassismus - Hier wird der antimuslimische Rassismus definiert und seine Mechanismen erläutert. Es werden verschiedene Indikatoren der Zuschreibung einer islamischen Religionszugehörigkeit und die daraus resultierende Marginalisierung in der Gesellschaft thematisiert.
- Kapitel 2.2 Historie zu antimuslimischer Rassismus - Dieser Abschnitt beleuchtet die Geschichte des antimuslimischen Rassismus und zeigt die Entwicklung des Begriffswechels von "Rasse" zu "Kultur" auf. Er stellt die Bedeutung des rassistischen Denkens im historischen Kontext dar.
- Kapitel 2.3 Marginalisierung der Benennungspraxis - Die Marginalisierung von Benennungspraxen im Kontext von antimuslimischem Rassismus wird hier kritisch analysiert.
- Kapitel 2.4 Zurückweisung der Benennung von antimuslimischem Rassismus - Die Gründe für die Abwehrhaltung der Mehrheitsgesellschaft gegenüber der Benennung von Rassismus werden in diesem Abschnitt beleuchtet.
- Kapitel 3: Analyse - Dieses Kapitel setzt sich mit der Sprechakttheorie auseinander und problematisiert diskriminierendes Sprechen als "Hate Speech". Es untersucht die Frage, ob sprachliche Praktiken zu Handlungspraxen führen und welche Widerstandspraktiken gegen antimuslimischen Rassismus entwickelt werden.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Antimuslimischer Rassismus, Islamfeindlichkeit, Islamophobie, Diskursanalyse, Machtverhältnisse, Benennungspraxis, Widerstandspraktiken, Sprechakttheorie, "Hate Speech". Die Arbeit befasst sich mit der Konstruktion von Feindbildern, der Rolle von Sprache und Kultur im Zusammenhang mit Rassismus und den Folgen der Marginalisierung von Minderheiten.
- Quote paper
- Gamze Keklik (Author), 2019, Antimuslimischer Rassismus in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/510841