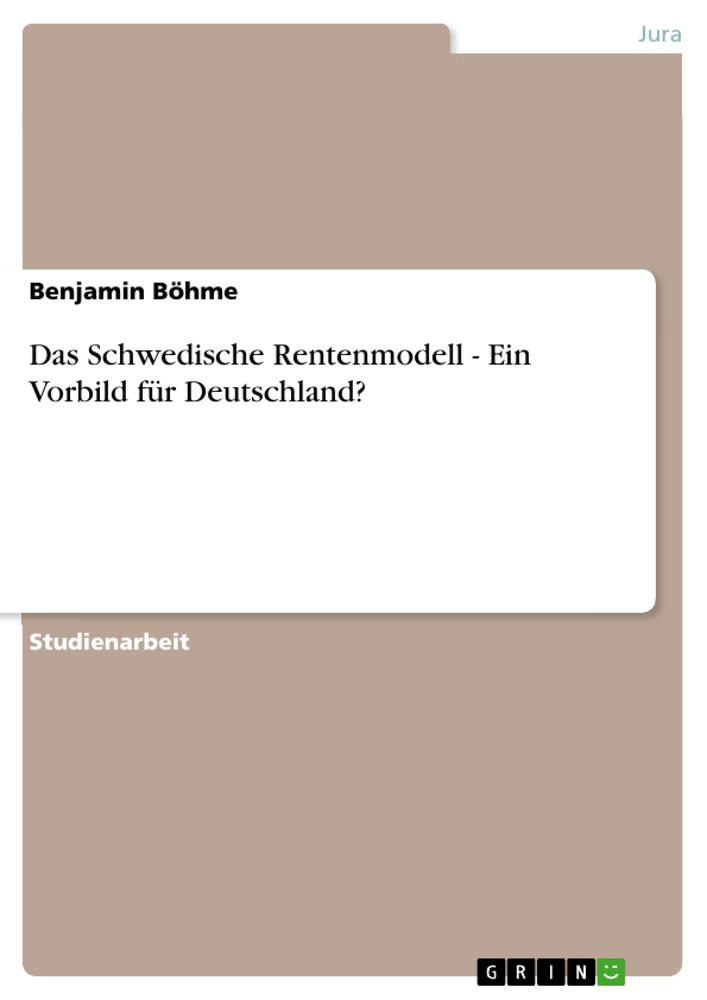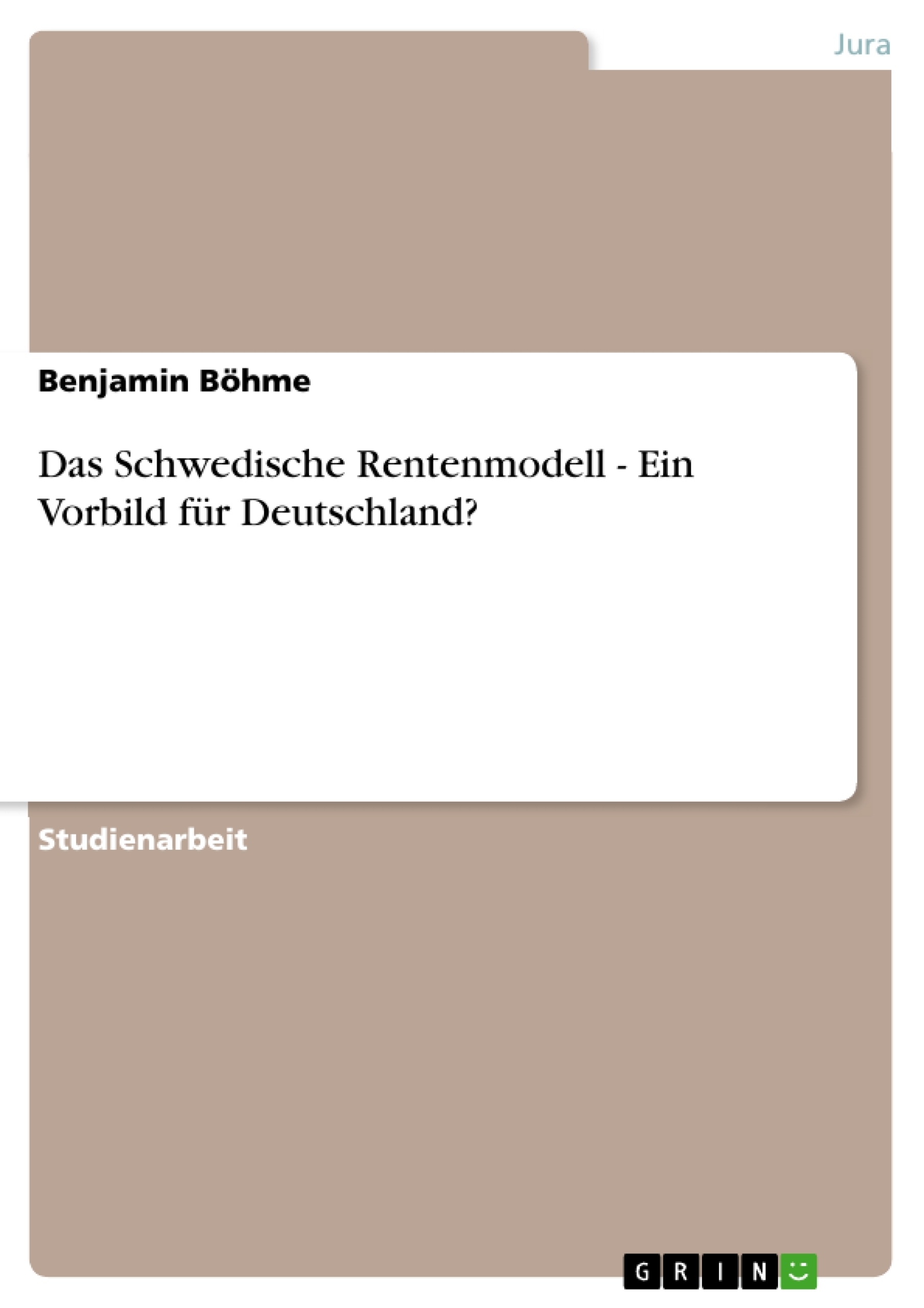Bennjamin Böhme. Universität Leipzig, Juristenfakultät. Die GRV ist das größte soziale Sicherungssystem in Deutschland. Jährlich etwa 235 Milliarden Euro setzt sie um – wenn man diese Geldmenge übereinander schichtet, reicht der Geldturm mit einer Höhe von gut 250 Kilometern fast bis ins Weltall hinaus. 19,6 Millionen Rentner erhalten Leistungen, das ist knapp ein Viertel der Bevölkerung Deutschlands. Wie das deutsche Rentensystem wirkungsvoll zu modernisieren ist, wird zurzeit in Wissenschaft und Politik vermehrt erörtert. Um auch unter veränderten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umständen Stabilität und Zuverlässigkeit des Systems zu gewährleisten, wird immer öfter das reformierte Schwedische Rentenmodell von 1998 in die Diskussion eingebracht.
Ziel der Arbeit ist es die Übertragbarkeit dieses Schwedischen Rentensystems auf Deutschland zu prüfen. Damit bewegt sie sich im interdisziplinären Feld zwischen Rechtswissenschaft, Volkswirtschaft und Politikwissenschaft. Es ist nun am Besten schrittweise vorzugehen. Um den Reformbedarf zu kennzeichnen, müssen zunächst in aller Kürze die Schwierigkeiten aufgezeigt werden, welche die deutsche GRV zu bewältigen hat. In einem zweiten Schritt sind die Ansätze und Mechanismen des Schwedische Systems aus dem Blickwinkel Deutschlands skizzenhaft darzustellen. Schließlich ist in einem dritten Schritt deskriptiv zu prüfen und normativ zu werten, ob das Modell als Vor-bild für Deutschland taugt.
Der Umfang des Themas lässt hier nur eine ansatzweise Betrachtung der Grundzüge zu, die noch durch weitere Forschungen erhärtet werden muss. Im Zentrum der Betrach-tung steht die gesetzliche Altersrente, da dies die Hauptleistung und Hauptherausforderung der GRV in Deutschland darstellt. Zweck der Arbeit ist nicht ein umfassender Vergleich des Deutschen und des Schwedischen Rentensystems, eine umfassende grund-rechtliche Wertung oder die Entwicklung eines neuen Rentensystems für Deutschland. / 2006
Inhaltsverzeichnis
- A. Einführung
- B. Problemlage der deutschen GRV
- I. Demographischer Wandel
- II. Ökonomische Probleme
- 1. Arbeitsmarkt
- 2. Konjunktur
- 3. Globalisierung
- III. Struktur der GRV
- 1. Renteneintrittsalter
- 2. Zuschusssystem
- 3. Kreis der Pflichtversicherten
- C. Ansätze des Schwedischen Rentenmodells
- I. Drei-Säulen-System
- II. Automatische Leistungsberechnung in der Einkommensrente
- 1. Flexible Rentenhöhe
- 2. Flexibles Renteneintrittsalter
- III. Systemstabilisatoren
- IV. Versicherter Personenkreis
- V. Beiträge
- VI. Kapitalgedeckte Prämienrente
- VII. Mindestrentengarantie
- VIII. Zusammenfassung
- D. Vorbildcharakter des Schwedischen Rentensystems
- 1. Übertragbarkeit der Schwedischen Ansätze
- 1. Problemlösungsvermögen
- a) Demographischer Wandel
- b) Wirtschaftlicher Wandel
- c) Struktur
- 2. Systemgeschichte
- 3. Beschäftigungsquoten
- 4. Stellenwert der Betriebsrenten
- 5. Finanzausstattung der öffentlichen Hand
- 6. Bereitschaft der Bevölkerung
- 7. Sonderfall: Deutsche Einheit
- II. Wertung der Schwedischen Ansätze
- 1. Systemstabilität vor dem Hintergrund von Demokratie und Gerechtigkeit
- 2. Lösungsversuch durch Kapitaldeckung
- 3. Einführung der Garantierente
- a) Notwendigkeit
- b) Ausgestaltung
- 4. Maßnahmen gegen Altersdiskriminierung
- 5. Solidarische Elemente
- E. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Übertragbarkeit des schwedischen Rentenmodells auf Deutschland. Sie analysiert die Problemlage der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) und stellt die Ansätze des schwedischen Systems gegenüber. Das Ziel ist eine deskriptive und normative Bewertung des schwedischen Modells als mögliches Vorbild für Reformen in Deutschland.
- Probleme der deutschen GRV (demografischer Wandel, ökonomische Herausforderungen)
- Das schwedische Drei-Säulen-System und seine Mechanismen
- Übertragbarkeit der schwedischen Ansätze auf den deutschen Kontext
- Bewertung der Systemstabilität und Gerechtigkeit des schwedischen Modells
- Analyse der Lösungsansätze des schwedischen Systems für demografische und ökonomische Herausforderungen.
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einführung: Die Arbeit untersucht die Übertragbarkeit des schwedischen Rentenmodells auf Deutschland. Sie beleuchtet zunächst die Problematik der deutschen GRV, um im Anschluss die Mechanismen des schwedischen Systems zu präsentieren und dessen Eignung als Vorbild für Deutschland zu bewerten. Der Fokus liegt auf der gesetzlichen Altersrente. Ein umfassender Vergleich beider Systeme oder die Entwicklung eines neuen deutschen Rentensystems sind nicht Gegenstand dieser Arbeit.
B. Problemlage der deutschen GRV: Dieses Kapitel beschreibt die finanziellen Herausforderungen der deutschen GRV, die aus dem demografischen Wandel (steigende Lebenserwartung, sinkende Geburtenrate) und ökonomischen Problemen (hohe Arbeitslosenquote, verlangsamtes Wirtschaftswachstum) resultieren. Die steigenden Rentenausgaben stehen im Missverhältnis zu den sinkenden Einnahmen, was ein Finanzierungsdefizit zur Folge hat. Der hochverschuldete Staatshaushalt verschärft diese Situation zusätzlich.
C. Ansätze des Schwedischen Rentenmodells: Dieses Kapitel beschreibt das schwedische Rentenmodell, das auf einem Drei-Säulen-System basiert. Es analysiert die automatische Leistungsberechnung der Einkommensrente mit flexibler Rentenhöhe und flexiblem Renteneintrittsalter. Weiterhin werden Systemstabilisatoren, der versicherte Personenkreis, die Beiträge, die kapitalgedeckte Prämienrente, die Mindestrentengarantie und eine zusammenfassende Betrachtung des Systems behandelt.
D. Vorbildcharakter des Schwedischen Rentensystems: Dieses Kapitel bewertet die Übertragbarkeit des schwedischen Modells auf Deutschland. Es untersucht die Problemlösungsfähigkeit des Systems im Hinblick auf den demografischen und wirtschaftlichen Wandel sowie strukturelle Aspekte. Die Systemgeschichte, Beschäftigungsquoten, der Stellenwert von Betriebsrenten und die Finanzausstattung des öffentlichen Sektors werden berücksichtigt. Die Bereitschaft der Bevölkerung und der Sonderfall der Deutschen Einheit werden ebenfalls analysiert. Abschließend erfolgt eine Bewertung der Systemstabilität hinsichtlich Demokratie und Gerechtigkeit, der Lösungsansätze durch Kapitaldeckung und die Einführung einer Garantierente inklusive Notwendigkeit und Ausgestaltung. Maßnahmen gegen Altersdiskriminierung und solidarische Elemente werden ebenso behandelt.
Schlüsselwörter
Deutsches Rentensystem, Schwedisches Rentenmodell, Demographischer Wandel, Ökonomische Probleme, Drei-Säulen-System, Kapitaldeckung, Altersvorsorge, Systemstabilität, Gerechtigkeit, Übertragbarkeit, Reformbedarf, Altersdiskriminierung.
FAQ: Übertragbarkeit des Schwedischen Rentenmodells auf Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Übertragbarkeit des schwedischen Rentenmodells auf Deutschland. Sie analysiert die Problemlage der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) und vergleicht sie mit den Ansätzen des schwedischen Systems. Ziel ist eine deskriptive und normative Bewertung des schwedischen Modells als mögliches Vorbild für Reformen in Deutschland. Der Fokus liegt auf der gesetzlichen Altersrente.
Welche Probleme der deutschen GRV werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt die finanziellen Herausforderungen der deutschen GRV, die aus dem demografischen Wandel (steigende Lebenserwartung, sinkende Geburtenrate) und ökonomischen Problemen (hohe Arbeitslosenquote, verlangsamtes Wirtschaftswachstum) resultieren. Die steigenden Rentenausgaben stehen im Missverhältnis zu den sinkenden Einnahmen, was zu einem Finanzierungsdefizit führt. Der hochverschuldete Staatshaushalt verschärft diese Situation.
Wie funktioniert das schwedische Rentenmodell?
Das schwedische Rentenmodell basiert auf einem Drei-Säulen-System. Die Arbeit analysiert die automatische Leistungsberechnung der Einkommensrente mit flexibler Rentenhöhe und flexiblem Renteneintrittsalter. Weitere Aspekte sind Systemstabilisatoren, der versicherte Personenkreis, die Beiträge, die kapitalgedeckte Prämienrente und die Mindestrentengarantie.
Welche Aspekte der Übertragbarkeit des schwedischen Modells werden untersucht?
Die Arbeit bewertet die Übertragbarkeit des schwedischen Modells auf Deutschland. Es werden die Problemlösungsfähigkeit des Systems bezüglich demografischen und wirtschaftlichen Wandels sowie strukturelle Aspekte untersucht. Die Systemgeschichte, Beschäftigungsquoten, der Stellenwert von Betriebsrenten, die Finanzausstattung des öffentlichen Sektors, die Bereitschaft der Bevölkerung und der Sonderfall der Deutschen Einheit werden analysiert.
Welche Kriterien werden zur Bewertung des schwedischen Modells verwendet?
Die Bewertung des schwedischen Modells umfasst die Systemstabilität hinsichtlich Demokratie und Gerechtigkeit, die Lösungsansätze durch Kapitaldeckung, die Einführung einer Garantierente (Notwendigkeit und Ausgestaltung), Maßnahmen gegen Altersdiskriminierung und solidarische Elemente.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Deutsches Rentensystem, Schwedisches Rentenmodell, Demographischer Wandel, Ökonomische Probleme, Drei-Säulen-System, Kapitaldeckung, Altersvorsorge, Systemstabilität, Gerechtigkeit, Übertragbarkeit, Reformbedarf, Altersdiskriminierung.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: A. Einführung, B. Problemlage der deutschen GRV, C. Ansätze des Schwedischen Rentenmodells, D. Vorbildcharakter des Schwedischen Rentensystems, E. Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung im Text.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt auf eine deskriptive und normative Bewertung des schwedischen Rentenmodells als mögliches Vorbild für Reformen in Deutschland ab. Sie untersucht, ob und inwiefern das schwedische System auf die deutsche Situation übertragbar ist.
- Quote paper
- Benjamin Böhme (Author), 2006, Das Schwedische Rentenmodell - Ein Vorbild für Deutschland?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/51082