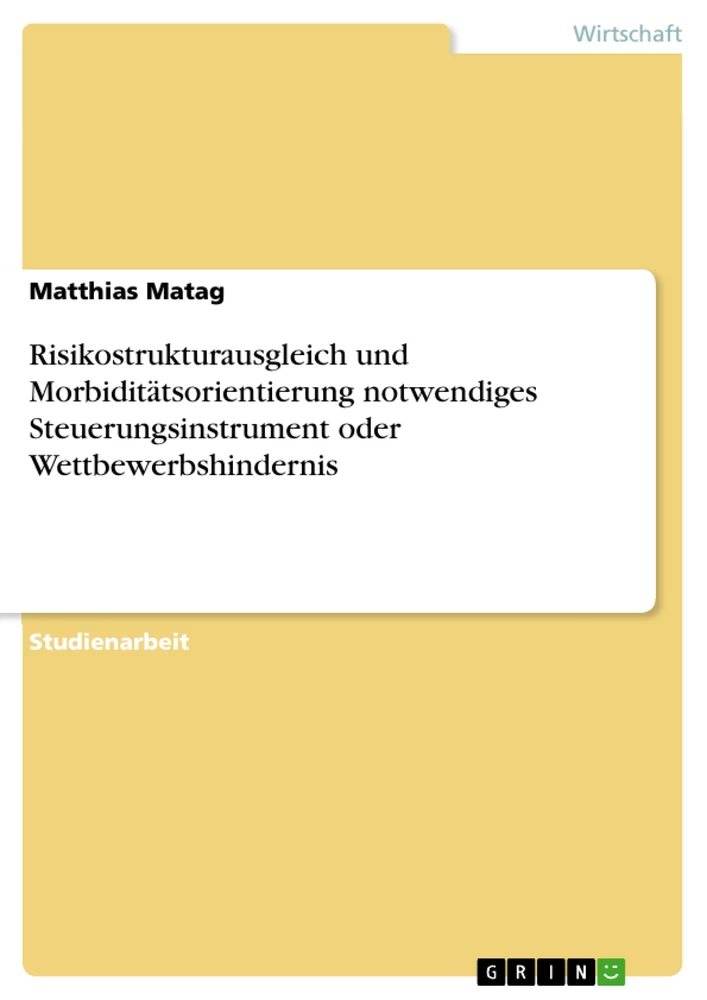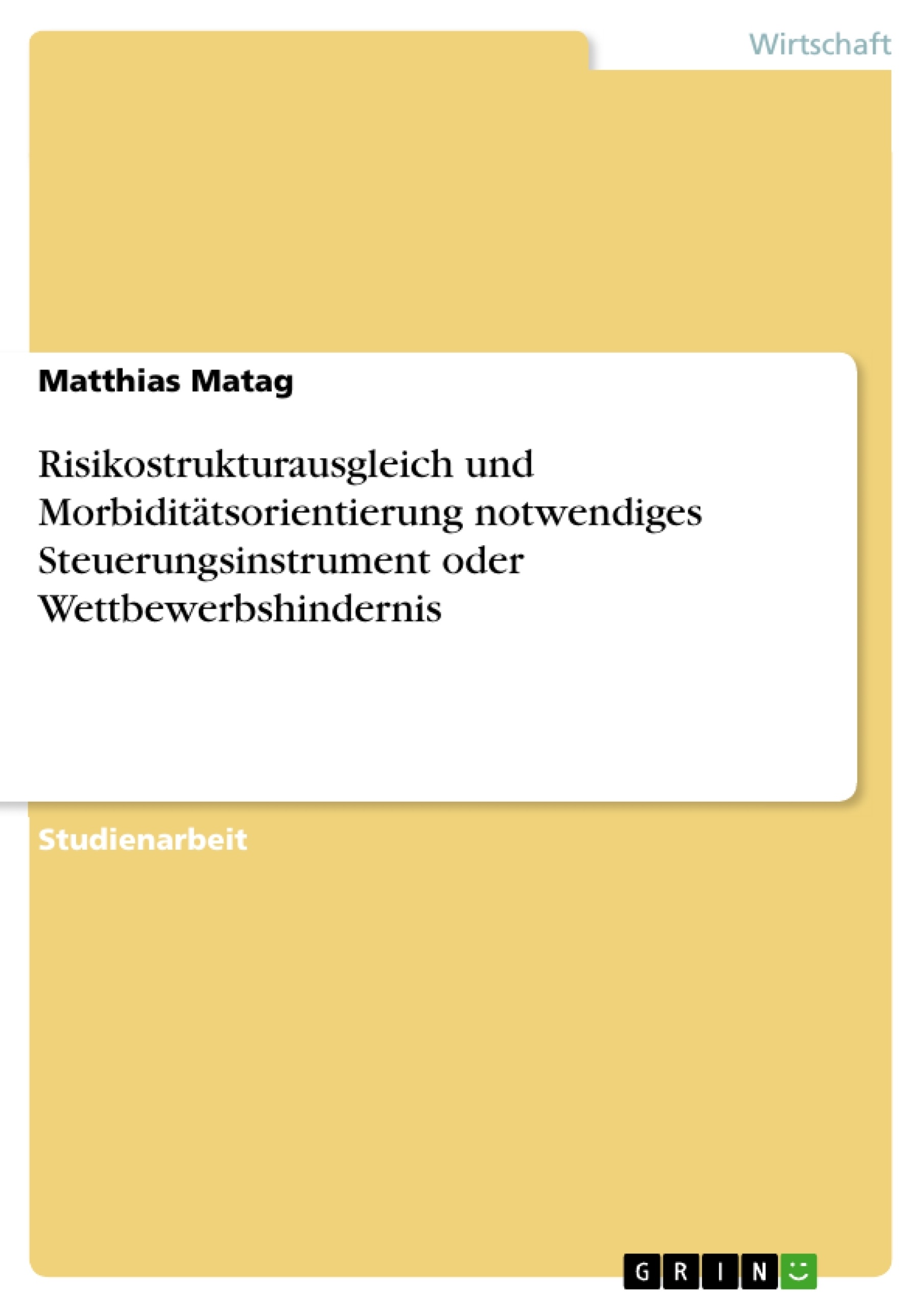Durch ihn werden derzeit jährlich fast 16 Mrd. EUR Beitragseinnahmen zwischen den Krankenkassen umverteilt. Somit ist derRisikostrukturausgleich(RSA) hinter der Umlagenfinanzierung dergesetzlichen Krankenversicherung(GKV) das zweitwichtigste Finanzinstrument. Doch kennen nur wenige seine Funktionsweise und Bedeutung für das GKV-System. Mit der Einführung des Wahlrechts und dem Einsetzen des Wettbewerbs in der GKV setzt er die Rahmenbedingungen, wodurch das Solidaritätsprinzip auch zwischen den Krankenkassen gewahrt bleiben soll. Auch Kranke und schlecht Verdienende sollen auf Wirtschaftlichkeit und Effizienz im Gesundheitssystem einwirken, damit die hohe Versorgungsqualität im Ge-sundheitssystem erhalten bleibt. Ohne ihn würde der Krankenkassenwettbewerb ausschließlich auf Gesunde und gut Verdienende abzielen, wodurch schwer kranke Menschen lediglich geduldet würden.
Dagegen sehen einige Kassen in dem RSA ein Hindernis durch mehr Wettbewerb für ein innovatives GKV-System zu sorgen. Gerade die steigenden Transferzahlungen erbringen für sie den Beweis einer ineffizienten Subventionierungsmaschinerie. Aus diesem Grund fordern Kritiker seine Begrenzung, anstatt die bestehenden Defizite durch Modifizierungen abzustellen. Des Weiteren sehen die „einzahlenden Kassen“ durch den Umbau des RSA ab 2007, d.h. Orientierung an den krankheitsbezogenen Leistungsausgaben, eine rapide Verteuerung des Gesundheitssystems voraus.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung des Risikostrukturausgleichs
- Funktionsweise des Risikostrukturausgleichs
- Wettbewerbs- und Solidaritätssichernde Funktion
- Grundsätzliche Zielkonflikte
- Auswirkungen des Risikostrukturausgleichs auf den Krankenkassenwettbewerb
- Wechselverhalte und Beitragssatzanpassungen
- Unterbindung von Risikoselektion
- Vorteile und Defizite des jetzigen Risikostrukturausgleichs
- Ausrichtung an der Morbidität
- Disease Management Program
- Risikopool
- Einführung eines morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs
- Auswahl und Gestaltung der Klassifikationsmodelle
- Effekte des ausgewählten Morbiditätsmodells
- Positionen und Modelle zum RSA-Reformfahrplan
- Ansichten der Kritiker
- Ansichten der Befürworter
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit dem Risikostrukturausgleich (RSA) im Kontext der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und untersucht dessen Funktionsweise, Auswirkungen und Relevanz für das Gesundheitssystem. Ziel ist es, den RSA als Steuerungsinstrument im Wettbewerb der Krankenkassen zu analysieren und seine Bedeutung für die Wahrung des Solidaritätsprinzips zu beleuchten.
- Funktionsweise und Bedeutung des RSA im GKV-System
- Auswirkungen des RSA auf den Wettbewerb der Krankenkassen
- Die Rolle des RSA bei der Unterbindung von Risikoselektion
- Der Übergang zu einem morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA)
- Kritische Betrachtung des RSA und seiner Reformansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Bedeutung des RSA im GKV-System. Kapitel 2 gibt einen Überblick über die historische Entwicklung des RSA in Verbindung mit dem Kassenwahlrecht. Kapitel 3 behandelt die Gestaltung und Funktionsweise des RSA, wobei auch alternative Konzepte betrachtet werden. In Kapitel 4 werden die konkreten Auswirkungen des RSA auf den Wettbewerb der Krankenkassen beleuchtet. Kapitel 5 befasst sich mit ergänzenden Modellen wie dem Disease Management Program (DMP) und dem Risikopool. Kapitel 6 beschäftigt sich mit dem empfohlenen Morbiditätsmodell für den RSA. Kapitel 7 geht auf Positionen und Modelle einzelner Krankenkassen sowie auf Argumente für und gegen den RSA-Reformfahrplan ein.
Schlüsselwörter
Risikostrukturausgleich, Krankenkassenwettbewerb, Solidaritätsprinzip, Morbidität, Disease Management Program, Morbi-RSA, GKV-System, Finanzinstrument, Risikoselektion, Wettbewerbshindernis, Steuerungsinstrument.
- Arbeit zitieren
- Matthias Matag (Autor:in), 2005, Risikostrukturausgleich und Morbiditätsorientierung notwendiges Steuerungsinstrument oder Wettbewerbshindernis, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/51070