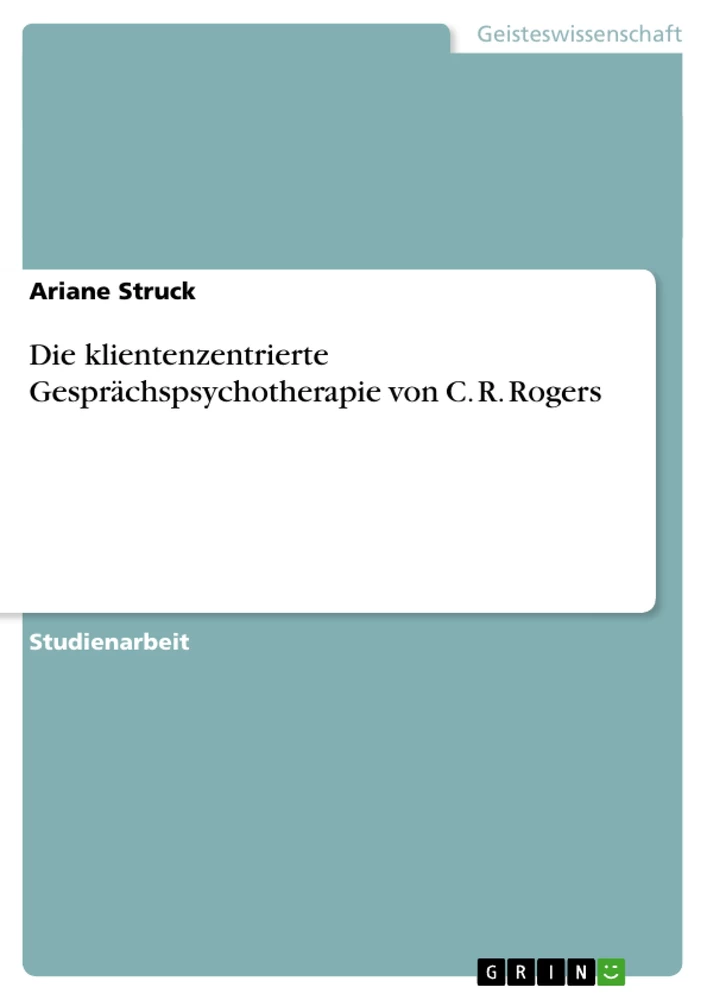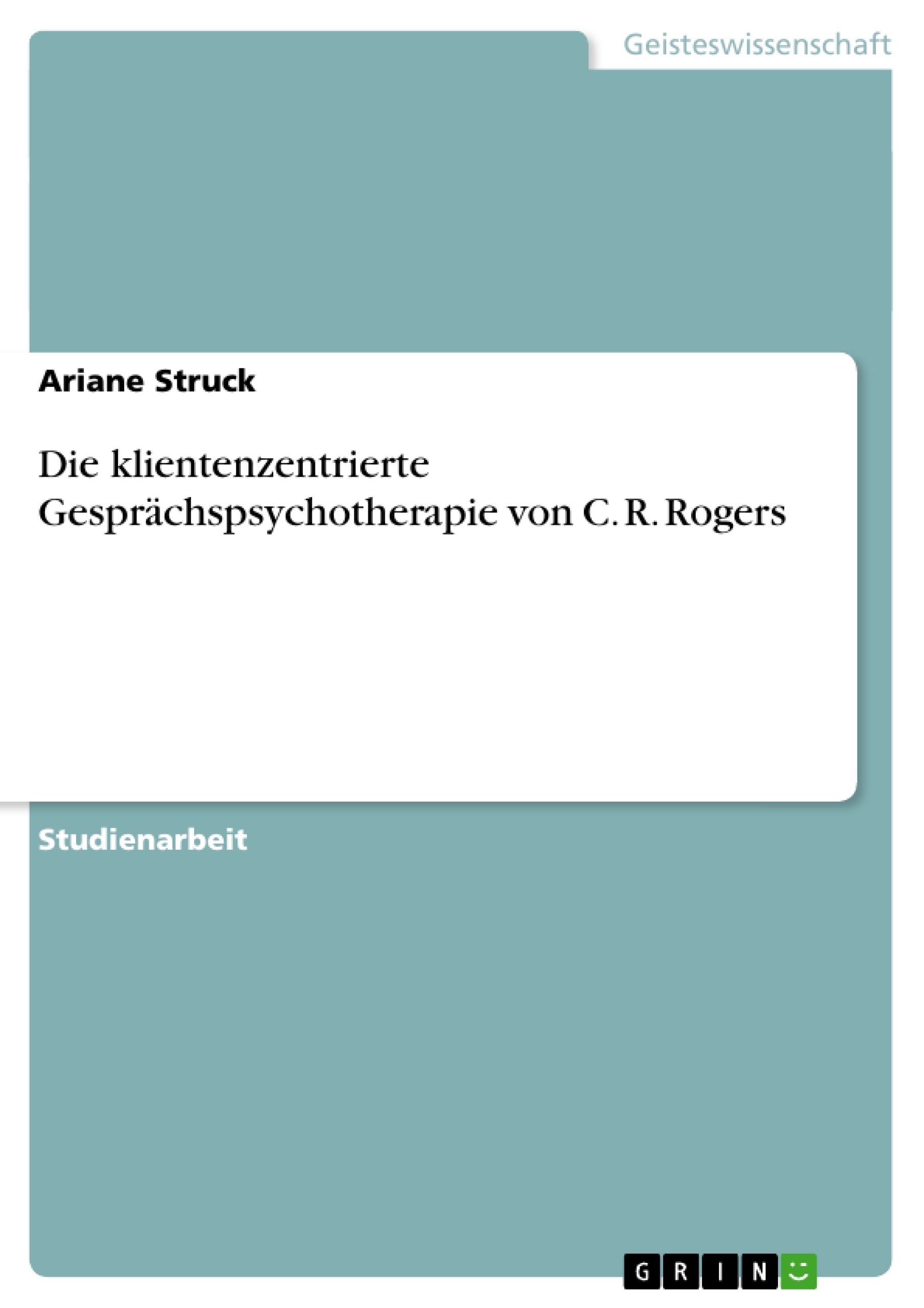1. Einleitung
"Die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie ist eine soziale Interaktion zwischen meist zwei Personen: einem Therapeuten/Berater und dem Klienten, wobei der Schwerpunkt auf sprachlicher Kommunikation liegt. Als hilfreich wird sie dann verstanden, wenn es dem Klienten allmählich gelingt, seine Probleme selbständig zu lösen und somit seine Beeinträchtigung im Erleben und Verhalten zu vermindern. Der Therapeut unterstützt und fördert diese Entwicklung durch bestimmte Verhaltensweisen, die die Selbstheilungskräfte im Klienten aktivieren sollen" (Sieland 1979).
Die Gesprächstherapie ist eine klientenzentrierte Behandlungsmethode der humanistischen Psychologie. Die nichtdirektive Gesprächstherapie geht auf Carl Rogers (1902-1987) zurück.
Rogers setzt eine angeborene Tendenz des Menschen zur Selbstverwirklichung voraus. Dabei umfaßt die Selbstverwirklichung die Erfüllung aller Bedürfnisse, die auf die Erhaltung oder Förderung des Einzelnen gerichtet sind. Jeder Mensch verfügt über einen angeborenen Bewertungsmaßstab, anhand dessen er einschätzen kann, was gut oder schlecht für ihn ist.
Nach Rogers entstehen psychische Probleme, wenn die natürliche Tendenz zur Selbstverwirklichung und das durch Erfahrung und Bewertung ausgebildete Selbstkonzept nicht übereinstimmen.
In der klientenzentrierten Gesprächstherapie, die von Echtheit, Wärme und Empathie auf Seiten des Therapeuten gekennzeichnet sein soll, spricht der Klient über die emotionalen Konflikte, die seine Selbstverwirklichung blockieren.
Nach Rogers wird mit Hilfe bestimmter therapeutischer Techniken, wie z. B. Widerspiegeln der Emotionen durch den Therapeuten oder vorsichtiges Interpretieren von Klientenäußerungen ein Prozeß in Gang gebracht, in dem sich die Klienten über bestimmte Gefühle und Gedanken Klarheit verschaffen, sie akzeptieren und in ihr Selbstkonzept integrieren können.
Mit diesem neuen, erweiterten Selbstkonzept ist es ihnen nun möglich, Verhaltensänderungen durchzuführen, die ihrerseits aber nicht Gegenstand der klientenzentrierten Gesprächstherapie sind (Microsoft Encarta 2000).
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Biographischer und historischer Hintergrund
- 3. Entwicklung der Gesprächspsychotherapie
- 4. Persönlichkeitstheorie
- 4.1 Persönlichkeitspsychologische Begriffe
- 4.2 Entwicklung des Selbstkonzepts
- 5. Fehlerentwicklung
- 6. Förderliches Therapeutenverhalten und seine Auswirkungen auf den Klienten
- 6.1 Echtheit (Kongruenz)
- 6.2 Wertschätzung
- 6.3 Empathie
- 6.4 Zusammenfassung der Therapeutenmerkmale
- 6.5 Selbstexploration des Klienten
- 6.6 Die Prozeß-Skala von Rogers
- 6.7 Die "fully functioning person"
- 7. Konsequenzen für Pädagogen
- 7.1 Klientenzentrierte Beratung
- 7.2 Schülerzentrierter Unterricht
- 8. Evaluation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieses Textes ist es, die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie nach Carl Rogers vorzustellen. Der Text beleuchtet die theoretischen Grundlagen, die Entwicklung der Therapiemethode und deren praktische Anwendung. Besonderer Fokus liegt auf dem Verständnis des therapeutischen Prozesses und der Rolle des Therapeuten.
- Biographischer und historischer Kontext der klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie
- Rogers' Persönlichkeitstheorie und die Konzepte von Selbstverwirklichung und Selbstkonzept
- Die Rolle des Therapeuten und förderliches Therapeutenverhalten (Echtheit, Empathie, Wertschätzung)
- Entwicklung von psychischen Problemen und der therapeutische Prozess
- Implikationen für pädagogische Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie ein und beschreibt sie als eine soziale Interaktion, in der der Klient seine Probleme selbstständig lösen lernt, unterstützt durch den Therapeuten, der die Selbstheilungskräfte aktiviert. Es wird die humanistische Grundlage der Therapie und die zentrale Rolle der Selbstverwirklichung nach Rogers hervorgehoben.
2. Biographischer und historischer Hintergrund: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung von Rogers' Theorie im Kontext sozialpsychologischer, psychoanalytischer und gestalttherapeutischer Einflüsse. Es zeigt die Abkehr von autoritären Therapieansätzen hin zu einer klientenzentrierten, beziehungsorientierten Herangehensweise, die die Selbstbestimmung und Unabhängigkeit des Klienten in den Vordergrund stellt. Rogers' persönliche Erfahrungen und die prägenden Einflüsse seiner Biografie werden ebenfalls diskutiert.
3. Entwicklung der Gesprächspsychotherapie: Das Kapitel beschreibt die Entwicklung der klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie in drei Phasen nach Seeman (1965). Es betont den Wandel von der "non-direktiven" Beratung zur Betonung der Persönlichkeitstheorie und schließlich zum Fokus auf das Therapeutenverhalten und dessen Einfluss auf den Therapieerfolg. Die Rolle des Vertrauens in die Selbstverantwortlichkeit des Klienten wird stets betont.
4. Persönlichkeitstheorie: Dieses Kapitel erläutert die grundlegenden Annahmen von Rogers' Persönlichkeitstheorie, die von einem positiven und konstruktiven Menschenbild ausgeht. Fehlentwicklungen werden auf ungünstige soziale Bedingungen zurückgeführt, die die angeborene Tendenz zur Selbstverwirklichung behindern. Das Kapitel legt die Basis für das Verständnis des therapeutischen Prozesses.
Schlüsselwörter
Klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie, Carl Rogers, Selbstverwirklichung, Selbstkonzept, Therapeutenverhalten, Echtheit, Empathie, Wertschätzung, humanistische Psychologie, non-direktive Therapie, Selbstheilungskräfte, psychische Probleme, Persönlichkeitsentwicklung, Pädagogische Anwendung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie nach Carl Rogers
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Dieser Text bietet einen umfassenden Überblick über die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie nach Carl Rogers. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und wichtige Schlüsselbegriffe. Der Fokus liegt auf den theoretischen Grundlagen, der Entwicklung der Therapiemethode und deren praktischen Anwendung, insbesondere der Rolle des Therapeuten und des therapeutischen Prozesses.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt folgende Themen: den biographischen und historischen Hintergrund von Carl Rogers und seiner Therapieform; die Entwicklung der klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie; Rogers' Persönlichkeitstheorie mit den Konzepten der Selbstverwirklichung und des Selbstkonzepts; die Rolle des Therapeuten und förderliches Therapeutenverhalten (Echtheit, Empathie, Wertschätzung); die Entstehung psychischer Probleme und den therapeutischen Prozess; und schließlich die Implikationen für die pädagogische Praxis.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Biographischer und historischer Hintergrund, Entwicklung der Gesprächspsychotherapie, Persönlichkeitstheorie (inkl. Persönlichkeitspsychologische Begriffe und Entwicklung des Selbstkonzepts), Fehlerentwicklung, Förderliches Therapeutenverhalten und seine Auswirkungen auf den Klienten (inkl. Echtheit, Wertschätzung, Empathie, Zusammenfassung der Therapeutenmerkmale, Selbstexploration des Klienten, die Prozeß-Skala von Rogers und die "fully functioning person"), Konsequenzen für Pädagogen (inkl. Klientenzentrierte Beratung und Schülerzentrierter Unterricht) und Evaluation.
Was ist die Zielsetzung des Textes?
Die Zielsetzung ist die Vorstellung der klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie nach Carl Rogers. Der Text beleuchtet die theoretischen Grundlagen, die Entwicklung der Therapiemethode und deren praktische Anwendung. Besonderer Fokus liegt auf dem Verständnis des therapeutischen Prozesses und der Rolle des Therapeuten.
Welche Rolle spielt der Therapeut in der klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie?
Der Therapeut spielt eine unterstützende Rolle. Er aktiviert die Selbstheilungskräfte des Klienten, anstatt Lösungen vorzugeben. Förderliches Therapeutenverhalten umfasst Echtheit (Kongruenz), Wertschätzung und Empathie. Der Therapeut hilft dem Klienten, seine eigenen Ressourcen zu entdecken und zu nutzen, um seine Probleme selbstständig zu lösen.
Welche Schlüsselbegriffe sind wichtig für das Verständnis der klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie, Carl Rogers, Selbstverwirklichung, Selbstkonzept, Therapeutenverhalten, Echtheit, Empathie, Wertschätzung, humanistische Psychologie, non-direktive Therapie, Selbstheilungskräfte, psychische Probleme und Persönlichkeitsentwicklung.
Welche Bedeutung hat die Persönlichkeitstheorie von Rogers für die Therapie?
Rogers' Persönlichkeitstheorie, die von einem positiven Menschenbild ausgeht, bildet die Grundlage für das Verständnis des therapeutischen Prozesses. Fehlentwicklungen werden auf ungünstige soziale Bedingungen zurückgeführt, die die angeborene Tendenz zur Selbstverwirklichung behindern. Die Therapie zielt darauf ab, diese Blockaden zu lösen und die Selbstverwirklichung zu fördern.
Welche Implikationen hat die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie für die Pädagogik?
Der Text diskutiert die Implikationen für die pädagogische Praxis, insbesondere die klientenzentrierte Beratung und den schülerzentrierten Unterricht. Es geht darum, die im therapeutischen Kontext gewonnenen Erkenntnisse auf die pädagogische Arbeit zu übertragen, um ein förderliches Lernumfeld zu schaffen.
- Quote paper
- Ariane Struck (Author), 2000, Die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie von C. R. Rogers, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/5099