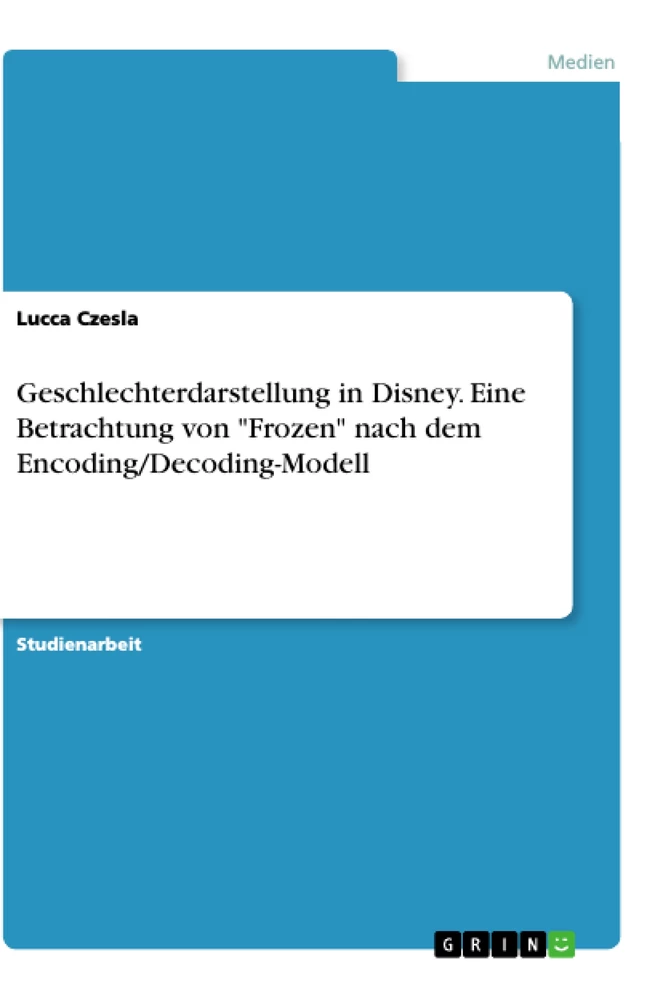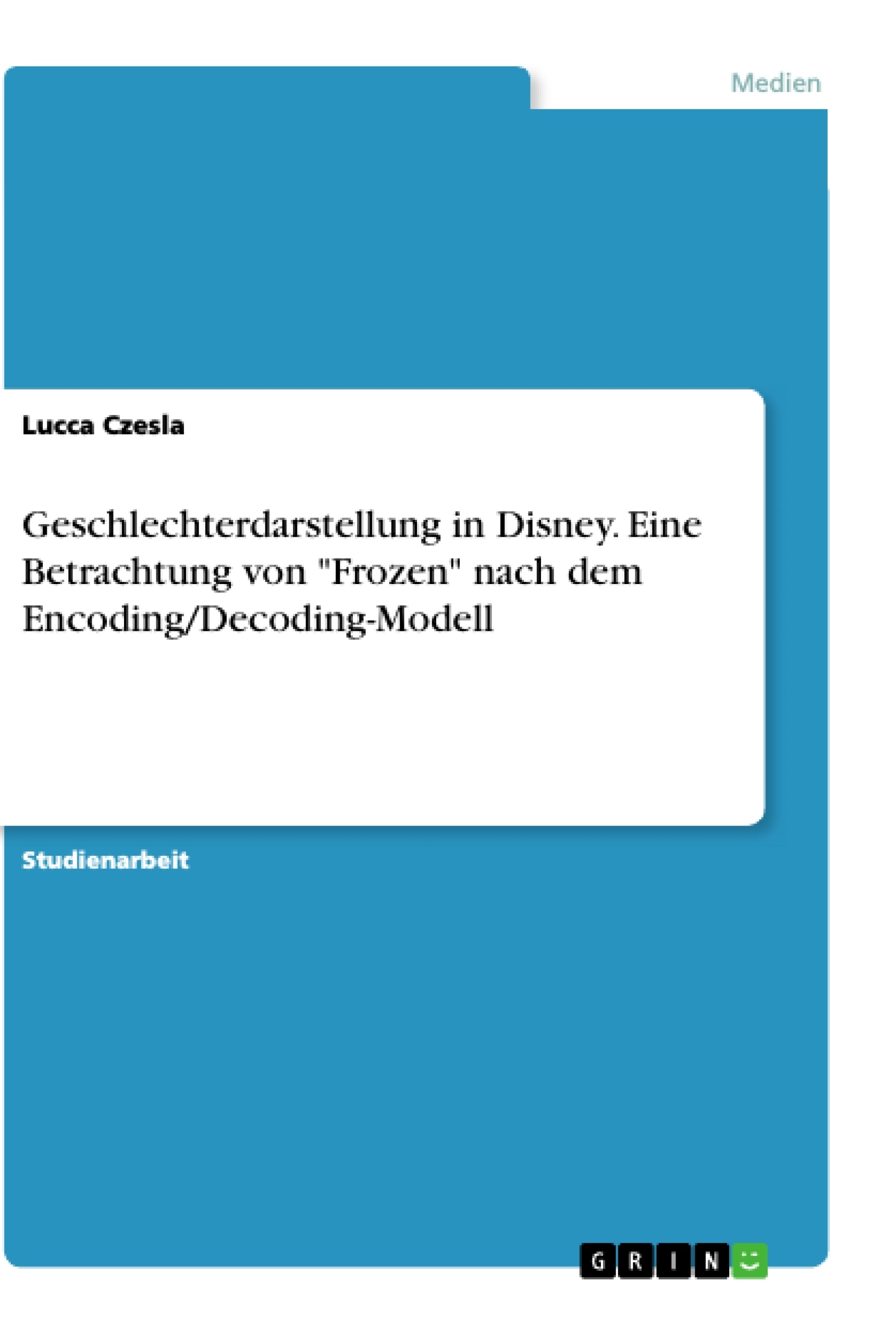Diese Arbeit untersucht unterschiedliche Lesarten des Animationsfilms "Frozen" in Bezug auf die repräsentierten Geschlechterrollen. Dabei wird auf das Encoding/Decoding-Modell Bezug genommen. Ziel der Arbeit ist es, einen Beitrag zum Verständnis der heterogenen Rezeption des Films und seiner Geschlechterdarstellung zu leisten und zu klären, mit welcher Begründung derselbe Film als feministisch und antifeministisch interpretiert werden kann.
Disney ist unbedenkliche Unterhaltung für die ganze Familie. Oder? Immer wieder werden kritische Stimmen laut, die unter anderem auf Disneys konservative Geschlechterrollen aufmerksam machen. Vor allem die Prinzessinnen-Marge des Konzerns, die durch ihre umsatzstarke Vermarktung weltweit in Kinderzimmern Einzug hält, steht in der Kritik. Wo die einen Märchen voller Magie und Phantasie sehen, verorten die anderen eine systematische Erziehung zu stereotypen Geschlechterrollen. Auch innerhalb der Rezeption des globalen Filmerfolgs "Frozen" scheiden sich die Geister: Ist Disneys jüngstes Prinzessinnen-Abenteuer eine Emanzipationsgeschichte, die sich von den üblichen "damsel-in-distress" Märchen abgrenzt oder transportiert der Film abgeschmackte Rollenklischees in neuer Verpackung?
Inhalt
1. Einleitung
2. Theoretischer Rahmen
2.1 Encoding/Decoding Modell nach Stuart Hall
2.2 Geschlechter-Stereotype
3. Disneys Codes: Motive und Geschlechterkonstitution in den Prinzessinnen-Filmen
4. Eine Betrachtung von Disneys „Frozen“ nach dem Encoding/Decoding Modell
4.1 Die dominant-hegemoniale Lesart
4.2 Die oppositionelle Lesart
4.3 Die ausgehandelte Lesart
5. Fazit
6. Anhang
7. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Disney ist unbedenkliche Unterhaltung für die ganze Familie. Oder? Immer wieder werden kritische Stimmen laut, die unter anderem auf Disneys konservative Geschlechterrollen aufmerksam machen. Vor allem die Prinzessinnen-Marge des Konzerns, die durch ihre umsatzstarke Vermarktung weltweit in Kinderzimmern Einzug hält, steht in der Kritik. Wo die einen Märchen voller Magie und Phantasie sehen, verorten die anderen eine systematische Erziehung zu stereotypen Geschlechterrollen. Auch innerhalb der Rezeption des globalen Filmerfolgs „Frozen“ scheiden sich die Geister: Ist Disneys jüngstes Prinzessinnen-Abenteuer eine Emanzipationsgeschichte, die sich von den üblichen „damsel-in-distress“ Märchen abgrenzt oder transportiert der Film abgeschmackte Rollenklischees in neuer Verpackung? Aus diesem Anlass fragt die folgende Arbeit: Welche Lesarten des Animationsfilms „Frozen“ kann es nach den dort repräsentierten Geschlechterrollen anhand des Encoding/Decoding Modells geben? Ziel der Arbeit ist es, einen Beitrag zum Verständnis der heterogenen Rezeption des Films und seiner Geschlechterdarstellung zu leisten und zu klären, mit welcher Begründung derselbe Film als feministisch und antifeministisch interpretiert werden kann.
Da Meinungen und Geschmäcker subjektiv sind und gerade bei der Rezeption dieses Textes eklatant auseinandergehen, wurden Blogeinträge, ebenso wie feuilletonistische und wissenschaftliche Artikel in die Untersuchung miteinbezogen. Es ist nötig, Disneys Codes zur Geschlechterkonstitution kennen zu lernen, da es um die Dekodierung derselben in unterschiedlichen Kontexten geht. Daher wird unmittelbar vor der spezifischen Betrachtung „Frozens“ ein Exkurs in die Geschlechterkonstitution der früheren Prinzessinnen-Filme Disneys unternommen. Um einen theoretischen Rahmen zu ziehen, wird im Folgenden eine Definition von Geschlechterstereotypen geliefert und das Encoding/Decoding Modell nach Stuart Hall beschrieben.
2. Theoretischer Rahmen
2.1 Encoding/Decoding Modell nach Stuart Hall
„Wer sagt was in welchem Kanal zu wem mit welchem Effekt?“ Die Lasswell-Formel - ein klassisches Modell für Massenkommunikation - wurde bereits Ende der 40er Jahre formuliert. Diesem Modell liegt ein Verständnis von Kommunikation zugrunde, das als Kreislauf oder Schleife beschrieben werden kann (vgl. Hall 1999: 92). Kommunikation wird als transparenter Informationstransport angesehen, bei dem sich die Nachricht auf dem Weg von Sender zu Empfänger nicht ändert (vgl. ebd.: 107).
Kulturtheoretiker und Mitbegründer der Cultural Studies Stuart Hall kritisiert dieses Verständnis von Kommunikation nicht nur - in den 70er Jahren entwirft er ein eigenes Kommunikationsmodell: das Encoding/Decoding Modell (siehe Anhang, Figur 1) (vgl. Krotz 2009: 211). Um eine Nachricht übertragen zu können, muss sie artikuliert, also kodiert werden. Um der Nachricht eine Bedeutung zu verleihen, muss sie vom Rezipienten angeeignet, also dekodiert werden (vgl. Hepp 2010: 116f). Hall betont, dass sich die Nachricht immer abhängig vom jeweiligen Kontext deuten lässt, also nicht unabänderlich übertragen wird. Für ihn steht die Deutung eines Textes in Zusammenhang mit der sozialen Klasse des Rezipienten (vgl. ebd.: 120).
„Text“ bezeichnet dabei „jedes kommunikative Produkt in seiner Gesamtheit“ (ebd.: 113). Das kommunikative Produkt wie beispielsweise der Film besteht aus Zeichen, denen immer mehrere Bedeutungen innewohnen. Hall verweist darauf, dass jedes Zeichen eine Denotation und eine Konnotation besitzt, wobei die konnotative Ebene bei der Analyse ins Gewicht falle. „Die Konnotation ist der Bereich, bei dem sich bereits kodierte Zeichen mit den semantischen Kodes einer Kultur kreuzen und somit zusätzliche ideologische Dimensionen annehmen“ (ebd.: 117). Beim Dekodieren eines Textes komme es also vor, dass mehrere Rezipienten - beeinflusst durch unterschiedliche soziale Kontexte - zu unterschiedlichen Interpretationen gelangen. Die eindeutige und feststehende Bedeutung eines Textes gibt es folglich nicht. Stuart Hall geht davon aus, dass sich der Rezipient einen Text auf drei unterschiedliche Arten aneignen kann. Im ersten Fall vertritt der Rezipient die dominant-hegemoniale Position. „(...) ,dominant‘, weil es ein Muster ,bevorzugter Lesarten‘ gibt: und diesen ist die institutionelle, politische und ideologische Ordnung einbeschrieben“ (Hall 1999: 103). Bei der dominant-hegemonialen Lesart kann man von transparenter Kommunikation sprechen, da der Rezipient „die konnotierte Bedeutung (...) voll und ganz übernimmt und die Nachricht im Sinne des Referenzkodes, in dessen Rahmen sie kodiert wurde, dekodiert (...)“ (Hall 1999: 107). Einfach ausgedrückt, kann man davon ausgehen, dass Produzent und Empfänger im selben Kontext agieren - Kodierungsund Dekodierungsprozess sind damit symmetrisch und der Inhalt wird so übertragen, wie er ursprünglich angelegt wurde.
Im zweiten Fall vertritt der Rezipient die ausgehandelte Position. Sie verbindet adaptive mit oppositionellen Elementen - was bedeutet, dass die „Legitimität der hegemonialen Definitionen“ zwar anerkannt wird, jedoch nicht uneingeschränkt übernommen bzw. akzeptiert wird (vgl. Hall 1999: 108f). Die Dekodierung wird an den sozialen Kontext des Empfängers angepasst und wiederspricht somit in einigen Punkten dem hegemonialen Referenzcode.
Im dritten Fall nimmt der Rezipient die oppositionelle Position ein. Dieser Rezipient erkennt die ursprüngliche Kodierung, versteht die konnotative Ebene des Medientextes, doch kann aufgrund seines sozialen Kontextes nicht mit der favorisierten Lesart übereinstimmen. „Diese Art von Rezipient zerlegt den Medientext im favorisierten Kode, um ihn anschließend innerhalb eines alternativen Bezugsrahmens wieder zusammenzubauen“ (Hepp 2010: 119).
Rainer Winter fasst die Rolle des Rezipienten innerhalb des Encoding/Decoding Modells wie folgt zusammen: „[Es] obliegt dem Rezipienten Informationen zu akzeptieren, zu hinterfragen oder gar zu verwerfen. Er ist selbst Bedeutungsschaffender, immer aus einem sozialen Kontext heraus als Produkt seiner Umwelt“ (1997: 6).
2.2 Geschlechter-Stereotype
Da sich die vorliegende Arbeit mit der Darstellung stereotyper Geschlechterrollen beschäftigt, ist es notwendig zu klären, was ein Stereotyp bzw. eine stereotype Darstellung ist.
Hans Hahn verweist in seinem Buch „Stereotyp, Identität und Geschichte“ auf eine Definition, die das Stereotyp als „[eine] schematisierte, auf relativ wenige Orientierungspunkte reduzierte, längerfristig unveränderte und trotz neuer oder sogar gegenteiliger Erfahrungen starre, verfestigte Vorstellung über spezifische Wesens- und Verhaltensmerkmale anderer Menschen oder Menschengruppen (...)“ beschreibt (Hahn 2002: 61). Stereotypisierung ist stark vereinfachtes Denken: vorgefertigte Schemata, die uns im Alltag helfen, Entscheidungen schneller zu treffen und Informationen möglichst effizient zu verarbeiten. Stereotypisierung kann auch als Vorverurteilung oder Generalisierung beschrieben werden.
In Bezug auf die Vorstellung von Geschlechterrollen präzisiert Thomas Eckes: „Geschlechterstereotype sind kognitive Strukturen, die sozial geteiltes Wissen über die charakteristischen Merkmale von Frauen und Männern enthalten.“ (2010: 178) Dabei gilt es zu beachten, dass dieses „geteilte Wissen“ sozial konstruiert und nicht biologischen Ursprungs ist, was bereits in den 70er Jahren durch die historisch orientierte Frauenforschung dargelegt wurde (vgl. Villa 2010: 146). Nichtsdestotrotz dominiert die konservative Vorstellung vom Dualismus der Geschlechter auch mehr als 40 Jahre danach: „traditionelle Annahmen darüber, wie Frauen und Männer sind, welche Eigenschaften sie haben und wie sie sich verhalten“ (Eckes 2010: 178). Laut Eckes liegt „die Betonung beim Geschlechterrollenkonzept auf den sozial geteilten Verhaltenserwartungen (...)“ (ebd.: 178). In diesem Fall wird die Stereotypisierung von der reinen Annahme über Verhaltensweisen durch eine Erwartung dieser erweitert. Wird diese Erwartung nicht erfüllt, erfolgt „in der Regel Ablehnung oder Bestrafung“ (Eckes 2010: 178). In diese Kategorie fallen auch die negativ belegten Substereotype wie zum Beispiel „die Karrierefrau“, die sich über kompetitiven Ehrgeiz charakterisiert und oft als wenig feminin angesehen wird. In seiner „Taxonomie von Geschlechterstereotypen“ beschreibt Eckes die vier gängigen Stereotyp-Kategorien und ihre Stellung innerhalb der Gesellschaft (siehe Anhang, Figur 2) (vgl. ebd.: 182). Alle vier ergeben sich aus einer Kombinationen aus hoher bzw. niedriger Wärme und hoher bzw. niedriger Kompetenz.
Das „bewundernde Stereotyp“ wird als warm und kompetent beschrieben und ist sowohl bei Männern als auch bei Frauen anerkannt. Das „verachtende Stereotyp“ wird als kalt und inkompetent charakterisiert und stößt sowohl bei Männern als auch bei Frauen auf Ablehnung - typische Beispiele sind „der Prolet“ und „die Spießerin“ (vgl. ebd.: 182). Interessant für die Konstitution von Rollenbildern sind jedoch die beiden traditionellen Stereotype.
Das „paternalistische Stereotyp“ kann als traditionelles Frauenstereotyp angesehen werden (vgl. ebd.: 180). Es definiert sich über einen hohen Grad an Wärme, gepaart mit wenig Kompetenz, einem niedrigen Status und einer kooperativen Interdependenz „in häuslichfamiliären und partnerschaftlichen Kontexten“ (ebd.: 180). Ein Stereotyp das bei Frauen auf gesellschaftliche Akzeptanz stößt, bei Männern jedoch auf Ablehnung. Als Beispiel für einen männlichen Vertreter des paternalistischen Stereotyps nennt Eckes „den Softie“, der sich durch „feminine“ Eigenschaften auszeichnet und damit als „unmännlich“ gilt.
Das „neidvolle Stereotyp“ kann als traditionelles Männerstereotyp angesehen werden (vgl. ebd.: 180). Es definiert sich über einen hohen Grad an Kompetenz gepaart mit mangelnder Wärme. Das neidvolle Stereotyp genießt einen hohen Status und besitzt gerade im beruflichen Kontext eine kompetitive Interdependenz. Während das neidvolle Männerstereotyp Ansehen besitzt, werden Frauen dieser Kategorie - wie etwa „die Karrierefrau“ - als kalt und „unweiblich“ beschrieben und negativ konnotiert (vgl. Eckes 2000: 211).
Zur Stereotypisierung in den Medien hält Martina Thiele fest: „Obwohl zuweilen traditionelle Geschlechterrollen in Frage gestellt werden (...), bleibt das System der Zweigeschlechtlichkeit erhalten bzw. wird permanent reproduziert“ (2015: 235). Laut Thiele werden insbesondere Frauen sowohl visuell als auch inhaltlich „in einem sehr engen Rollenspektrum und in letztlich stereotyper Art und Weise“ dargestellt (ebd.: 234).
Dabei spielt das visuelle Erscheinungsbild eine tragende Rolle: die ideale Frau sei „jung, straff, glatt, sexy, nicht zu intelligent, dem männlichen Blick ein Wohlgefallen“ (Kugelmann 1996: 135). Die Frau wird in den Medien überwiegend objektifiziert und als handlungsauslösendes Motiv für männliche Protagonisten genutzt (vgl. Seier 2007: 22). Ihre stereotype Rolle umfasst Passivität (die mit mangelnder Handlungskompetenz einhergeht) und Attraktivität. Gleichzeitig dominiert die Vorstellung, Kraft und Dominanz seien in einem besonders „männlichen“ Erscheinungsbild verkörpert. Positiv konnotiert sind bei männlichen Protagonisten breite Schultern, schmale Hüften, muskulöse Arme und ein dicker Nacken. Damit wird die Vorstellung von „Männern als Besitzer der Macht“ und „Frauen als Objekt des Begehrens“ in bestimmte Körperbilder übertragen, visualisiert und durch die Medien reproduziert. (vgl. Kugelmann 1996: 28, Seier 2007: 22).
3. Disneys Codes: Motive und Geschlechterkonstitution in den Prinzessinnen-Filmen
Die Prinzessinnen-Marge ist das finanzielle Zugpferd des Disney-Konzerns (vgl. Lopez 2016: 8). Die vermeintlich harmlosen Geschichten über Schneewittchen, Cinderella oder Dornröschen gelten als familienfreundliche Unterhaltung und werden seit Jahrzenten schon den ganz kleinen Kindern bedenkenlos vorgeführt. Dabei sind es gerade diese klassischen Prinzessinnen-Filme, die unaufhörlich in der Kritik stehen, stereotype Geschlechterrollen zu vermarkten (vgl. Booker 2010: 176; Maity 2014: 1).
Disneys Prinzessinnen sind jung, schön und müssen gerettet werden. Die Prinzen sind muskulöse Helden, die für ihre Prinzessin kämpfen um sie zu erretten. Prinzen wählen ihre Prinzessin nach Äußerlichkeiten aus - Liebe passiert auf den ersten Blick. Sobald sie erwählt wurden, verlieben sich auch die Prinzessinnen schlagartig. Die Antagonisten sind hässlich, denn hier gilt: Aussehen gleich Charakter. Vermehrt werden Bösewichte von alten und aktiv handelnden Frauen verkörpert. Der wahren Liebe Kuss rettet vor allem Übel und das Ziel eines solchen Märchens ist die heterosexuelle Liebe. Grob lassen sich so die Hauptmotive von Disneys Prinzessinnen-Filmen zusammenfassen, die die Grundlage ihrer Geschlechterkonstruktion bilden (vgl. Nyh 2015; Lopez 2016).
Um die Darstellung der Disney-Geschlechterrollen genauer untersuchen zu können, haben England, Descartes und Collier-Meek in ihrer Publikation „Gender Role Portrayal and the Disney Princesses“ eine Liste „traditionell maskuliner“ und „traditionell femininer“ Eigenschaften zusammengestellt. Maskuline Eigenschaften in den Prinzessinnen-Filmen sind demnach: Abenteuerlust, körperliche Stärke, Unabhängigkeit, Mut, Durchsetzungsfähigkeit, Emotionslosigkeit und Intellekt. Männliche Protagonisten nehmen damit die Anführer- und Helden-Rolle ein. Weibliche Protagonisten werden dagegen in der Opferrolle dargestellt. Feminine Eigenschaften sind den maskulinen fast direkt gegenübergestellt: körperliche Schwäche, Unterwürfigkeit, Emotionalität, Sensibilität, Hilfsbereitschaft, Mütterlichkeit (vgl. England/Descartes/Collier-Meek 2011: 4ff). Um Disneys Codes zur Geschlechterkonstruktion besser kennen zu lernen, lohnt sich ein Blick auf die dargestellten Rollen der vergangenen Jahre. Dabei kann man die Filme und ihre geschlechterspezifischen Darstellungen in drei Entwicklungsstadien einordnen (vgl. Azmi 2016: 2f).
Dem ersten Stadium werden Schneewittchen, Cinderella und Dornröschen zugeordnet. Die Filme sind zwischen 1937 und 1959 entstanden. Diese Prinzessinnen nehmen gänzlich passive und hilflose Rollen an. Schneewittchen und Cinderella kommen häuslichen Pflichten nach, um in der (Film-)Gesellschaft akzeptiert zu werden. Dornröschens Rolle ist handlungsunfähig, da sie schläft. Bis auf gewisse Äußerlichkeiten gleichen sich die Figuren: sie sind geduldig, mütterlich, ordnen sich unter und sind nicht in der Lage, für ihr eigenes Glück aktiv zu werden. Die aktiven weiblichen Rollen sind alte, hässliche Antagonisten, die als warnendes Beispiel dienen (vgl. Nyh 2015: 24). Trotz (oder gerade wegen) gänzlicher Passivität kommt es für die braven Hausfrauen zu einem Happy End. Sie werden alle von charmanten, muskulösen und gutaussehenden Helden gerettet. Mit dieser Konstellation werden die traditionellen Geschlechterstereotype vom Mann als heroisches Subjekt mit einem hohen Grad an Kompetenz und der Frau als begehrenswertes Objekt mit einem hohen Grad an Wärme reproduziert.
Dem zweiten Entwicklungsstadium der Disney-Prinzessin werden Arielle, Belle, Jasmin, Pocahontas und Mulan zugeordnet. Die Filme entstanden zwischen 1989 und 1999. Diese Rollen sind mutiger, entschlossener und abenteuerlustiger angelegt als die ihrer Vorgängerinnen. Sie vereinen also wie oben beschrieben eher maskuline Eigenschaften in sich. Interessanterweise werden diese Prinzessinnen für ihren Drang nach Unabhängigkeit innerhalb der jeweiligen Plots der Filme bestraft. Sie stoßen auf gesellschaftliche Ablehnung und es wird suggeriert, dass das einzige Ziel einer Frau der Mann sein sollte. Anstatt diese Botschaft zu tradieren, finden die Prinzessinnen ihr Glück schlussendlich durch einen Mann (vgl. Maity 2014: 3). Auch die finale Rettung wird in den Filmen des zweiten Entwicklungsstadiums weiterhin von den männlichen Protagonisten vollführt. Prinzessinnen der zweiten Entwicklungsstufe werden zwar aktiv und vereinen maskuline Eigenschaften in sich, letztlich werden diese jedoch an konservative Normen angepasst.
Zur dritten Entwicklungsstufe gehören laut Azmi die Prinzessinnen aus den Filmen seit 2009: Merida, Tiana, Rapunzel und die Schwestern Anna und Elsa. Sie sind willensstark, mutig und werden von den männlichen Protagonisten nur minimal unterstützt (vgl. Azmi 2016: 2). Gerade die Rollen der männlichen Protagonisten sind hier weniger Kompetent angelegt als die ihrer Vorgänger - sie vereinen mehr stereotypisch „feminine“ Eigenschaften in sich. Nyh beschreibt die Protagonistinnen der dritten Entwicklungsstufe als selbstbewusste und entschlossene Prinzessinnen, die die Führung übernehmen und zu aktiven Heldinnen werden (vgl. 2015: 28).
Die Geschlechterkonstitution innerhalb der Disney-Prinzessinnen Filme entwickelt sich also. Ihre Entwicklung unterliegt allerdings dem gesellschaftlichen Mainstream. Da die Filme einer möglichst breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen und auf weltweiten Erfolg ausgerichtet sind, gilt es, Diskussionen über strittige Inhalte zu vermeiden (vgl. Azmi 2016: 2). Mit Disneys Prinzessinnen-Film „Frozen“ - dem bisher größtem finanziellen Erfolg dieser Marge - ist jedoch genau der zu vermeidende Fall eingetreten. Seit 2013 können sich Rezipienten des Films „Frozen“ (dt. „Die Eiskönigin - völlig unverfroren“) nicht über die Interpretation der dargestellten Geschlechterrollen einigen (siehe Anhang, Figur 3).
4. Eine Betrachtung von Disneys „Frozen“ nach dem Encoding/Decoding Modell
„Frozen“ ist ein Disney Märchen, das sich lose an Hans Christian Andersens „Die Schneekönigin“ anlehnt. Die Protagonistinnen sind Prinzessin Anna und ihre große Schwester Thronfolgerin Elsa von Arendelle. Elsa lebt seit ihrer frühen Kindheit zurückgezogen, da sie die Zauberkraft besitzt, Schnee und Eis zu erschaffen. Sie lebt in der Angst, anderen Menschen Leid zuzufügen, da sie ihre Kräfte nicht kontrollieren kann. Am Tag ihrer Krönung öffnen sich deshalb zum ersten Mal seit Jahren die Tore des Schlosses um ein großes Fest zu feiern. Ihre einsame Schwester Anna nutzt die Gunst der Stunde um die „wahre Liebe“ auf den ersten Blick zu finden. Sie lernt „Prinz Hans von den Südlichen Inseln“ kennen und bittet ihre Schwester am selben Abend, ihn heiraten zu dürfen. Elsa wird wütend (da sie der Meinung ist, man heiratet niemanden, den man nicht kennt) und kann ihre Kraft nicht mehr kontrollieren - ungewollt zaubert sie ewigen Winter über das Königreich. Verstört flieht sie in die Berge um dort zu bemerken, dass sie endlich frei von den Zwängen und der Angst vor ihren Kräften ist. Sie erschafft sich ein gewaltiges Schloss aus Eis und verwandelt sich von der verschlossenen, ängstlichen Prinzessin in die leuchtende und selbstbewusste Eiskönigin. Währenddessen begibt sich Anna auf die Suche nach ihrer Schwester. Auf dem Weg trifft sie den Eislieferanten Kristoff, den sie dafür bezahlt, sie mit seinem Rennschlitten auf den Berg zu fahren. Bei der Begegnung zwischen den Schwestern trifft Elsa Anna ausversehen mit einem Eisblitz ins Herz. Anna kann jetzt nur noch durch „wahre Liebe“ gerettet werden, sonst erstarrt sie zu einer Eisstatue. Als Anna daraufhin schwach nach Arendelle zurückkehrt um ihren Verlobten Hans zu küssen, entpuppt sich dieser als Bösewicht. Er schließt Anna ein, um sie sterben zu lassen und selbst den Thron besteigen zu können. Das große Finale besteht daraus, dass Anna sich für ihre Schwester opfert. Hans ist im Begriff, Elsa mit seinem Schwert zu erschlagen - doch Anna wirft sich im letzten Moment ihres Lebens dazwischen, erstarrt zur Eisstatue und das Schwert zerbricht. Elsa umarmt die Statue und weint um ihre tote Schwester, woraufhin diese wieder zum Leben erweckt wird. Die wahre Schwestern-Liebe hat beide gerettet. Das Happy End besteht aus Anna, die Hans mit ihrer Faust zu Boden streckt, Elsa, die als beliebte Königin über Arendelle herrscht und einem Kuss zwischen Kristoff und Anna, die sich ineinander verliebt haben (vgl. Frozen 2013).
Die Entwicklung der Disney Prinzessin über die Zeit wird in der Rezeption gerne als vertikal verlaufende Linie beschrieben: von der passiven Hausfrau Schneewittchen zur unabhängigen Superheldin Elsa (vgl. Nyh 2015: 2). Auch Aussagen über Anna und Elsa als erste feministische Disney-Prinzessinnen wurden laut (vgl. Verzuh 2014). Dem gegenüber steht eine Minderheit, die nicht mit dieser favorisierten Lesart übereinstimmt. Die oppositionelle Position zerlegt den Medientext im favorisierten Code und setzt ihn als antifeministische Interpretation wieder zusammen. Dazwischen steht das ausgehandelte Lager - diese Gruppierung sieht den Fortschrittsgedanken bezüglich der Geschlechterdarstellung innerhalb des Films, äußert sich allerdings kritisch über dessen Umsetzung, die postfeministisch anmute. Im Folgenden wird die gespaltene Rezeption anhand des Encoding/Decoding Modells nach Stuart Hall genauer betrachtet.
4.1 Die dominant-hegemoniale Lesart
„Frozen“ wird bei der Mehrheit seiner Rezipienten für seine feministische Botschaft gefeiert. Das Disney-Märchen tradiere die traditionellen Motive der Prinzessinnen-Filme und zeige dabei zwei starke, weibliche Heldinnen (vgl. Rudloff 2016: 2). Schwesternschaft werde in dieser Geschichte über die romantische Liebe gestellt, das Konzept der „Liebe auf den ersten Blick“ sogar offen innerhalb des Films kritisiert und der Bösewicht der Geschichte ist keine hässliche, alte Frau, sondern ein schöner, junger Prinz (vgl. Nyh 2015: 30). In „Frozen“ wird keine einzige Rettung von einer männlichen Rolle vollführt und es gibt auch keine Hochzeit am Ende. Männliche Figuren sind als Nebenrollen oder „Sidekicks“ angelegt (vgl. Münster 2016). Damit breche der Film mit Disneys traditionellen Leitmotiven, welche ebenso die Grundlage für die konservative Geschlechterkonstitution innerhalb der Filme darstellen. Zentral für die pro-feministische Auslegung des Films sind die beiden weiblichen Hauptrollen. Autorin Claudia Münster führt auf ihrem Blog aus, wieso sie Elsa für ein großartiges Vorbild für junge Mädchen hält. Elsa sei eine Königin, keine Prinzessin - eine komplexe Persönlichkeit mit Ecken und Kanten, die mit inneren Konflikten kämpfe. Ihre Geschichte sei nicht die Suche nach der wahren Liebe, sondern die Suche nach sich selbst (vgl. Münster 2016). Auf ihrem Weg müsse sich Elsa ihren Ängsten stellen und lernen, sich selbst so zu akzeptieren wie sie ist - auch wenn das den „Ausbruch aus den gesellschaftlichen Konventionen“ bedeute (ebd.). Am Ende findet sie ihren Platz und wird so akzeptiert wie sie ist - „mit all ihren Facetten, ihrer Magie, ihren Fähigkeiten und ihren Emotionen (...)“ (ebd.). Laut Münster ist Elsas Happy End - ohne Traumprinz aber mit der Schwester an ihrer Seite - das lohnende Ergebnis ihrer Sinnsuche (vgl. ebd.). Elsas magische Kräfte verleihen der Figur Macht. „Frozen“ zeige im Gegensatz zu seinen Disney-Vorgängern, dass Macht und Unabhängigkeit nicht automatisch böse und unweiblich machen. „Frozen“-Fan und Bloggerin Kristin Urban sieht diese Schlussfolgerung in Elsas Verwandlungsszene manifestiert. Elsa flieht in die Berge und merkt, dass sie endlich frei von allen Zwängen sein kann. Sie singt das Lied „Let it Go“, indem es um Selbstakzeptanz geht und verwandelt sich in eine glitzernde Eiskönigin. Für Urban ist das der Moment, in dem die Figur ihre Macht erkennt und akzeptiert. Mit ihrer optischen Veränderung zeige Elsa, dass Selbstbewusstsein wunderschön mache (vgl. Urban 2014).
Auch Anna wird nicht als stereotype Disney-Prinzessin wahrgenommen. Sie sei impulsiv, furchtlos, optimistisch aber ganz und gar nicht perfekt (vgl. Verzuh 2014). Als es darum geht, ihre Schwester aus den Bergen zurückzuholen, reitet Anna alleine in den Schneesturm. Sie übernimmt die aktive Rolle und überwindet jegliche Hindernisse. Zu Beginn des Films möchte sie Prinz Hans heiraten, den sie erst einige Stunden kennt - damit entspricht sie zuerst dem Disney-Klischee. Während des Films entwickelt sich Anna jedoch zur furchtlosen Heldin, die die Finale Rettung ihrer Schwester vollführt. Außerdem wird das Motiv der „Liebe auf den ersten Blick“ anhand von Anna und Hans tradiert, als Hans sich als Bösewicht entpuppt. Die klare Botschaft: Man kann niemanden mit einem Blick kennen und lieben lernen. Nachdem Anna ihre Schwester gerettet hat, schlägt sie Hans mit der Faust zu Boden, was von Impulsivität und körperlicher Stärke zeugt. Annas Stärke, ihre Abenteuerlust, Mut und Durchsetzungsfähigkeit sind traditionell maskuline Eigenschaften, die durch ihre Emotionalität und Schusseligkeit ergänzt werden. Das mache Anna zu einer ungewöhnlich nahbaren Heldin (vgl. ebd.).
Mit diesen weiblichen Heldinnen und den männlichen Nebenrollen entsprechen die Geschlechterrollen in „Frozen“ nach der dominant-hegemonialen Lesart unkonventionellen Charakteren. Außerdem besteche der Film durch die feministische Botschaft der Frauen-Power.
4.2 Die oppositionelle Lesart
Als Grundlage für die oppositionelle Lesart der Geschlechterdarstellung in „Frozen“ dient der Text „The problem with false feminism“ von Dani Colman. Innerhalb der Rezeption von „Frozen“ wird immer wieder Bezug darauf genommen und Argumente daraus zitiert.
Colman deutet beispielsweise darauf hin, dass es in „Frozen“ zwar zwei mit weiblichen Figuren besetze Hauptrollen gibt - im Gegensatz zum Original „Die Schneekönigin“ von Hans Christian Andersen sind das jedoch die einzigen weiblichen Rollen (vgl. 2014). Colman fragt sich, wieso Anna unbedingt einen männlichen Begleiter auf ihrer Mission benötigt. Sie kommt zu dem Schluss, dass der einzige Grund dafür die unvermeidlich heterosexuelle Liebesgeschichte sei (vgl. ebd.). Mit dem Kuss zwischen Kristoff und Anna wird das Motiv der heterosexuellen Liebe am Ende bestätigt. Dass keine Hochzeit gezeigt werde, sei laut Colman nichts Außergewöhnliches, da es in den wenigsten Disney-Filmen zur Hochzeit komme (siehe Anhang, Figur 4).
Im Gegensatz zu Anna besteht Elsas Happy End nicht aus der Erfüllung ihrer romantischen Wünsche, sondern daraus, dass sie lernt mit ihren Kräften umzugehen und als Königin über Arendelle herrschen kann. Innerhalb der dominant-hegemonialen Lesart wird das als progressive Alternative zur traditionellen Disney-Liebesgeschichte gedeutet. Coleman hingegen argumentiert, dass Elsa im Film als Antagonist fungiert und Antagonisten in Disney- Filmen traditionell kein romantisches Happy End bekommen. Auch das viel gelobte Motiv der Schwesternliebe, das Anna und Elsa im Finale rettet und damit die Verbindung zweier Frauen über die Kraft der romantischen Liebe stellt, sei nicht progressiv, sondern ein traditionelles Disney-Motiv für Familien-Bande (vgl. ebd.).
Die beiden weiblichen Hauptrollen sind für Colman keine starken Heldinnen. Anna sei schön und schusselig. Diese Schusseligkeit habe allerdings keine Auswirkung auf den Verlauf der Handlung und Anna müsse sie auch nicht überwinden um eine Charakterentwicklung zu durchleben. Colman folgert daraus, dass diese Charaktereigenschaft eine MarketingEntscheidung sei, um die Figur sympathischer zu gestalten. Sympathie, die daraus gewonnen werde, dass man der Protagonistin ihre Kompetenz abspricht. Auch ihre mangelnde Intelligenz falle unter diesen Aspekt. Anna will einen Mann heiraten, den sie nicht kennt. Außerdem sei es fahrlässig, bei einem Schneesturm nach der Schwester zu suchen und dabei keinen Mantel zu tragen (vgl. Colman 2014). Wenn Disney mit Anna also eine Identifikationsfigur für junge Mädchen und Frauen schaffen möchte, legen sie nach Colmans Einschätzung eine warmherzige aber inkompetente Rolle an. Dieses Vorgehen entspricht der weiblich-paternalistischen Stereotypisierung in den Medien. Hinzu kommt Colmans Schlussfolgerung, die Figur der Anna weise keine Ambitionen auf, außer den Mann fürs Leben zu finden. Das mache sie zu einem Anti-Vorbild für junge Mädchen (vgl. ebd.).
Auch die dominant-hegemoniale Auslegung, dass Elsa als Vorbild diene, da sie lerne, sich als Individuum zu akzeptieren, lehnt Colman ab. Es sei nicht die Selbstfindung, die Elsas Geschichte zeichne, sondern die Isolation. Die Abschottung von ihrer Umwelt bezeichnet Colman als „pathologisch“ (vgl. ebd.). Ihr Charakter sei gezeichnet von Selbsthass und Vermeidung, ihre Strategie mit Problemen umzugehen sei es, wegzulaufen. Das mache Elsa zu einer schwachen, verwundbaren Figur mit anti-sozialer Persönlichkeitsstörung (vgl. ebd.). Von Colmans Bewertung ausgehend ist die Figur der Elsa zwischen dem „Neidvollen“ und dem „Verachtenden Stereotyp“ angelegt, da sie ein kalter Charakter mit Intelligenz, jedoch ebenso inkompetent ist. Damit würde sich die Rolle der Eiskönigin innerhalb der negativ belegten weiblichen Stereotypen bewegen. Darüber hinaus werde Elsas Akt der „Selbstverwirklichung“ mit einem Umstyling gleichgesetzt, das die Figur hypersexualisiere (vgl. Rudloff 2016: 12).
4.3 Die ausgehandelte Lesart
Laut Rudloff ist es gerade dieses Umstyling, welches das postfeministische Gedankengut des Films enttarne, da das „Makeover“ zum Inbegriff postfeministischer Medienproduktionen geworden sei (vgl. ebd.). Elsas entfesselte Kraft spiegelt sich in einem glitzernden, hautengen Kleid wieder, das einen Schlitz bis zum Oberschenkel beinhaltet und ihr eine Vespentaille zaubert. Sie verwandelt sich zwar nicht, um einem Mann zu gefallen. Trotzdem impliziere diese Verwandlung, dass die Macht einer Frau in ihrem Aussehen zentralisiert sei (vgl. ebd.). Dieser umstrittene Aspekt des Postfeminismus könne als ähnlich geschmacklos angesehen werden wie reiner Sexismus - es reduziere die weibliche Rolle auf Äußerlichkeiten und degradiere sie zum Objekt (vgl. No 2015). Bei der ausgehandelten Lesart ist es hauptsächlich die Darstellung stereotyper Körperbilder, die auf Kritik stößt. Hans‘ und Kristoffs Erscheinungsbilder sind idealisiert männlich gezeichnet. Sie sind merklich größer als die weiblichen Rollen und vor allem Kristoff ist überdimensional muskulös. Anna und Elsa haben riesige Augen, volle und rot bemalte Lippen und unrealistisch dünne Taillen (vgl. Rudloff 2016: 6). Damit werden die traditionellen Stereotype der starken Männer und sexy Frauen optisch aufgegriffen.
Innerhalb der ausgehandelten Position wird die Legitimität der hegemonialen Definition von „Frozen“ als Disney-Märchen mit feministischer Botschaft grundsätzlich anerkannt. Allerdings werde das feministische Ideal des „Empowerment“ durch die postfeministische Idee von „Macht durch Aussehen“ korrumpiert (vgl. ebd.: 17). Mit direktem Bezug auf Dani Colmans oben skizzierte Ausführungen, antwortet Rhiannon Thomas, dass „Frozen“ insgesamt trotzdem ein Film mit feministischer Botschaft und komplexen Charakteren sei. Dies sei nicht der Fall weil die weiblichen Charaktere von Anfang an selbstbewusst und kompetent seien, sondern weil sie es im Laufe des Filmes lernen würden und jede eine Charakterentwicklung durchlebe (vgl. Thomas 2014). Im Gegensatz zu Colmans Ansicht, Annas einziges Ziel sei es, den Mann fürs Leben zu finden, sieht Thomas ihre Prioritäten in der Rettung von Elsa und Arendelle. Dabei mache sie zwar ein paar Fehler, etabliere sich allerdings als handelnde Heldin (vgl. ebd.). Thomas stimmt Colman zu, dass Elsas Vermeidungsstrategie als pathologisch betrachtet werden kann. Allerdings tradiere dies gängige Geschlechterstereotype. Elsa als Charakter mit einer psychischen Erkrankung anzulegen, könne jungen Menschen mit ähnlichen Problemen als Inspiration dienen. Thomas proklamiert, dass die Darstellung mentaler Probleme nicht als Schwäche bezeichnet werden dürfe. Für sie ist „Let it Go“ eine Hymne darüber, das Leben in die eigene Hand zu nehmen, und seinen Gefühlen und ihrer Magie freien Lauf zu lassen (vgl. ebd.). Allerdings wird argumentiert, dass dieser Botschaft ohne hypersexualisierendes „Makeover“ mehr Aufmerksamkeit geschenkt geworden wäre (vgl No 2015).
5. Fazit
In der vorliegenden Arbeit wurde die Geschlechterdarstellung in Disneys „Frozen“ anhand des Encoding/Decoding Modells nach Stuart Hall betrachtet. Die heterogene Rezeption des Films kann danach in drei Kategorien unterteilt werden. Durch die dominant-hegemoniale Lesart werden „Frozens“ Codes als feministisch dekodiert und die Konstitution der Charaktere als unkonventionell. Durch die oppositionelle Lesart werden die Codes des Films als antifeministisch und die Charaktere als stereotyp dekodiert. Innerhalb der ausgehandelten Lesart wird eingeräumt, dass „Frozen“ nicht frei von optischen Stereotypen sei. Allerdings würden gerade die weiblichen Protagonisten mit diversen Charaktereigenschaften ausgestattet, die traditionellen Stereotypen wiedersprechen und die progressive Entwicklung der Disney- Prinzessin aufzeigen.
Jede der Positionen kann Belege für ihre jeweiligen Argumente Vorbringen - keine kann als ultimativ „falsch“ oder „richtig“ bewertet werden. Für Stuart Hall ist es eine Frage des Kontexts wie ein Text dekodiert und bewertet wird. Diese Aussage trifft auf die Rezeption von „Frozen“ voll und ganz zu. Somit konnte geklärt werden, wie derselbe Film durch unterschiedliche Lesarten als feministisch, postfeministisch und antifeministisch interpretiert werden kann.
6. Anhang
Figur 1
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Stuart Halls Encoding/Decoding Modell
Figur 2
Tabelle: Eine Taxonomie von Geschlechterstereotypen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Thomas Eckes ‘ Taxonomie der vier Kategorien, in die sich Geschlechterstereotype einordnen lassen.
Figur 3
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Seite eins der Google Suche nach den Begriffen „ Disney “ „Frozen “ und „ Feminismus Die Pfeile verweisen auf den Inhalt der aufgelisteten Internetseiten - aufgeteilt nach Stuart Halls Encoding/Decoding Modell. (Trotz hier nur teilweise lila-gefärbten Ergebnissen, wurde selbstverständlich jede Seite auf ihren Inhalt überprüft.)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Figur 4
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Colmans Auflistung der Disney-Hochzeiten.
7. Literaturverzeichnis
Azmi, Jijidiana (2016) Gender and Speech in a Disney Princess Movie. In Australian International Academic Centre PTY. LTD. (Hrsg.) International Journal of Applied Linguistics & English Literature. Internet:
http://www.joumals.aiac.org.au/index.php/IJALEL/artide/download/2729/2330 [20.03.2018].
Booker, M. K. (2010) Disney, Pixar, and the hidden messages of children's films. Santa Barbara, Calif: Praeger.
Colman, Dani (2014) The problem with false feminism - or why frozen left me cold.
Digital: Medium. Internet: https://medium.com/disney-and-animation/the-problem-with-false- feminism-7c0bbc7252ef [20.03.2018].
Eckes, Thomas & Trautner, Hanns M. (Hrsg.) (2000) The Developmental Social Psychology of Gender. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Eckes, Thomas (2010) Geschlechterstereotype: Von Rollen, Identitäten und Vorurteilen. In Becker, Ruth & Budrich Barbara (Hrsg.) Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung: Theorie, Methoden, Empirie. Wiesbaden: VS, Verl. für Sozialwissenschaften.
Frozen. Regie: Chris Buck, Jennifer Lee. Drehbuch: Jennifer Lee, Shane Morris. USA: Walt Disney Pictures, 2013.
Hahn, Hans H. (Hrsg.) (2002) Stereotyp, Identität und Geschichte: die Funktion von Stereotypen in gesellschaftlichen Diskursen. Frankfurt am Main: Europäischer Verlag der Wissenschaften.
Hall, Stuart (1999c) Kodieren/Dekodieren. In: Bromley, Roger/Göttlich, Udo/Winter, Carsten (Hrsg.) Cultural Studies. Grundlagentexte zur Einführung. Lüneburg: Zu Klampen.
Hepp, Andreas (Hrsg.) (2010) Cultural Studies und Medienanalyse. 3. Auflage. Eine Einführung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Krotz, Friedrich (2009) Stuart Hall: Encoding/Decoding und Identität. In: Hepp, Andreas/Krotz, Friedrich/Thomas, Tanja (Hrsg.) Schlüsselwerke der Cultural Studies. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Kugelmann, Claudia (1996) Starke Mädchen, Schöne Frauen? Weiblichkeitszwang und Sport im Alltag. Butzbach-Griedel: Afra Verlag.
Lopez, Gressi (2016) Disney's Gender Messaging. In Digital: JCCC Honors Journal (Vol. 8) Internet: http://scholarspace.jccc.edu/honorsjournal/vol8/iss1/1 [24.03.2018].
Maity, N. (2014) Damsels in Distress: A Textual Analysis of Gender Roles in Disney Princess Films. In Digital: IOSR Journal Of Humanities And Social Science (Vol. 9). Internet: https://people.ucsc.edu/~cjgoldma/E0191032831.pdf [20.03.2018].
Münster, Claudia (2016) 18 Gründe, warum Disney mit Elsa ein tolles Vorbild für Mädchen geschaffen hat. Digital: Edition F. Internet: https://editionf.com/18-Gruende- warum-Elsa-die-Eiskoenigin-eine-toughe-bitch-ist [30.03.2018]
Nyh, Johan (2015) From Snow White to Frozen - An evaluation of popular gender representation indicators applied to Disney’s princess films. Digital: Karlstads Universitet. Internet: kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:827331/FULLTEXT01.pdf [20.03.2018].
No, Sandra (2015) Frozen: A Postfeminist Princess. In Digital: Women‘s Resource Center. Internet: https://www.colorado.edu/wrc/2015/04/10/frozen-postfeminist-princess [20.03.2018] .
Rudloff, Maya (2016) (Post)feminist paradoxes: the sensibilities of gender representation in Disney’s Frozen. In Digital: Outskirts - feminisms along the edge (Vol. 35). Internet: www.outskirts.arts.uwa.edu.au/ data/.../Outskirts-Rudloff.pdf [30.03.208].
Seier, Andrea (2007) Remediatisierung - die performative Konstitution von Gender und Medien. Berlin: Lit Verlag.
Thiele, Martina (2015). Medien und Stereotype - Konturen eines Forschungsfeldes.
Bielefeld: transcript Verlag.
Thomas, Rhiannon (2014) Why Frozen Isn’t „False Feminism“. Digital: Feminist Fiction. Internet: https://www.feministfiction.com/blog/2014/02/07/why-frozen-isnt-false-feminism [20.03.2018] .
Urban, Kristin (2014) Feminism and Sexuality in Frozen. Digital: Literally, Darling. Internet: http://www.literallydarling.com/blog/2014/04/n/feminism-and-sexuality-in-frozen/ [20.03.2018] .
Verzuh, Jennifer (2014) 8 reasons why Frozen's Anna and Elsa are the most feminist princesses from a Disney movie yet. In Digital: Empire State Tribune. Internet: https://www.empirestatetribune.com/est/culture/jennifer-verzuh/02/28/2014/8-reasons-why- frozens-anna-and-elsa-are-the-most-feminist-princesses-from-a-disney-movie-yet [30.03.2008]
Villa, Paula-Irene (2010) (De)Konstruktion und Diskurs-Genealogie: Zur Position und Rezeption von Judith Butler. In Becker, Ruth/Budrich, Barbara (Hrsg.) Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung: Theorie, Methoden, Empirie. Wiesbaden: VS, Verl. Für Sozialwissenschaften.
Winter, Rainer (1997): Cultural Studies als kritische Medienanalyse: Vom „encoding/decoding“-Modell zur Diskursanalyse. In: Hepp, Andreas/Winter, Rainer (Hrsg.):
Häufig gestellte Fragen zu diesem Text
Was ist das Encoding/Decoding Modell nach Stuart Hall?
Das Encoding/Decoding Modell ist ein Kommunikationsmodell von Stuart Hall, das besagt, dass eine Nachricht beim Senden kodiert und beim Empfangen dekodiert wird. Die Bedeutung einer Nachricht ist abhängig vom Kontext und der sozialen Klasse des Rezipienten. Der Rezipient kann die Nachricht dominant-hegemonial, ausgehandelt oder oppositionell aneignen.
Was sind Geschlechter-Stereotype?
Geschlechterstereotype sind kognitive Strukturen, die sozial geteiltes Wissen über die charakteristischen Merkmale von Frauen und Männern enthalten. Sie sind vereinfachte Vorstellungen über Geschlechterrollen, die Erwartungen an Verhaltensweisen beinhalten. Nicht erfüllte Erwartungen führen oft zu Ablehnung oder Bestrafung.
Wie werden Geschlechterrollen in Disney-Prinzessinnenfilmen dargestellt?
In Disney-Prinzessinnenfilmen gibt es eine Entwicklung der Geschlechterrollen. Frühe Filme zeigen passive, hilflose Prinzessinnen, während spätere Filme mutigere und abenteuerlustigere Prinzessinnen zeigen. Die Entwicklung orientiert sich am gesellschaftlichen Mainstream, um möglichst breite Zielgruppen zu erreichen.
Was sind die Hauptmotive in Disneys Prinzessinnenfilmen?
Die Hauptmotive sind: Junge, schöne Prinzessinnen, die gerettet werden müssen; muskulöse Helden-Prinzen; Liebe auf den ersten Blick; hässliche Bösewichte; Rettung durch den Kuss der wahren Liebe; heterosexuelle Liebe als Ziel.
Welche drei Entwicklungsstadien gibt es in den Disney Prinzessinnen-Filmen?
Das erste Stadium umfasst Schneewittchen, Cinderella und Dornröschen. Das zweite Stadium umfasst Arielle, Belle, Jasmin, Pocahontas und Mulan. Das dritte Stadium umfasst Merida, Tiana, Rapunzel und die Schwestern Anna und Elsa.
Was sind "traditionell maskuline" und "traditionell feminine" Eigenschaften in den Disney Prinzessinnen-Filmen?
Maskuline Eigenschaften: Abenteuerlust, körperliche Stärke, Unabhängigkeit, Mut, Durchsetzungsfähigkeit, Emotionslosigkeit und Intellekt. Feminine Eigenschaften: körperliche Schwäche, Unterwürfigkeit, Emotionalität, Sensibilität, Hilfsbereitschaft, Mütterlichkeit.
Wie wird Disneys "Frozen" nach dem Encoding/Decoding Modell betrachtet?
"Frozen" wird unterschiedlich rezipiert. Die dominant-hegemoniale Lesart sieht "Frozen" als feministische Geschichte mit starken weiblichen Heldinnen. Die oppositionelle Lesart sieht "Frozen" als antifeministisch mit stereotypen Charakteren. Die ausgehandelte Lesart erkennt Fortschritte in der Geschlechterdarstellung, kritisiert aber postfeministische Elemente wie Körperbilder und Umstylings.
Was ist die dominant-hegemoniale Lesart von "Frozen"?
Die dominant-hegemoniale Lesart feiert "Frozen" für seine feministische Botschaft und die starken, weiblichen Hauptrollen. Schwesternschaft steht über romantischer Liebe, das Konzept der "Liebe auf den ersten Blick" wird kritisiert, und der Bösewicht ist ein schöner, junger Prinz.
Was ist die oppositionelle Lesart von "Frozen"?
Die oppositionelle Lesart sieht "Frozen" als Beispiel für "falschen Feminismus". Es gibt kaum weibliche Charaktere neben den Hauptrollen. Anna braucht zwingend einen männlichen Begleiter. Elsa wird pathologisiert und als sozial isoliert dargestellt. Das Umstyling der Elsa wird als hypersexualisierend bewertet.
Was ist die ausgehandelte Lesart von "Frozen"?
Die ausgehandelte Lesart erkennt die feministische Botschaft grundsätzlich an, kritisiert aber, dass diese Botschaft durch postfeministische Elemente korrumpiert wird. Kritisiert wird vor allem die Darstellung stereotyper Körperbilder der Charaktere Elsa, Anna, Kristoff und Hans.
- Quote paper
- Lucca Czesla (Author), 2018, Geschlechterdarstellung in Disney. Eine Betrachtung von "Frozen" nach dem Encoding/Decoding-Modell, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/508668