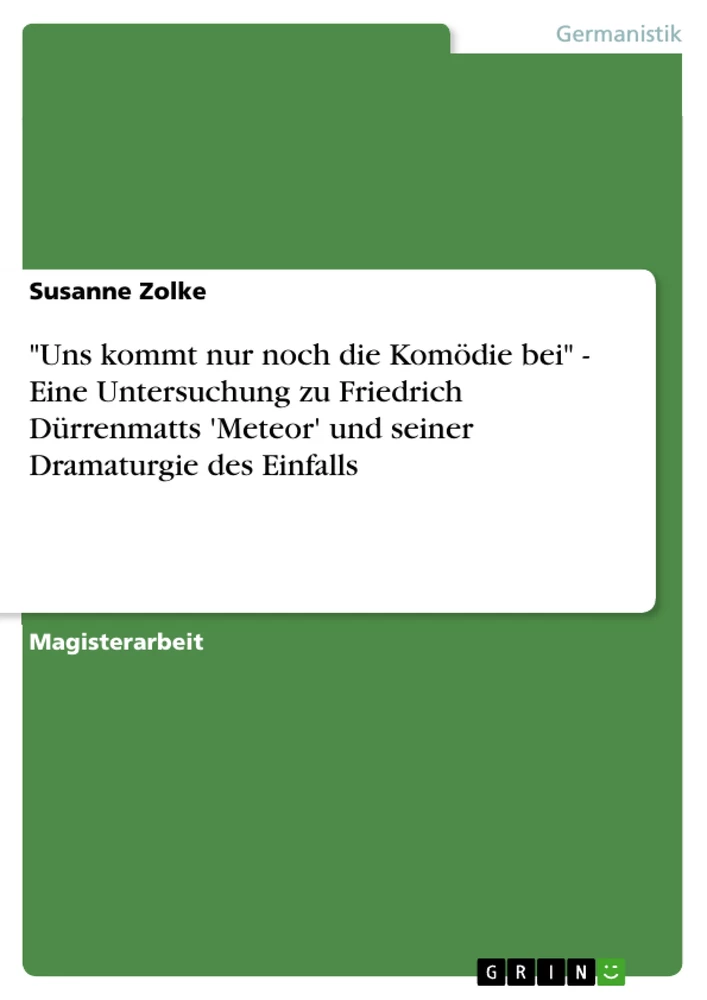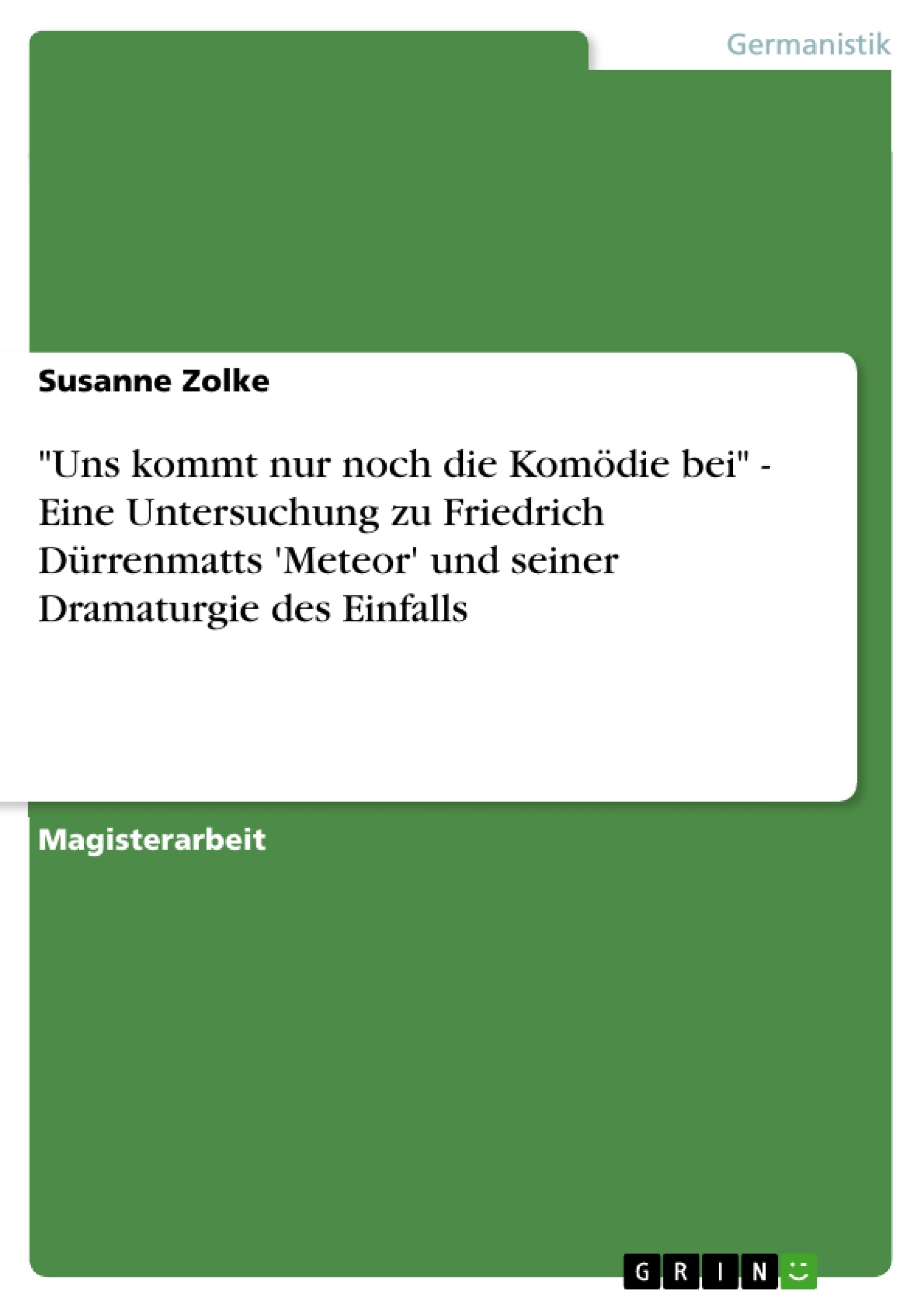1. EINLEITUNG
In selbstironischer Manier gesteht Friedrich Dürrenmatt ein, dass er die von Kritikern häufig gestellte Frage, ob er ‚sich denn bei seinen Komödien etwas denke, und wenn ja, was?’, nicht beantworten könne. Obwohl diese Äußerung aus dem fiktiven Gespräch „Friedrich Dürrenmatt über F.D.“1 schlicht als beiläufige Provokation in Richtung seiner Kritiker zu verstehen ist, klingt auch hier seine beharrliche Weigerung an, in seinen Stücken irgendeine bewusste moralische oder didaktische Absicht zu verfolgen.
Darüber hinaus fällt es schwer, dieses Bekenntnis ernst zu nehmen, denn sowohl seine Dramen, die er immer wieder umschrieb und neu ‚komponierte’ wie er es nannte, als auch seine zahlreichen theoretischen Abhandlungen über das Theater, lassen erkennen, dass er sich durchaus Einiges ‚dabei gedacht’ zu haben schien.
Der Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt – als Dichter wollte er nie bezeichnet werden – ist inzwischen das, was er nie sein wollte: ein moderner Klassiker. Seine Werke finden sich in Literaturkanons, sind Standardwerke bei der Schullektüre und seine Dramen, vor allem sein erfolgreichstes und bekanntestes Stück Der Besuch der alten Dame (1956) erfreuen sich weltweiter Aufführungen. Dennoch – oder ist dies gerade eine Besonderheit einflussreicher Autoren? - war der Querdenker Dürrenmatt nie unumstritten. Weil er empfindliche Themen wie Verrat, Korruption, Macht und Mord mit scharfer Ironie und schwarzem Humor behandelte, erregte er nicht selten ‚Theaterskandale’ und Empörung unter den Zuschauern und Kritikern.
Die Ansicht über seine Zeit, sein Gesellschafts- und Menschenbild, kurz sein Weltbild spiegelt sich, sei es auch in verschlüsselter Form, in seinen Werken wider. Neben seinen Hörspielen und Kriminalromanen trifft dies im Besonderen auf seine Komödien zu, nach Dürrenmatt ohnehin die einzige Dramenform, die ‚uns noch beikommt’2.
Ziel dieser Arbeit ist es, zu durchleuchten, warum ausschließlich die Komödie im Stande ist, der Welt auf dem Theater entgegen zu treten. Friedrich Dürrenmatts aus der Auseinandersetzung mit der Welt entstandene Poetik der Komödie und die daraus hervorgehende Dramaturgie soll durch eine genaue Analyse seines Stücks Der Meteor (1966) veranschaulicht werden.
Weiterhin soll gezeigt werden, wie das Drama als Zeitstück wahrgenommen und über dessen Inhalt hinaus interpretiert worden ist.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DÜRRENMATTS POETIK DER KOMÖDIE
- Schriftstellerische Entwicklung
- Dramentheoretische Überlegungen
- Die geschichtsphilosophische Begründung der Komödie
- Der ,neue' Komödienbegriff
- Tragödie als Theater der Identifikation
- Theater der Distanz
- ,,Gefahr, ins Leere zu stoßen"
- Theaterwelt als Gegenwelt
- Die Dramaturgie des Einfalls und das Groteske
- Der Zufall als Einfall
- Ist das Groteske nihilistisch?
- DÜRRENMATTS EINFALL: DER METEOR
- Struktur
- Inhalt
- Die Idee des Stücks
- Absage an das Leben
- Die bittere Erkenntnis
- Abrechnung mit der Literatur
- Schwitter als Richter über die Welt
- ,Totentanz' der Nebenpersonen
- Nyffenschwander und Auguste
- Pfarrer Lutz
- Muheim
- Olga
- Jochen
- Schlatter
- Koppe
- Georgen
- Frau Nomsen
- ,Totentanz' der Nebenpersonen
- Die schlimmstmögliche Wendung
- Warum Schwitters Tod Illusion bleiben muss
- REZEPTION
- Der,,metaphysische Brocken"
- Eine Schaffensbilanz?
- ZUSAMMENFASSUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit Friedrich Dürrenmatts „Der Meteor“ und untersucht die Dramaturgie des Einfalls im Kontext der von Dürrenmatt entwickelten Poetik der Komödie. Das Ziel ist es, zu zeigen, warum ausschließlich die Komödie in der Lage ist, der Welt auf dem Theater entgegenzutreten. Die Arbeit beleuchtet Dürrenmatts Auseinandersetzung mit der Welt und wie diese in seiner Poetik der Komödie und seiner Dramaturgie zum Ausdruck kommt. Darüber hinaus soll gezeigt werden, wie das Drama als Zeitstück wahrgenommen und über seinen Inhalt hinaus interpretiert worden ist.
- Die Dramaturgie des Einfalls und das Groteske in Dürrenmatts Komödien
- Der „neue“ Komödienbegriff und seine Abgrenzung von der traditionellen Tragödie
- Die Rolle des Zufalls in Dürrenmatts Dramen
- Der Einfluss der Schweizer Kultur und Gesellschaft auf Dürrenmatts Werk
- Dürrenmatts kritische Auseinandersetzung mit der modernen Welt
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt Dürrenmatts Werk und seine Komödien in den Kontext seiner Biografie und seines künstlerischen Schaffens. Sie erläutert die Zielsetzung der Arbeit und die Methodik, die zur Analyse von „Der Meteor“ verwendet wird.
- Das Kapitel „Dürrenmatts Poetik der Komödie“ befasst sich mit Dürrenmatts Entwicklung als Schriftsteller und seinen Dramentheoretischen Überlegungen. Es analysiert seinen „neuen“ Komödienbegriff und die Konzepte des Theaters der Distanz und der Dramaturgie des Einfalls.
- Im Kapitel „Dürrenmatts Einfall: Der Meteor“ wird die Struktur, der Inhalt und die Idee des Stücks „Der Meteor“ analysiert. Es wird gezeigt, wie Dürrenmatt in diesem Drama die Absage an das Leben, die bittere Erkenntnis und die Abrechnung mit der Literatur thematisiert.
- Das Kapitel „Rezeption“ untersucht, wie „Der Meteor“ von der Kritik und dem Publikum aufgenommen wurde und wie es als Zeitstück interpretiert worden ist.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Dramaturgie des Einfalls, Friedrich Dürrenmatt, Komödie, Groteske, Theater der Distanz, „Der Meteor“, Moderne, Zeitkritik, Schweizer Kultur, Schweizer Gesellschaft.
- Quote paper
- Susanne Zolke (Author), 2005, "Uns kommt nur noch die Komödie bei" - Eine Untersuchung zu Friedrich Dürrenmatts 'Meteor' und seiner Dramaturgie des Einfalls, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/50787