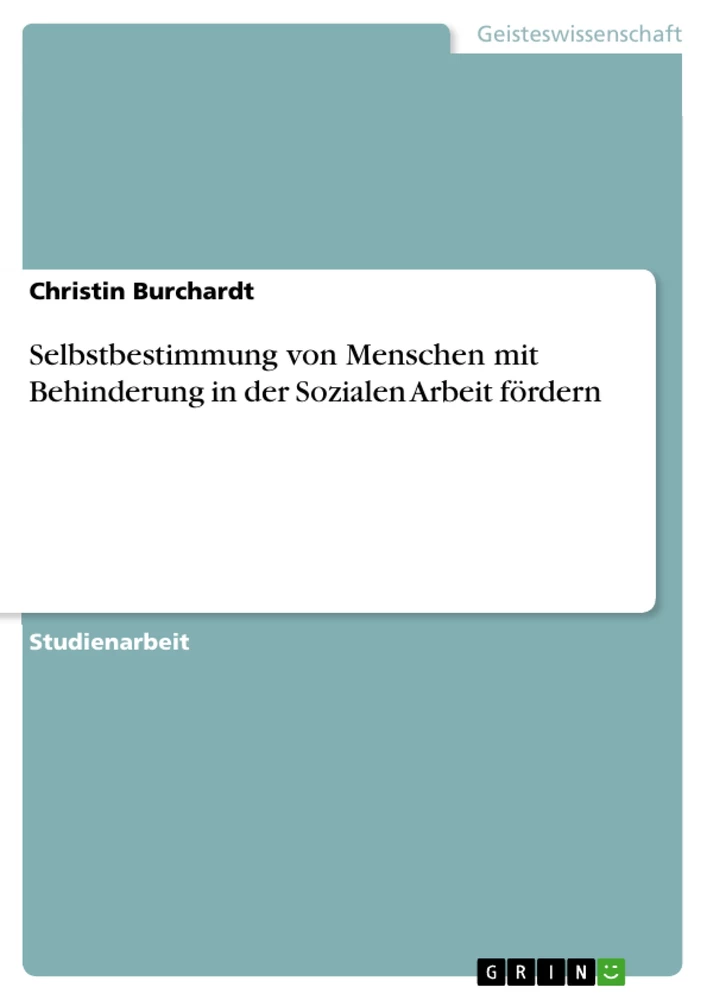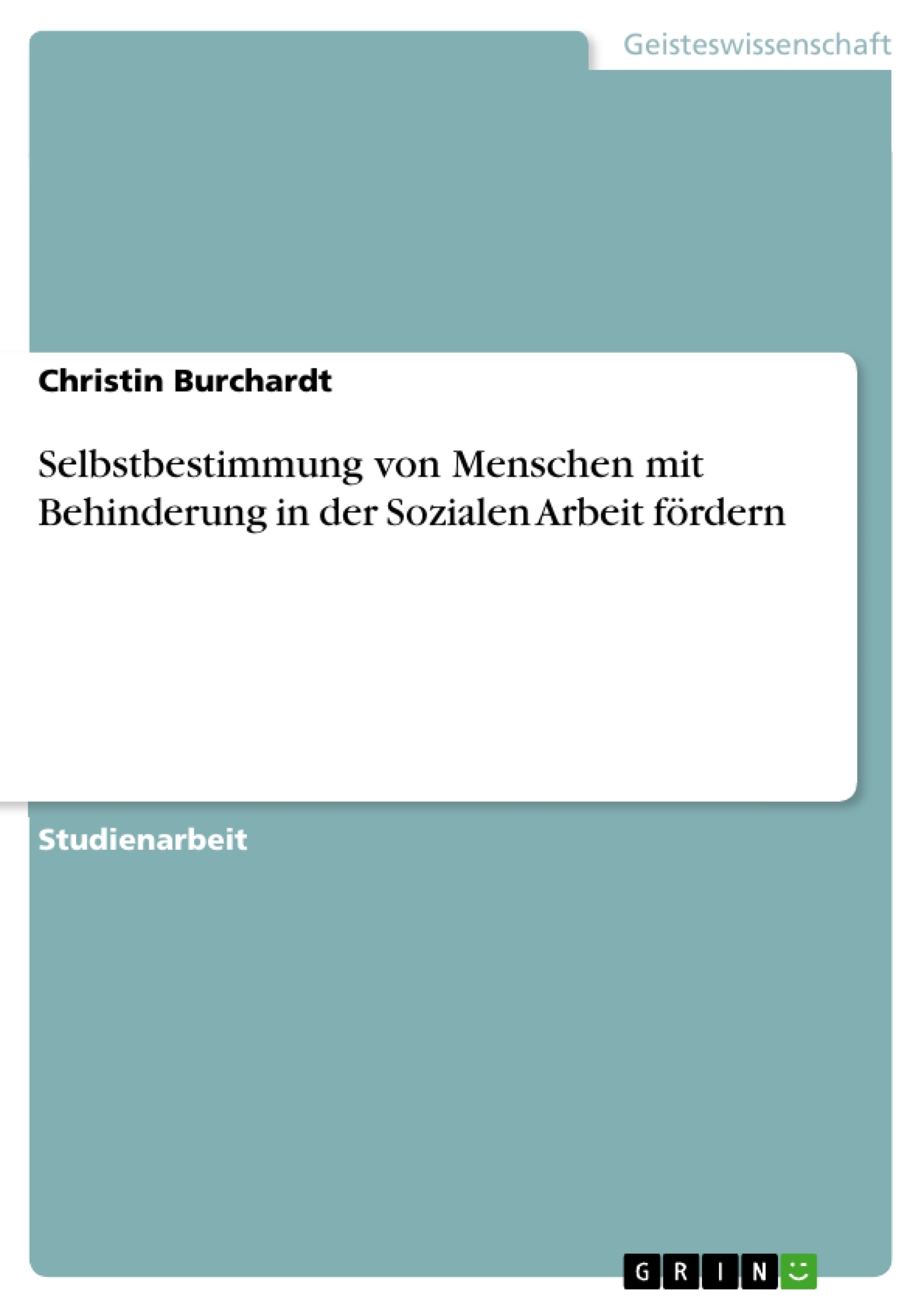In der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung muss die Profession der Sozialpädagogik viel Fingerspitzengefühl beweisen. Die kognitiven Schwierigkeiten der Betroffenen, welche die Teilhabe in der Gesellschaft und die alltäglichen Lebensverrichtungen erschweren, sollen von Fall zu Fall individuell bewertet werden. Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen haben täglich Entscheidungen zu treffen und Hilfen bereit zu stellen um die hilfebedürftigen Personen bei ihren Problemen zu unterstützen.
Gerade in dem Bereich des Entscheidens besteht bei den Professionen eine Diskussion über die Ermöglichung der Selbstbestimmung und Partizipation auch von Menschen mit geistiger Behinderung. Die Wichtigkeit und Aktualität dieses Themas wird auch durch den mittlerweile rechtlichen Anspruch auf ein persönliches Budget deutlich, welches dazu dienen soll die gesellschaftliche Teilhabe und Selbstbestimmung zu fördern beziehungsweise zu ermöglichen. Auch aktuelle Wohn- und Arbeitsformen für Menschen mit Behinderung verfolgen stets das Ziel der größtmöglichen Selbstständigkeit und das Gerecht werden der Individualität.
Aufgrund der Wichtigkeit dieses Themas, gerade auch für den Bereich der Sozialen Arbeit, beschäftigt sich der folgende Text mit der Frage, wie Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen speziell in dem Umgang von mit Menschen mit geistiger Behinderung deren Selbstbestimmung gewährleisten und fördern können. Dafür ist es notwendig sich im ersten Punkt damit auseinander zu setzen, wo die Diskussion über Selbstbestimmung seinen Ursprung hat und was der Begriff bedeutet, sowie beinhaltet. Im darauf folgenden Abschnitt werden drei Handlungskonzepte der Sozialen Arbeit betrachtet, welche auf die Erreichung von Selbstbestimmung abzielen. Als drittes wird das Thema des gleichwertigen Umgangs von Personen mit geistiger Behinderung behandelt und bestehende Abhängigkeiten zwischen den Helfenden und den Betroffenen, sowie daraus mögliche entstehende Folgen, beschrieben. Als letzten Punkt setzt sich der Text mit Kommunikationsweisen auseinander, die Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen beherrschen sollten, um Selbstbestimmung zu fördern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Selbstbestimmung
- Konzepte der Sozialen Arbeit
- Das Assistenzkonzept
- Das Kundenmodell
- Empowerment
- Gleichwertiger Umgang und Abhängigkeiten zwischen Sozialpädagogen/innen und den Menschen mit geistiger Behinderung
- Gleichwertiger Umgang
- Abhängigkeiten und mögliche Folgen
- Selbstbestimmung fördernde Kommunikationsweisen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, wie Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen die Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung im Kontext Sozialer Arbeit gewährleisten und fördern können. Sie analysiert den Begriff der Selbstbestimmung, betrachtet relevante Handlungskonzepte und beleuchtet den gleichwertigen Umgang sowie förderliche Kommunikationsweisen.
- Der Begriff der Selbstbestimmung und seine Entwicklung
- Handlungskonzepte der Sozialen Arbeit zur Förderung von Selbstbestimmung
- Gleichwertiger Umgang und Abhängigkeiten im Kontext der Betreuung
- Kommunikationsstrategien zur Unterstützung von Selbstbestimmung
- Anwendung der Konzepte auf Menschen mit geistiger Behinderung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung in der Sozialen Arbeit ein. Sie betont die Bedeutung individueller Bewertung kognitiver Schwierigkeiten und die Notwendigkeit, Selbstbestimmung und Partizipation zu ermöglichen. Der rechtliche Anspruch auf persönliches Budget und aktuelle Wohn- und Arbeitsformen werden als Beispiele für die zunehmende Fokussierung auf Selbstständigkeit genannt. Die Arbeit fokussiert darauf, wie Sozialpädagogen die Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung gewährleisten und fördern können, indem sie den Begriff der Selbstbestimmung beleuchten, Handlungskonzepte der Sozialen Arbeit betrachten, den gleichwertigen Umgang thematisieren und förderliche Kommunikationsweisen untersuchen.
Selbstbestimmung: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Selbstbestimmungsgedankens, beginnend mit der "Krüppelbewegung" und der "Independent-Living-Bewegung" in den USA. Es wird die Entwicklung von "Selbstbestimmung durch Integration" zu "Selbstbestimmung statt Integration" erläutert und die oft synonym verwendete Autonomie definiert. Das Kapitel beschreibt den Ursprung der Selbstbestimmung im menschlichen Willen und gliedert ihn in Selbstverantwortung, Selbstleitung und Selbstständigkeit. Es betont, dass Selbstbestimmung nicht mit Selbstständigkeit gleichzusetzen ist und dass auch stark abhängige Personen ein hohes Maß an Selbstbestimmung erreichen können, wenn sie Einfluss nehmen können.
Konzepte der Sozialen Arbeit: Dieses Kapitel präsentiert drei Handlungskonzepte der Sozialen Arbeit, die auf die Erreichung von Selbstbestimmung abzielen. Es wird das Assistenzkonzept detailliert beschrieben, das seinen Ursprung in der "Selbstbestimmt-leben-Bewegung" hat und eine Abwendung vom therapie- und förderzentrierten Modell darstellt. Das Konzept betont die Selbstbestimmung des Menschen mit Behinderung als Arbeitgeber seines Assistenten, der Zeit, Ort und Ablauf der Hilfe bestimmt. Die Notwendigkeit von Anpassungen des Konzeptes für Menschen mit geistiger Behinderung aufgrund von Schwierigkeiten bei der Einschätzung des Hilfebedarfs und der Anleitung wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Selbstbestimmung, Menschen mit geistiger Behinderung, Soziale Arbeit, Assistenzkonzept, Empowerment, Gleichwertiger Umgang, Kommunikation, Partizipation, Autonomie, Inklusion.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu: Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung in der Sozialen Arbeit
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht, wie Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen die Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung im Kontext Sozialer Arbeit gewährleisten und fördern können. Sie analysiert den Begriff der Selbstbestimmung, betrachtet relevante Handlungskonzepte und beleuchtet den gleichwertigen Umgang sowie förderliche Kommunikationsweisen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Selbstbestimmungsgedankens, verschiedene Handlungskonzepte der Sozialen Arbeit (insbesondere das Assistenzkonzept), den gleichwertigen Umgang und Abhängigkeiten zwischen Sozialpädagogen/innen und Menschen mit geistiger Behinderung, sowie selbstbestimmungfördernde Kommunikationsweisen. Sie beleuchtet auch den Unterschied zwischen Selbstbestimmung, Autonomie und Selbstständigkeit und geht auf die Anwendung der Konzepte auf Menschen mit geistiger Behinderung ein.
Welche Handlungskonzepte der Sozialen Arbeit werden vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt detailliert das Assistenzkonzept, das auf der Selbstbestimmt-leben-Bewegung basiert und eine Abwendung vom therapie- und förderzentrierten Modell darstellt. Weitere Konzepte, die erwähnt werden, sind das Kundenmodell und Empowerment.
Wie wird der Begriff der Selbstbestimmung definiert und eingeordnet?
Selbstbestimmung wird als ein Konzept mit Ursprung im menschlichen Willen beschrieben, welches in Selbstverantwortung, Selbstleitung und Selbstständigkeit gegliedert wird. Es wird betont, dass Selbstbestimmung nicht mit Selbstständigkeit gleichzusetzen ist und auch stark abhängige Personen ein hohes Maß an Selbstbestimmung erreichen können, wenn sie Einfluss nehmen können.
Welche Rolle spielt der gleichwertige Umgang?
Die Arbeit betont die Bedeutung des gleichwertigen Umgangs zwischen Sozialpädagogen/innen und Menschen mit geistiger Behinderung. Sie beleuchtet auch die Herausforderungen und möglichen negativen Folgen von Abhängigkeiten in diesem Kontext.
Welche Bedeutung haben Kommunikationsstrategien?
Die Arbeit untersucht Kommunikationsstrategien, die die Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung unterstützen. Effektive Kommunikation wird als entscheidend für die Förderung von Selbstbestimmung angesehen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, Selbstbestimmung, Konzepte der Sozialen Arbeit (mit Unterkapiteln zu Assistenzkonzept, Kundenmodell und Empowerment), Gleichwertiger Umgang und Abhängigkeiten, Selbstbestimmung fördernde Kommunikationsweisen und Zusammenfassung. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Selbstbestimmung, Menschen mit geistiger Behinderung, Soziale Arbeit, Assistenzkonzept, Empowerment, Gleichwertiger Umgang, Kommunikation, Partizipation, Autonomie, Inklusion.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Sozialpädagogen, Sozialarbeiter, Angehörige von Menschen mit geistiger Behinderung, sowie alle, die sich mit der Thematik von Inklusion und Selbstbestimmung auseinandersetzen.
Wo finde ich weitere Informationen?
Diese FAQs bieten eine Zusammenfassung der Arbeit. Für detaillierte Informationen wird auf den vollständigen Text verwiesen.
- Arbeit zitieren
- Christin Burchardt (Autor:in), 2016, Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung in der Sozialen Arbeit fördern, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/507590