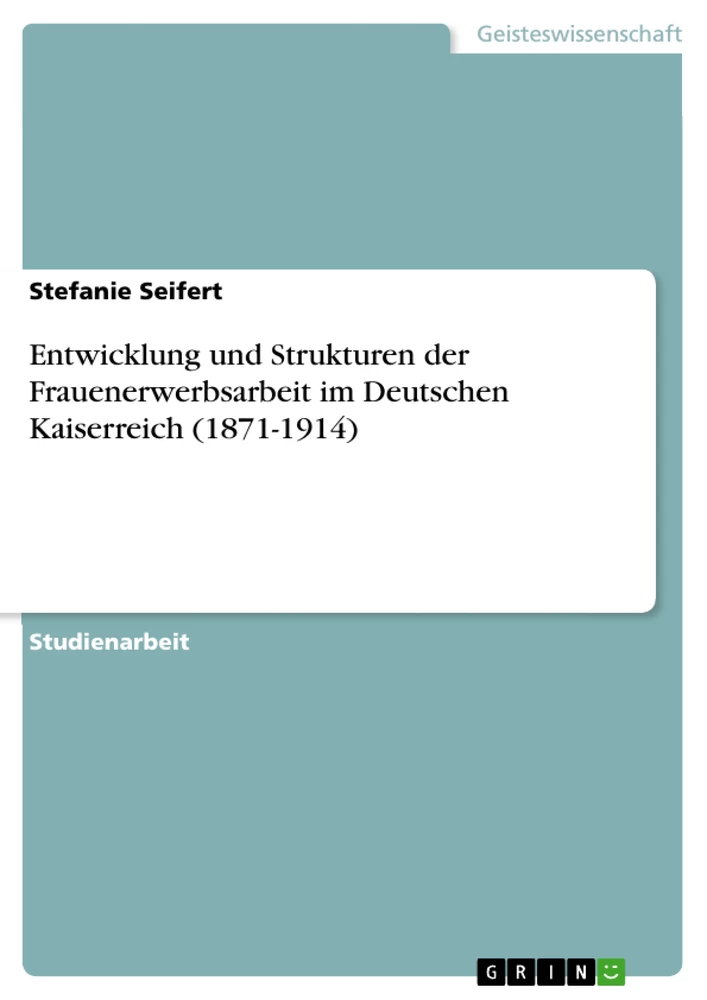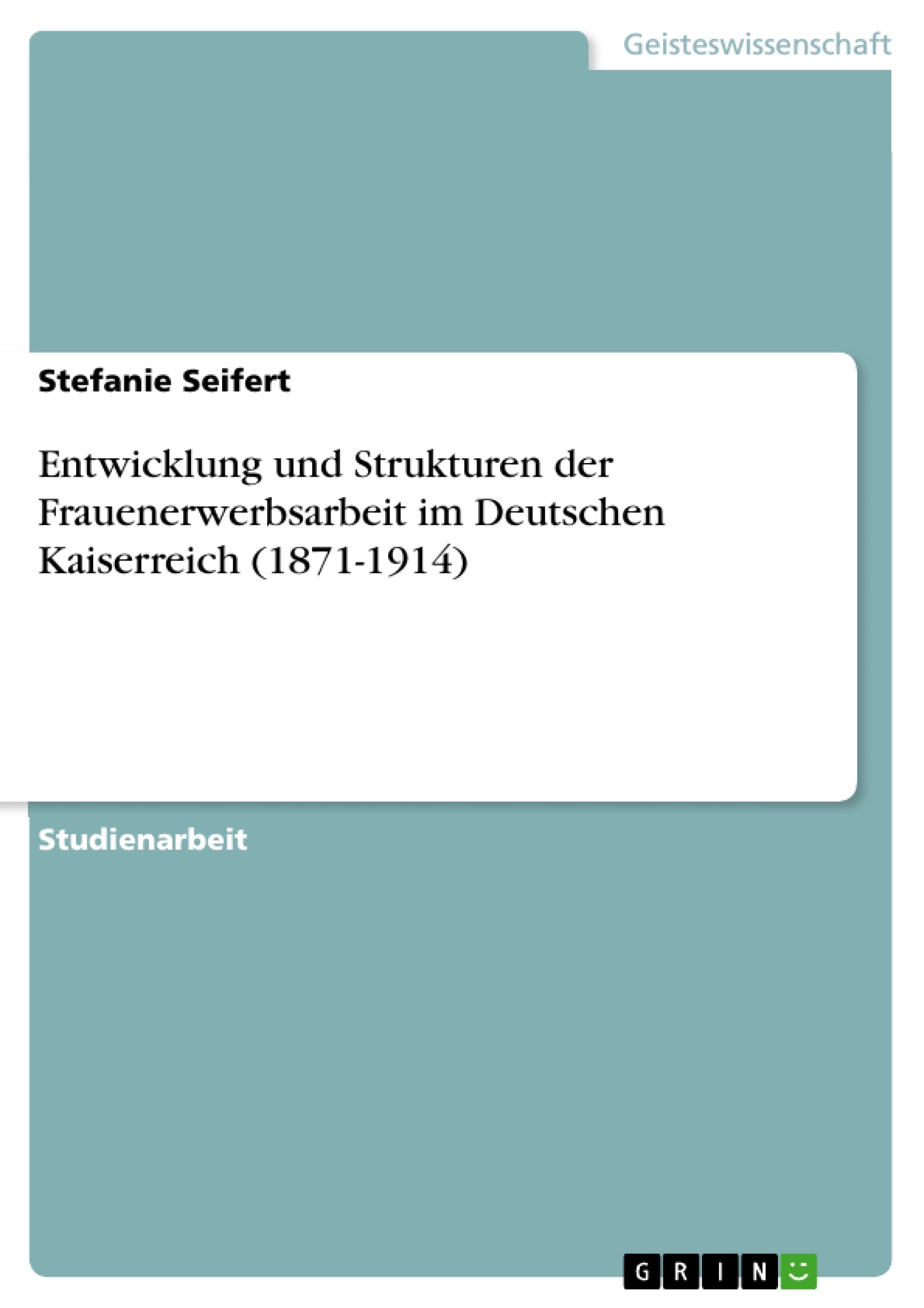Das zentrale Anliegen dieser Arbeit ist die Untersuchung der weiblichen Zugangschancen zum Arbeitsmarkt des Kaiserreichs. Knapp, auf die ich mich im Folgenden weitgehend beziehe, spricht von der „Verdrängungsthese“, die besagt, dass im Laufe der Entstehung eines modernen Arbeitssektors die Frauen die Männer aus ihren Berufen verdrängt hätten um selbst am Erwerbsleben teilzuhaben. Doch in welchen Berufsgruppen waren Frauen zu dieser Zeit wirklich zu finden und um welche Frauen handelte es sich? Aufgrund dieser Fragestellungen soll geprüft werden, wie die innere und äußere Struktur des Arbeitsmarktes sich entwickelt hat. Da Berufszählungen aus den Jahren 1882, 1895, 1907 und 1925 vorhanden sind, beziehe ich mich zur besseren Vergleichbarkeit stellenweise auf den Zeitraum bis 1925, da sich so die wesentlichen Veränderungen besonders deutlich nachzeichnen lassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die wirtschaftliche Entwicklung im Deutschen Kaiserreich
- Die rechtliche und gesellschaftliche Stellung der Frau im Deutschen Kaiserreich 1871-1914 und die Auswirkungen auf das weibliche Erwerbsleben
- Veränderungen der Erwerbsarbeit im Kaiserreich
- Die Aufrechterhaltung der Geschlechterhierarchie auf dem Arbeitsmarkt
- Der Anteil der Frauen an den erwerbsmäßig Beschäftigten im Deutschen Kaiserreich
- Die Entstehung männlich und weiblich dominierter Arbeitsbereiche
- Die Feminisierung der ehemaligen „Männerdomänen“
- Die innere Struktur des Arbeitsmarktes: Die ledige junge Frau als Prototyp der weiblichen Arbeiterin
- Zur ungleichen Bezahlung bei gleicher Tätigkeit
- Unterschiede in der Erwerbstätigkeit bürgerlicher und proletarischer Frauen
- Erwerbsbeteilung der bürgerlichen Frau
- Weibliche Erwerbsarbeit im Proletariat
- Erwerbsbeschäftigung von Frauen im modernen Arbeitssektor
- Dienstmädchen- eine Chance der weiblichen Erwerbsbeteiligung in der Stadt
- Frauenerwerbsarbeit in der Textilindustrie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Referat untersucht die Stellung der Frau im Erwerbsleben des Kaiserreichs im Zeitraum von 1871-1914. Dabei werden die Strukturen der Frauenerwerbsarbeit und deren Entwicklung analysiert, sowie die Gründe für diese Veränderungen beleuchtet. Das Referat befasst sich mit der Frage, ob die „Verdrängungsthese“, die besagt, dass Frauen im Zuge der Industrialisierung Männer aus ihren Berufen verdrängt haben, im Kaiserreich zutrifft.
- Die wirtschaftliche Entwicklung im Deutschen Kaiserreich und deren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt
- Die rechtliche und gesellschaftliche Stellung der Frau im Kaiserreich und deren Einfluss auf die weiblichen Erwerbschancen
- Die Entstehung und Entwicklung der Geschlechterhierarchie auf dem Arbeitsmarkt
- Die Struktur des Arbeitsmarktes und die typischen Berufsgruppen von Frauen im Kaiserreich
- Die Unterschiede in der Erwerbstätigkeit zwischen bürgerlichen und proletarischen Frauen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentrale These des Referats vor, welche die untergeordnete Stellung der Frau auf dem Arbeitsmarkt in Geschichte und Gegenwart mit der Verantwortung der Frauen für die Familie begründet. Anschließend wird die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung im Deutschen Kaiserreich skizziert, wobei die Industrialisierung und die daraus resultierende Arbeitsteilung zwischen Hausarbeit und Erwerbsarbeit im Fokus stehen. Des Weiteren werden die rechtliche und gesellschaftliche Stellung der Frau im Kaiserreich beleuchtet, die deutlich macht, dass Frauen von gesellschaftspolitischer Seite ausgegrenzt waren und nicht am öffentlichen Leben teilhaben konnten.
Die folgenden Kapitel beschäftigen sich mit den Veränderungen der Erwerbsarbeit im Kaiserreich, wobei die Aufrechterhaltung der Geschlechterhierarchie auf dem Arbeitsmarkt und die Entstehung männlich und weiblich dominierter Arbeitsbereiche thematisiert werden. Es wird untersucht, wie sich der Anteil der Frauen an den erwerbsmäßig Beschäftigten entwickelt hat und welche Faktoren diese Entwicklung beeinflusst haben. Darüber hinaus wird die innere Struktur des Arbeitsmarktes betrachtet und die ledige junge Frau als Prototyp der weiblichen Arbeiterin vorgestellt. Des Weiteren wird das Thema der ungleichen Bezahlung bei gleicher Tätigkeit behandelt.
Die Kapitel zum Thema „Unterschiede in der Erwerbstätigkeit bürgerlicher und proletarischer Frauen“ und „Erwerbsbeschäftigung von Frauen im modernen Arbeitssektor“ beleuchten die unterschiedlichen Erwerbsbedingungen von Frauen aus unterschiedlichen sozialen Schichten und die spezifischen Herausforderungen und Chancen der Frauenerwerbsarbeit in verschiedenen Bereichen des modernen Arbeitssektors.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Frauenerwerbsarbeit, Industrialisierung, Geschlechterhierarchie, Arbeitsmarkt, gesellschaftliche Stellung der Frau, rechtliche Situation der Frau, bürgerliche und proletarische Frauen, Dienstmädchen, Textilindustrie, soziale Strukturen und Arbeitsbedingungen.
- Quote paper
- Stefanie Seifert (Author), 2005, Entwicklung und Strukturen der Frauenerwerbsarbeit im Deutschen Kaiserreich (1871-1914), Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/50489