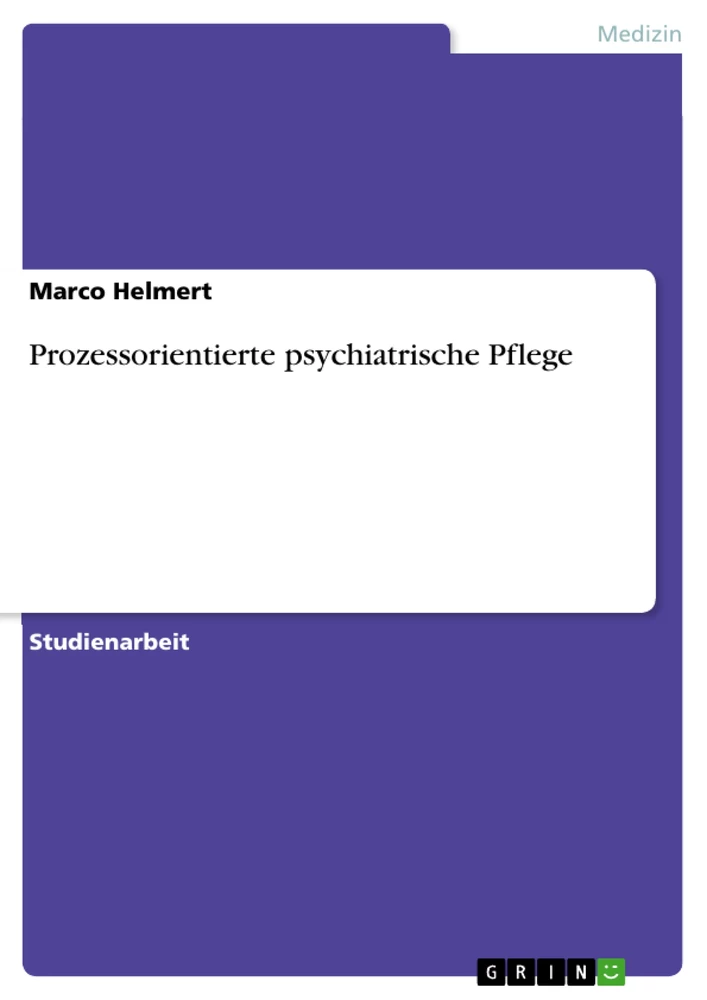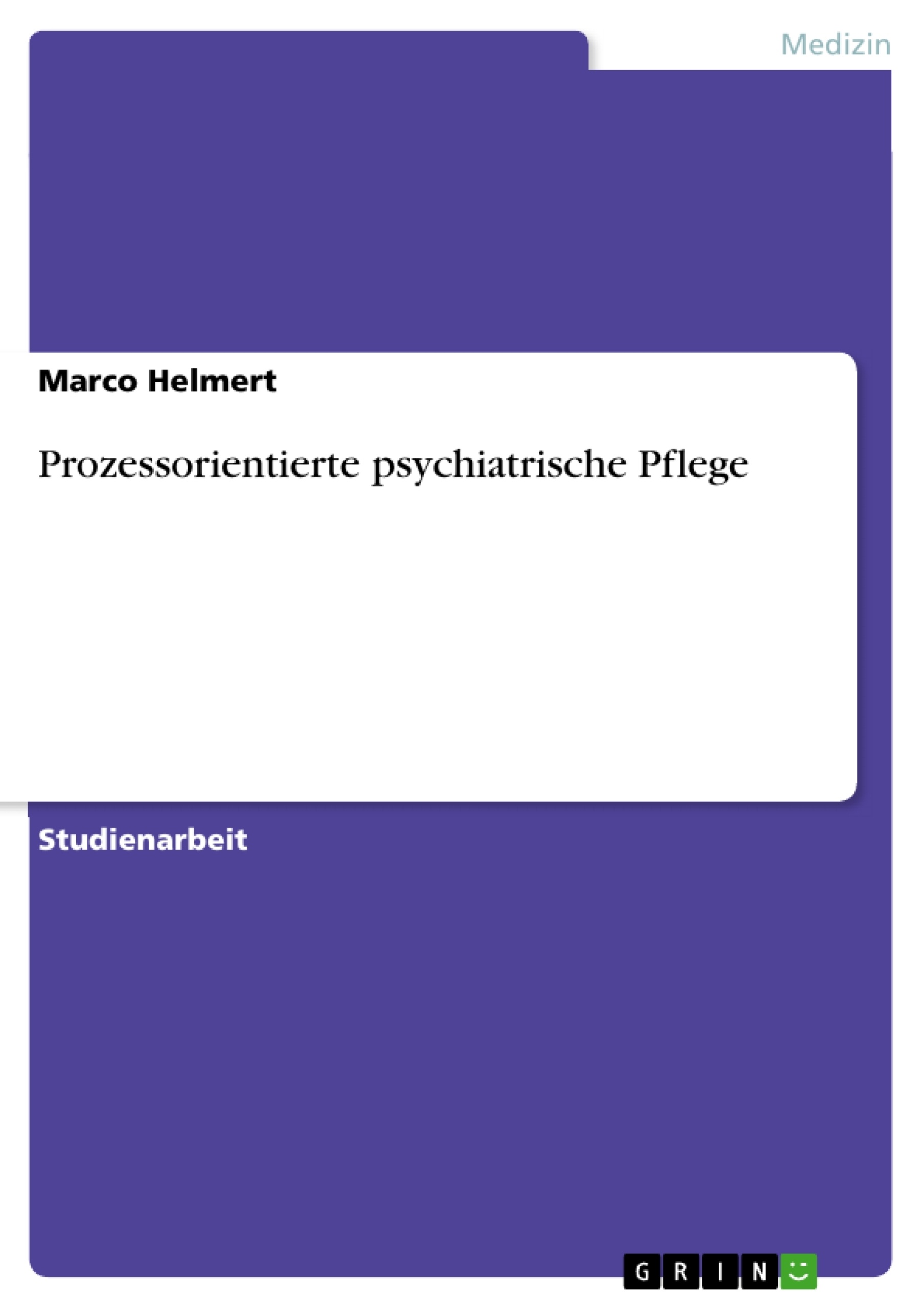Diese Einleitung zu schreiben bereitet mir in diesen Moment die größte Schwierigkeit, weil ich einfach nicht die richtigen Worte finde, um in mein Thema einzuführen. Sicher, ich könnte ausführen, dass ich über Probleme und Schwierigkeiten schreiben wollte, die ich im Pflege- und Beziehungsprozess bei uns Pflegekräften wahrgenommen habe. Probleme, die auf einer Grundhaltung beruhen, die wir uns teilweise nur sehr schwer bewusst machen können oder wollen. Ich könnte mitteilen, dass ich in meiner Hausarbeit einer problemorientierten und direktiven Pflege eine prozessorientierte und klientenzentrierte entgegenstelle, welche ich für die deutlich bessere halte, weil sie den Patienten und uns zu mehr Selbstbefähigung verhilft.
Aber das beschreibt eben nicht, wie sich dieses Thema für mich anfühlt, was es in mir bewegt und bewirkt hat und wie ich dazu gekommen bin. Denn auch ich habe mich in meinem Prozess verändert, fühle mich befähigter, fühle aber auch klarer meine Grenzen. Es hat sich einiges in mir gewandelt und obwohl ich manchmal nicht wusste wohin die Reise geht, haben diese Veränderungen doch dazu geführt, dass es sich heute anders anfühlt, wenn ich mit einem Patienten in Kontakt geheachtsamer und sanfter, vor allem aber auch berührbarer. Für dieses „Berührbar-Werden“ danke ich vor allem meinen Patienten, denen ich mich heute näher fühle und ähnlicher und von denen ich vieles lernen durfte. Lernen, was es heißt alte Überzeugungen loszulassen und lernen, was es heißt sich wirklich einzulassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Darstellung der problemorientierten Pflege
- Einführung
- Problemorientierte Interaktionen mit den Patienten
- Die Rolle der Pflegekraft
- Äußere Faktoren
- Prozessorientierte psychiatrischen Pflege
- Die prozessorientierte Grundhaltung
- Prozessorientierte Begegnungen
- Der Prozess der Pflegekraft
- Äußere Faktoren
- Ein Fazit, Pro und Kontra
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Facharbeit untersucht den Unterschied zwischen problemorientierter und prozessorientierter psychiatrischer Pflege. Ziel ist es, die Vorteile einer klientenzentrierten und prozessorientierten Herangehensweise aufzuzeigen und deren positive Auswirkungen auf Patienten und Pflegekräfte zu belegen.
- Vergleich problemorientierter und prozessorientierter Pflegeansätze
- Die Bedeutung der klientenzentrierten Pflege
- Der Einfluss der eigenen Grundhaltung der Pflegekraft
- Relevanz von Kommunikation und Empowerment
- Die Rolle äußerer Faktoren im Pflegeprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Schwierigkeiten der Autorin, ihr Thema einzuführen und reflektiert den eigenen Veränderungsprozess während der Auseinandersetzung mit der Thematik. Sie betont die Bedeutung von Achtsamkeit, Sanftheit und der Fähigkeit zur Empathie im Umgang mit Patienten und wie diese durch die Arbeit an diesem Thema beeinflusst wurden. Der Satz „Es liegt nur so lange im Schatten, bis man sich traut einmal hinzuschauen“ wird als Leitmotiv genannt.
Darstellung der problemorientierten Pflege: Dieses Kapitel charakterisiert die problemorientierte Pflege als eine Herangehensweise, die sich ausschließlich auf Krankheitssymptome, Defizite und Verhaltensauffälligkeiten konzentriert. Die Autorin kritisiert die oft unterdrückende und suppressive Natur dieser Methode, welche die zugrundeliegenden Ursachen ignoriert. Anhand eines Beispiels eines schizophrenen Patienten, der seine Medikation verweigerte, illustriert sie, wie eine rein problemorientierte Herangehensweise zu Fehlinterpretationen und ineffektiven Lösungen führen kann. Die eigentliche Ursache, der Potenzverlust durch die Neuroleptika, wurde erst durch offene Kommunikation entdeckt. Das Kapitel betont die Gefahr der einseitigen Fokussierung auf das Problem anstelle des Patienten und seiner Bedürfnisse.
Prozessorientierte psychiatrische Pflege: Im Gegensatz zur problemorientierten Pflege wird hier die prozessorientierte Pflege vorgestellt, die eine klientenzentrierte und empowernde Herangehensweise betont. Das Kapitel erläutert die Bedeutung von Kommunikation, Empowerment, und dem Prinzip der Ähnlichkeit im Umgang mit Patienten. Es wird die Notwendigkeit der Selbstreflexion und der Kenntnis der eigenen Grenzen bei den Pflegekräften betont, sowie die Bedeutung von Selbstbefähigung und professioneller Weiterbildung für eine erfolgreiche prozessorientierte Pflege. Die Gestaltung des Umfeldes und Prioritätensetzung werden ebenfalls als wichtige äußere Faktoren berücksichtigt.
Schlüsselwörter
Problemorientierte Pflege, Prozessorientierte Pflege, Klientenzentrierung, Empowerment, Kommunikation, Selbstreflexion, Psychiatrische Pflege, Ressourcenorientierung, Gewaltprävention, Professionalisierung.
Häufig gestellte Fragen zur Facharbeit: Problemorientierte vs. Prozessorientierte Psychiatrische Pflege
Was ist der Gegenstand dieser Facharbeit?
Die Facharbeit vergleicht problemorientierte und prozessorientierte Ansätze in der psychiatrischen Pflege. Sie untersucht die Vor- und Nachteile beider Methoden und beleuchtet die Bedeutung einer klientenzentrierten und prozessorientierten Herangehensweise.
Welche Themen werden in der Facharbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst einen Vergleich problemorientierter und prozessorientierter Pflege, die Bedeutung klientenzentrierten Pflegens, den Einfluss der Grundhaltung der Pflegekraft, die Relevanz von Kommunikation und Empowerment, sowie die Rolle äußerer Faktoren im Pflegeprozess.
Wie ist die Facharbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, eine Darstellung der problemorientierten Pflege, eine Erläuterung der prozessorientierten psychiatrischen Pflege, ein Fazit mit Pro und Kontra, sowie eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter. Das Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick über die einzelnen Abschnitte.
Wie wird die problemorientierte Pflege charakterisiert?
Die problemorientierte Pflege wird als eine Methode beschrieben, die sich ausschließlich auf Krankheitssymptome, Defizite und Verhaltensauffälligkeiten konzentriert, oft auf Kosten der zugrundeliegenden Ursachen. Die Autorin kritisiert deren unterdrückende Natur und zeigt anhand eines Beispiels die Gefahr von Fehlinterpretationen und ineffektiven Lösungen auf, wenn der Fokus allein auf dem Problem und nicht auf dem Patienten liegt.
Wie wird die prozessorientierte Pflege beschrieben?
Im Gegensatz dazu betont die prozessorientierte Pflege eine klientenzentrierte und empowernde Herangehensweise. Sie unterstreicht die Bedeutung von Kommunikation, Empowerment, Selbstreflexion der Pflegekräfte, Kenntnis der eigenen Grenzen, Selbstbefähigung und professioneller Weiterbildung. Äußere Faktoren wie die Gestaltung des Umfelds und Prioritätensetzung werden ebenfalls berücksichtigt.
Welche Rolle spielt die Grundhaltung der Pflegekraft?
Die Facharbeit betont die entscheidende Rolle der eigenen Grundhaltung der Pflegekraft. Selbstreflexion, Empathie und Achtsamkeit werden als wichtige Faktoren für eine erfolgreiche und patientenorientierte Pflege hervorgehoben. Die Autorin beschreibt ihren eigenen Veränderungsprozess während der Auseinandersetzung mit dem Thema.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Facharbeit?
Schlüsselwörter sind: Problemorientierte Pflege, Prozessorientierte Pflege, Klientenzentrierung, Empowerment, Kommunikation, Selbstreflexion, Psychiatrische Pflege, Ressourcenorientierung, Gewaltprävention, Professionalisierung.
Was ist das Fazit der Facharbeit?
Das Fazit (Pro und Kontra) fasst die Vor- und Nachteile der beiden Pflegeansätze zusammen und argumentiert für die Überlegenheit der prozessorientierten, klientenzentrierten Herangehensweise. (Der genaue Inhalt des Fazits wird in der Zusammenfassung nicht explizit genannt.)
Welche Zielsetzung verfolgt die Autorin?
Die Autorin möchte den Unterschied zwischen problemorientierter und prozessorientierter psychiatrischer Pflege aufzeigen und die Vorteile einer klientenzentrierten und prozessorientierten Herangehensweise belegen, sowie deren positive Auswirkungen auf Patienten und Pflegekräfte.
- Quote paper
- Marco Helmert (Author), 2005, Prozessorientierte psychiatrische Pflege, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/50397