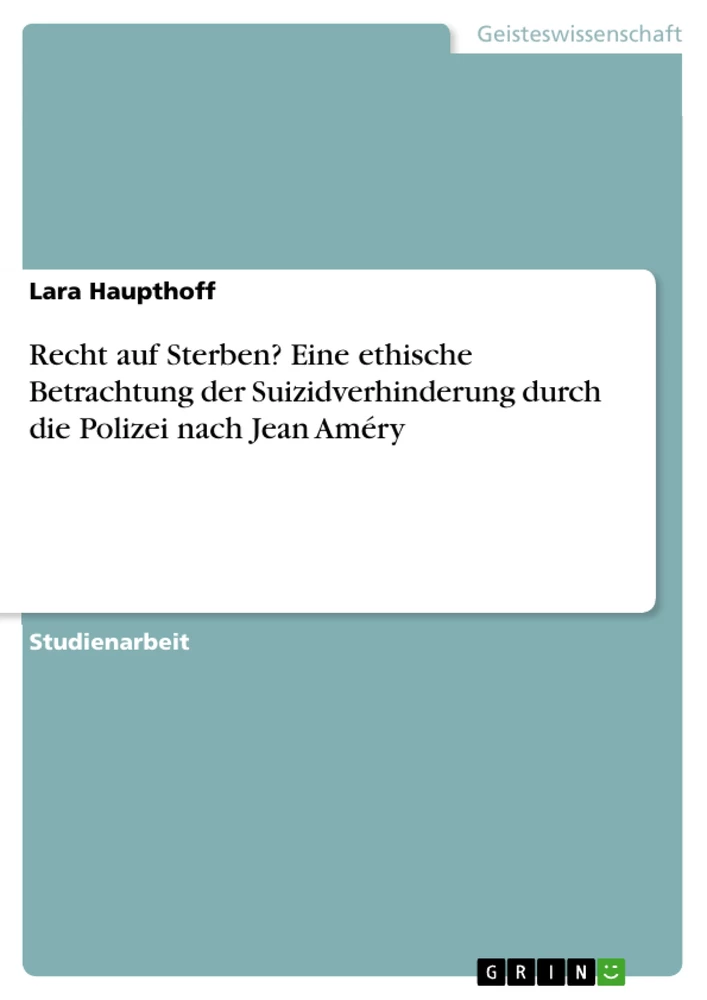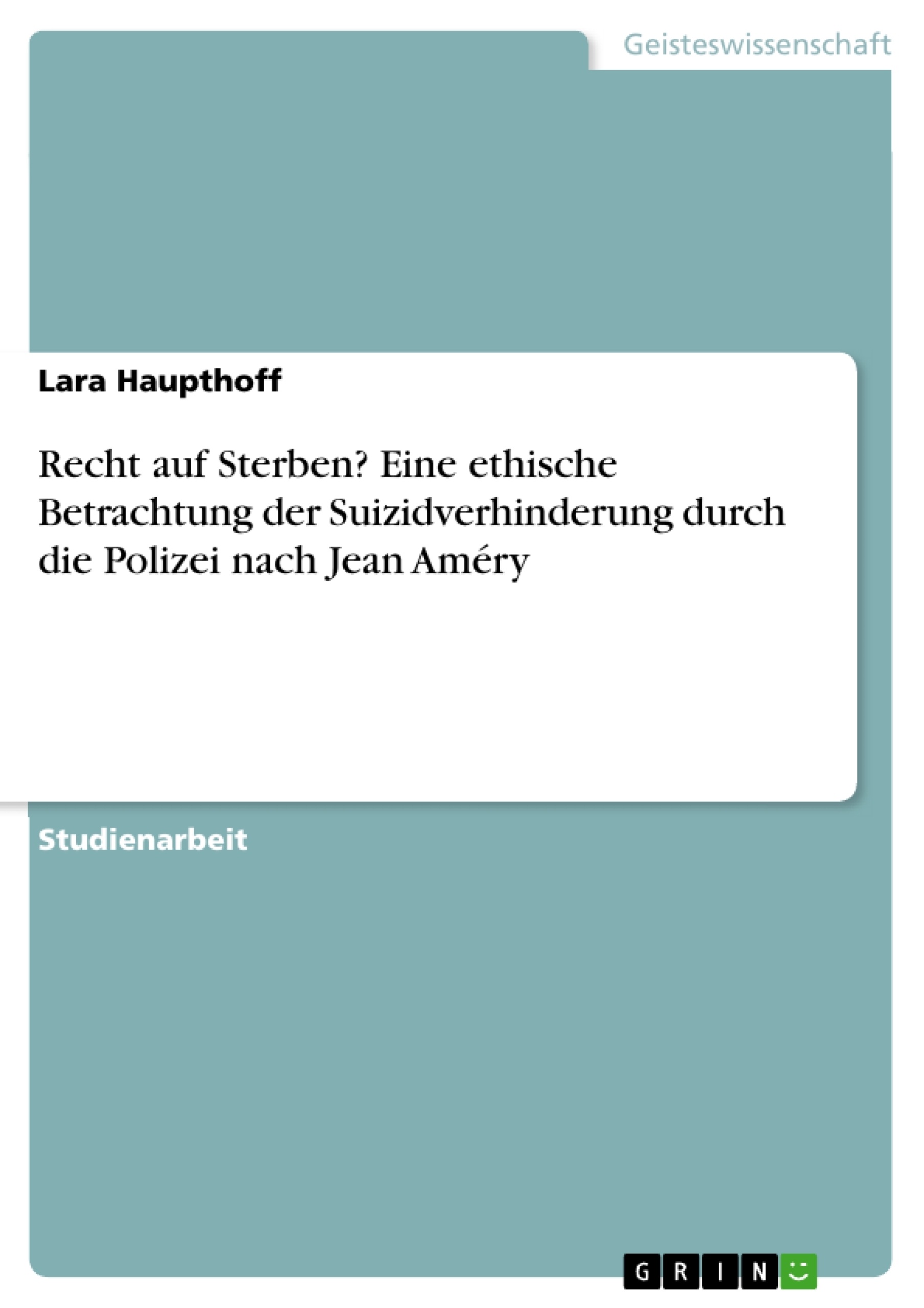Diese Arbeit beschäftigt sich mit der polizeilichen Verhinderung von Suiziden und gibt einen kleinen Überblick über die vielfältigen Berührungspunkte der Polizei mit dem Tod. Dabei bezieht sich die Arbeit auf die ethisch-philosophische Betrachtung von Jean Améry in seinem Werk "Hand an sich legen - Diskurs über den Freitod". Zudem wird versucht, die Suizidverhinderung und das Recht zum Sterben vergleichend zu beschreiben.
Laut statistischem Bundesamt haben im Jahr 2015 rund 10 000 Menschen in Deutschland Suizid begangen. Das sind fast dreimal so viele wie durch Verkehrsunfälle starben. Suizid lässt sich also durchaus als "Massenereignis" bezeichnen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Selbstmord, Suizid und Freitod (Begriffsbestimmung)
- 3. Diskurs über den Freitod
- 3.1 Jean Améry
- 3.2 Begriffsbestimmungen
- 3.2.1 Die Freiheit
- 3.2.2 L'Échec
- 3.2.3 Suizidant und Suizidär
- 3.3 Sind alle Suizidäre krank?
- 3.4 Die Natürlichkeit des Todes
- 3.5 Nihilismus des Todes
- 3.6 Todestrieb oder -neigung?
- 3.7 Lebens- oder Todeslogik?
- 3.8 Recht auf Sterben?
- 3.9 Ausnahmen
- 3.9.1 Der, der andere dadurch gefährdet
- 3.9.2 Der, der das Weiterleben schuldig ist
- 3.9.3 Der, der mordet und Hand an sich legt
- 4. Polizei und Suizid
- 4.1 Allgemeine Berührungspunkte
- 4.2 Suizidverhinderung
- 4.3 Recht auf Suizidverhinderung?
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Recht auf Sterben aus ethisch-philosophischer Perspektive, fokussiert auf Jean Amérys Werk „Hand an sich legen – Diskurs über den Freitod“. Sie analysiert Amérys Argumentation und setzt sie in Bezug zur Suizidprävention durch die Polizei. Eine rein objektive Betrachtung aller Standpunkte wird aufgrund des Umfangs der Thematik nicht angestrebt.
- Begriffsbestimmung von Selbstmord, Suizid und Freitod
- Jean Amérys philosophische Auseinandersetzung mit dem Freitod und der Freiheit zum Sterben
- Die Rolle des "échec" (Scheitern) als Motiv für Suizid nach Améry
- Die Frage, ob Suizidgefährdung eine Krankheit darstellt
- Der Bezug zwischen Polizei und Suizidprävention
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Recht auf Sterben und den Fokus auf Jean Amérys ethisch-philosophische Betrachtungsweise in seinem Werk „Hand an sich legen“ vor. Sie verweist auf die hohe Suizidrate in Deutschland und die beschränkte Verfügbarkeit von Daten zum Suizid innerhalb der Polizei. Die Arbeit konzentriert sich auf die Suizidprävention durch die Polizei und deren Berührungspunkte mit dem Thema Tod.
2. Selbstmord, Suizid und Freitod (Begriffsbestimmung): Dieses Kapitel differenziert zwischen den Begriffen Selbstmord, Suizid und Freitod. Es argumentiert für die Verwendung des neutraleren Begriffs „Suizid“ in der objektiven Literatur, im Gegensatz zum negativ konnotierten „Selbstmord“ und der zu positiven „Freitod“. Der Unterschied zwischen Suizid und Mord wird anhand des Strafgesetzbuches erläutert, wobei die Schwierigkeit, Mordmerkmale auf Suizid anzuwenden, hervorgehoben wird. Amérys Präferenz für den Begriff „Freitod“ wird im Kontext seines Werkes erklärt.
3. Diskurs über den Freitod: Dieses Kapitel analysiert Jean Amérys Werk „Hand an sich legen“, fokussiert auf seine Definition von Freiheit im Zusammenhang mit dem Suizid. Améry's Konzept des „échec“ (Scheitern) als entscheidenden Faktor für die Entscheidung zum Suizid wird ausführlich dargestellt. Der Unterschied zwischen „Suizidant“ (wer sich tatsächlich tötet) und „Suizidär“ (wer den Hang zum Suizid hat) nach Améry wird definiert. Das Kapitel diskutiert auch die Frage, ob der Hang zum Suizid als Krankheit betrachtet werden sollte, und kritisiert die Praxis, alle Suizidpräventionsfälle zwangsweise in psychiatrische Behandlung zu nehmen.
4. Polizei und Suizid: Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle der Polizei in Bezug auf Suizid. Es beschreibt die Berührungspunkte der Polizei mit dem Thema Suizid und analysiert die Aspekte der Suizidprävention aus polizeilicher Sicht. Die Arbeit hinterfragt das "Recht auf Suizidverhinderung".
Schlüsselwörter
Recht auf Sterben, Suizid, Freitod, Jean Améry, Hand an sich legen, ethische Betrachtung, Suizidprävention, Polizei, échec (Scheitern), Freiheit, Nihilismus, Todestrieb.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu „Hand an sich legen – Diskurs über den Freitod“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Recht auf Sterben aus ethisch-philosophischer Perspektive, mit besonderem Fokus auf Jean Amérys Werk „Hand an sich legen – Diskurs über den Freitod“. Sie analysiert Amérys Argumentation und setzt diese in Beziehung zur Suizidprävention durch die Polizei.
Welche Begriffe werden definiert und unterschieden?
Die Arbeit differenziert zwischen den Begriffen Selbstmord, Suizid und Freitod. Es wird argumentiert, den neutraleren Begriff „Suizid“ zu verwenden. Der Unterschied zwischen Suizid und Mord wird anhand des Strafgesetzbuches erläutert. Amérys Präferenz für den Begriff „Freitod“ wird im Kontext seines Werkes erklärt. Zusätzlich wird der Unterschied zwischen „Suizidant“ (wer sich tatsächlich tötet) und „Suizidär“ (wer den Hang zum Suizid hat) nach Améry definiert.
Welche Rolle spielt Jean Améry in dieser Arbeit?
Jean Amérys Werk „Hand an sich legen“ steht im Mittelpunkt der Analyse. Seine Definition von Freiheit im Zusammenhang mit Suizid, sein Konzept des „échec“ (Scheitern) als Motiv für Suizid und seine Unterscheidung zwischen Suizidant und Suizidär werden ausführlich dargestellt und analysiert.
Welche Bedeutung hat das „échec“ (Scheitern) nach Améry?
Amérys Konzept des „échec“ (Scheitern) wird als entscheidender Faktor für die Entscheidung zum Suizid dargestellt. Die Arbeit analysiert die Bedeutung dieses Begriffs im Kontext von Amérys Philosophie.
Wird die Frage nach der Krankheit beim Suizid behandelt?
Ja, die Arbeit diskutiert die Frage, ob der Hang zum Suizid als Krankheit betrachtet werden sollte und kritisiert die Praxis, alle Suizidpräventionsfälle zwangsweise in psychiatrische Behandlung zu nehmen.
Welche Rolle spielt die Polizei im Zusammenhang mit Suizid?
Die Arbeit befasst sich mit der Rolle der Polizei in Bezug auf Suizidprävention. Sie beschreibt die Berührungspunkte der Polizei mit dem Thema Suizid und analysiert die Aspekte der Suizidprävention aus polizeilicher Sicht. Die Frage nach dem „Recht auf Suizidverhinderung“ wird ebenfalls diskutiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Begriffsbestimmung von Selbstmord, Suizid und Freitod, Diskurs über den Freitod (mit Fokus auf Jean Améry), Polizei und Suizid und Fazit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Recht auf Sterben, Suizid, Freitod, Jean Améry, Hand an sich legen, ethische Betrachtung, Suizidprävention, Polizei, échec (Scheitern), Freiheit, Nihilismus, Todestrieb.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Recht auf Sterben aus ethisch-philosophischer Perspektive, fokussiert auf Jean Amérys Werk und dessen Bezug zur Suizidprävention durch die Polizei. Eine rein objektive Betrachtung aller Standpunkte wird aufgrund des Umfangs der Thematik nicht angestrebt.
- Quote paper
- Lara Haupthoff (Author), 2019, Recht auf Sterben? Eine ethische Betrachtung der Suizidverhinderung durch die Polizei nach Jean Améry, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/503628