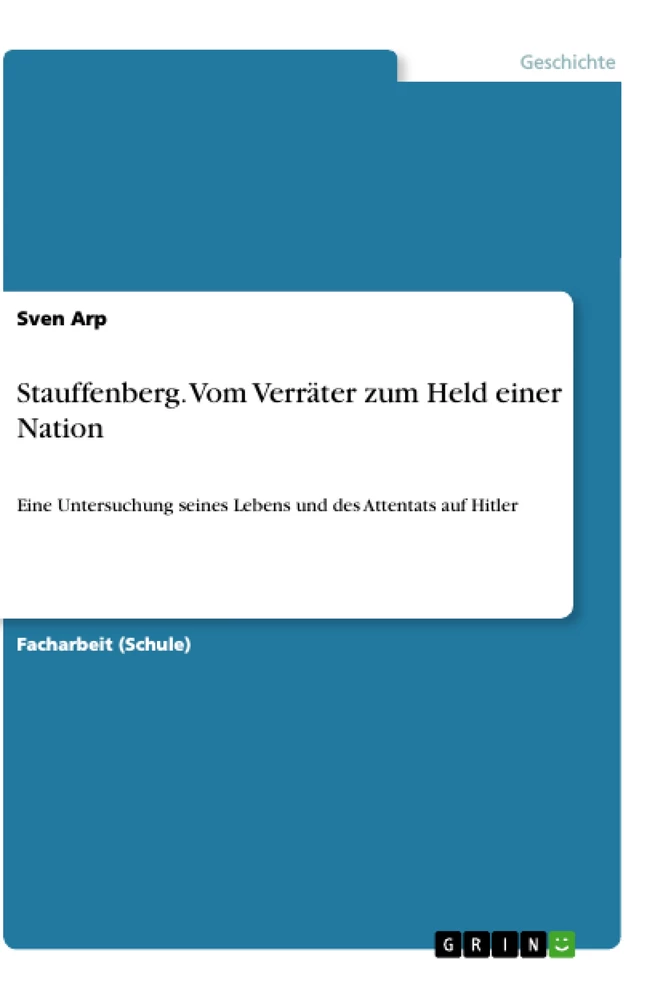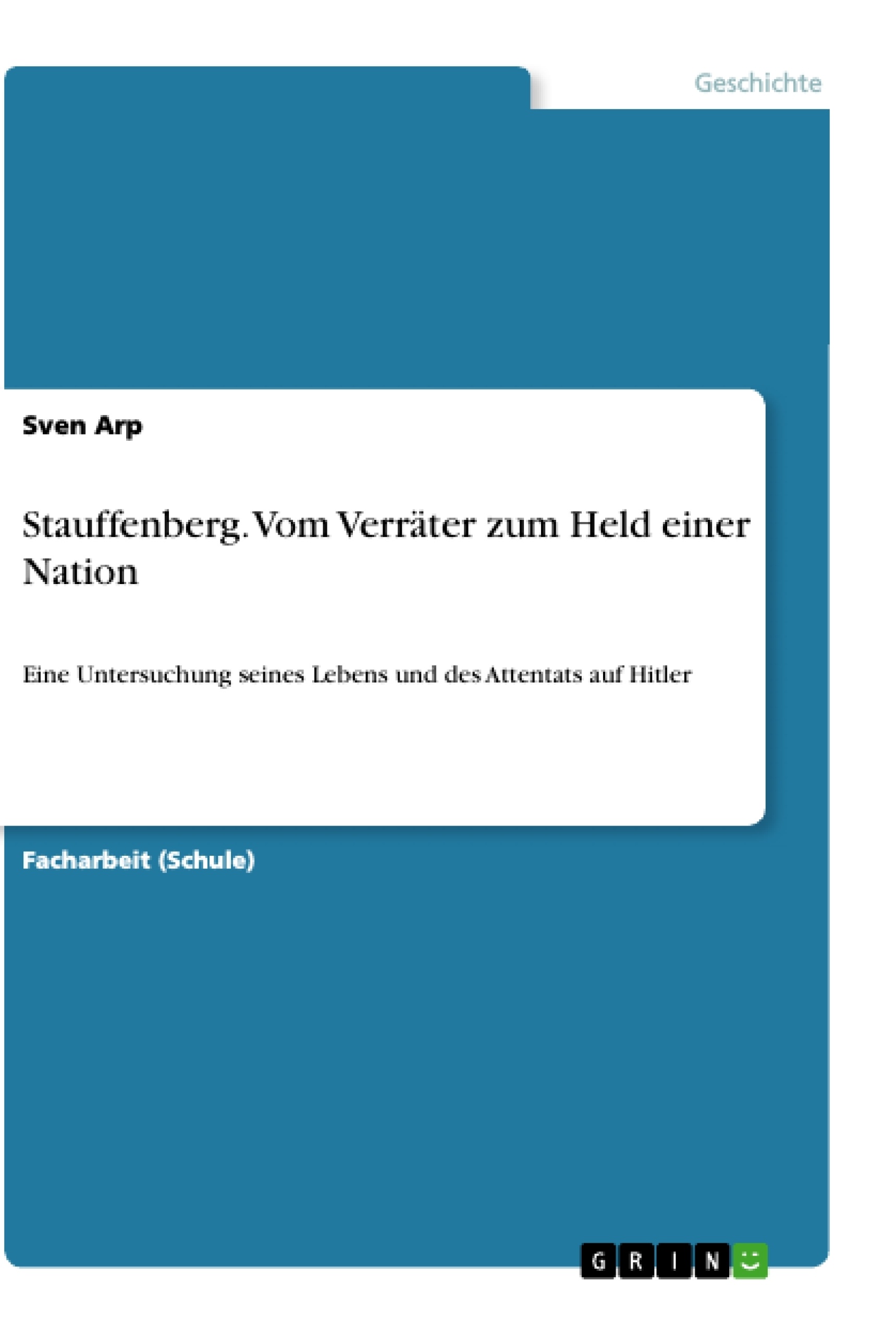In dieser Facharbeit geht es darum, ob Stauffenberg ein Verräter war, und wie Sicht die Sicht auf Stauffenberg im Laufe der Geschichte geändert hat. Es wird zunächst seine Biographie skizziert, schließlich erfolgt eine Untersuchung des Attentats.
Die Zeit des Nationalsozialismus und der zweite Weltkrieg sind entscheidende Phasen unserer Geschichte. Bis heute erscheinen immer wieder neue Bücher über Stauffenberg. Dies zeigt, dass diese Persönlichkeit in ihrer Vielschichtigkeit bis heute immer wieder neu diskutiert wird. Diese Facharbeit beschäftigt sich mit dem Lebenslauf, dazu gehört seine Jugend, sein Werdegang in der Wehrmacht, und die Entscheidung zum Widerstand. Für die spätere Bewertung Stauffenbergs wird das Attentat des 20. Juli 1944 beschrieben und die Gründe für das Scheitern aufgezeigt. Im nächsten Schritt wird die Frage gestellt, wie sich die Sicht auf Stauffenberg und das Attentat im Laufe der Zeit veränderte.
75 Jahre nach dem Ereignis macht sich am Beispiel Stauffenbergs fest, in welchem Maße der Einzelne mit einer moralischen Entscheidung in die Geschichte eingreifen kann. Auch wenn er dabei scheitert, kann er bis heute als Vorbild oder sogar als Held aufgefasst werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Person Stauffenberg
- 2.1 Kindheit, Jugend und Karriere
- 2.2 Wehrmacht
- 2.3 Widerstand
- 3 Der 20. Juli 1944
- 3.1 Durchführung
- 3.2 Unmittelbare Folgen
- 3.3 Warum das Attentat scheiterte
- 4 Die Sicht auf Stauffenberg und das Attentat
- 4.1 Der „Verräter“ – Ein Feind des 3. Reiches
- 4.2 „Der Held“ - Rehabilitierung in der Nachkriegszeit
- 4.3 Gedenken in den 1960er und 1970er Jahren
- 4.3.1 BRD
- 4.3.2 DDR
- 4.4 Das Gedenken Heute
- 5 Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Facharbeit untersucht die Entwicklung der Wahrnehmung Claus Schenk Graf von Stauffenbergs und seines Attentats vom 20. Juli 1944 im Laufe der Zeit. Ziel ist es, die vielschichtigen Aspekte seiner Persönlichkeit und die sich verändernde Bewertung seines Handelns aufzuzeigen. Die Arbeit beleuchtet Stauffenbergs Leben, seine Rolle in der Wehrmacht und seine Beteiligung am Widerstand.
- Stauffenbergs Leben und Werdegang
- Das Attentat vom 20. Juli 1944 und seine Folgen
- Die unterschiedliche Bewertung Stauffenbergs in der Geschichte
- Die Entwicklung des Gedenkens an Stauffenberg
- Die moralische Dimension von Stauffenbergs Handeln
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Motivation der Arbeit. Ausgehend von einer spekulativen Frage nach den Folgen eines erfolgreichen Attentats wird das Interesse an Stauffenberg und der Entwicklung seiner Bewertung begründet. Die Arbeit skizziert ihren Aufbau und betont die Bedeutung von Stauffenbergs Handeln für die deutsche Geschichte und die ethischen Fragen, die sich daraus ergeben.
2 Die Person Stauffenberg: Dieses Kapitel zeichnet ein umfassendes Bild von Stauffenbergs Leben, beginnend mit seiner Kindheit in einer katholischen Adelsfamilie. Es beschreibt seine schulische Laufbahn, seine militärische Karriere und seine politischen Entwicklungen, welche von Einflüssen wie der bündischen Jugend und dem Dichter Stefan George geprägt waren. Die Darstellung legt den Fokus auf seine politische Entwicklung hin zum Widerstand, der durch den Nationalsozialismus und seine Verbrechen ausgelöst wurde, und zeigt die Spannungen zwischen seinem militärischen Dienst und seiner moralischen Überzeugung.
3 Der 20. Juli 1944: Dieses Kapitel analysiert das Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 detailliert. Es beleuchtet die Planung und Durchführung des Attentats, die unmittelbaren Folgen und die Gründe für dessen Scheitern. Die Analyse konzentriert sich auf die strategischen und taktischen Aspekte des Attentatsversuches sowie die komplexen Umstände, die zu seinem Misserfolg beitrugen.
4 Die Sicht auf Stauffenberg und das Attentat: Dieses Kapitel befasst sich mit der sich wandelnden Wahrnehmung Stauffenbergs und des Attentats im Laufe der Zeit. Es untersucht die unterschiedlichen Deutungen – von "Verräter" in der NS-Zeit bis hin zum "Helden" der Nachkriegszeit – und analysiert die Entwicklung des Gedenkens in BRD und DDR. Die verschiedenen Perspektiven und politischen Interpretationen werden hier in ihrer Entwicklung untersucht, beleuchtend, wie sich die öffentliche Meinung und die historische Bewertung dieses Ereignisses verändert haben.
Schlüsselwörter
Claus Schenk Graf von Stauffenberg, 20. Juli 1944, Attentat, Widerstand, Nationalsozialismus, Wehrmacht, Held, Verräter, Rehabilitierung, Gedenken, Moral, Geschichte Deutschlands.
Häufig gestellte Fragen zur Facharbeit: Claus Schenk Graf von Stauffenberg und das Attentat vom 20. Juli 1944
Was ist der Inhalt dieser Facharbeit?
Die Facharbeit untersucht die Entwicklung der Wahrnehmung Claus Schenk Graf von Stauffenbergs und seines Attentats vom 20. Juli 1944 im Laufe der Zeit. Sie beleuchtet Stauffenbergs Leben, seine Rolle in der Wehrmacht, seine Beteiligung am Widerstand, das Attentat selbst, dessen Folgen und die sich verändernde Bewertung seines Handelns in der Geschichte Deutschlands. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Perspektiven und Interpretationen, von "Verräter" bis "Held", und betrachtet die Entwicklung des Gedenkens an Stauffenberg in der BRD und der DDR.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf Stauffenbergs Leben und Werdegang, das Attentat vom 20. Juli 1944 und dessen Folgen, die unterschiedliche Bewertung Stauffenbergs in der Geschichte, die Entwicklung des Gedenkens an ihn und die moralische Dimension seines Handelns.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel über Stauffenbergs Leben, ein Kapitel über das Attentat vom 20. Juli 1944, ein Kapitel über die sich verändernde Wahrnehmung Stauffenbergs und des Attentats im Laufe der Zeit und abschließend eine Zusammenfassung und einen Ausblick.
Wie wird Stauffenberg in der Arbeit dargestellt?
Die Arbeit zeichnet ein umfassendes Bild von Stauffenbergs Leben, von seiner Kindheit bis zu seiner Beteiligung am Widerstand. Sie zeigt seine politische Entwicklung und die Spannungen zwischen seinem militärischen Dienst und seiner moralischen Überzeugung.
Wie wird das Attentat vom 20. Juli 1944 dargestellt?
Das Kapitel zum Attentat analysiert detailliert die Planung und Durchführung, die unmittelbaren Folgen und die Gründe für das Scheitern des Attentats. Es konzentriert sich auf die strategischen und taktischen Aspekte sowie die komplexen Umstände, die zum Misserfolg beitrugen.
Wie hat sich die Bewertung Stauffenbergs im Laufe der Zeit verändert?
Die Arbeit untersucht die unterschiedlichen Deutungen Stauffenbergs und des Attentats, von der NS-Propaganda, die ihn als "Verräter" bezeichnete, bis hin zur Rehabilitierung und Heldenverehrung in der Nachkriegszeit. Sie analysiert die Entwicklung des Gedenkens in der BRD und der DDR und die verschiedenen politischen Interpretationen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Claus Schenk Graf von Stauffenberg, 20. Juli 1944, Attentat, Widerstand, Nationalsozialismus, Wehrmacht, Held, Verräter, Rehabilitierung, Gedenken, Moral, Geschichte Deutschlands.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die vielschichtigen Aspekte von Stauffenbergs Persönlichkeit und die sich verändernde Bewertung seines Handelns aufzuzeigen. Sie möchte die unterschiedlichen Perspektiven und Interpretationen seines Tuns im historischen Kontext analysieren und verstehen.
- Quote paper
- Sven Arp (Author), 2019, Stauffenberg. Vom Verräter zum Held einer Nation, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/502992