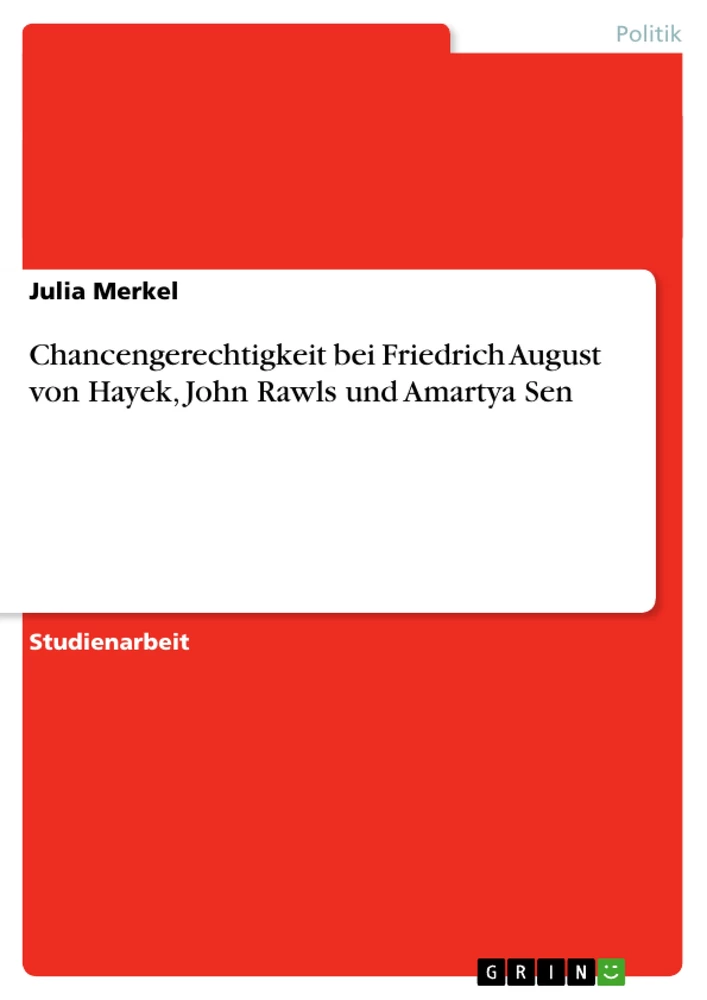Aristoteles unterscheidet zwei Arten der Gerechtigkeit: die iusitia directiva und die iustitia distributiva. Erstere ist eine ausgleichende, entschädigende Gerechtigkeit, die entweder durch Rechtsbruch (ex delictu) oder Vertragsverpflichtungen (ex contractu) bindend eingefordert werden kann. Letztere, die iustitia distributiva, die verteilende Gerechtigkeit, besitzt diese rechtsförmige Verbindlichkeit nicht. Sie wird heute synonym zur Verteilungsgerechtigkeit oder der sozialen Gerechtigkeit gebraucht (Kersting 2000a: 17) und ist je nach weltanschaulicher Orientierung umstritten. Eben diese iustitia distributiva wird in ihrer unterschiedlichen Ausdeutung im Zentrum dieser Arbeit stehen. Die iustitia directiva wird hier nicht in die Erörterung mit einbezogen werden
Die Verteilungsgerechtigkeit wurde im Verlaufe des 20. Jahrhunderts lange und häufig nur als die gleiche a priori Verteilung von Rechten und insbesondere die gerechte ex post Verteilung von Gütern und monetären Transfers verstanden. Darauf bauen die meisten demokratischen Wohlfahrtsstaaten des europäischen Kontinents auf. Dies, so eine sich verbreiternde Erkenntnis, scheint in den ausdifferenzierten Gesellschaften der postindustriellen Staaten nicht mehr auszureichen, um verkrustete Statuszuweisungen und vererbte Klassenzugehörigkeiten aufzubrechen und sich einer einsehbar fairen Verteilung von Lebenschancen anzunähern. Die gerechte Verteilung von Chancen hat nicht zuletzt deshalb in den neueren politischen Gerechtigkeitstheorien an Bedeutung gewonnen. Das Wissen darum, dass Lebenschancen die eigentlichen Entscheidungsfaktoren für ein selbst bestimmtes, "gutes Leben" (Aristoteles) sein können, ist insbesondere den liberalen Gerechtigkeitstheorien in den letzten Jahrzehnten zunehmend eingeschrieben worden. Ist es dies tatsächlich? Und wenn ja, in gleicher Weise? Reicht allein schon der unverbrüchliche Ausgangspunkt vom Individuum her zu denken, um zu gleichen Schlussfolgerungen bei den Verteilungsstrukturen und Verteilungsergebnissen zu gelangen? Zweifel sind angebracht und diesen sollen in dieser Arbeit nachgegangen werden.
Vor diesem Hintergrund arbeitet die Autorin die Chancengerechtigkeit in den Theorien von Friedrich August von Hayek, John Rawls und Amartya Sen heraus. Sie hat damit drei liberale Konzeptionen der Gerechtigkeit gewählt, die diesen Begriff unterschiedlich fassen und der Gerechtigkeit der Chancenverteilung in ihren Theorien einen unterschiedlichen Stellenwert zumessen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Chancengerechtigkeit bei Friedrich August von Hayek
- Prämissen: Freiheit, Eigentum und Markt
- Begründung: Vertragsfreiheit und Meritokratie
- Verteilungskonsequenzen: Libertäre Ungleichheit
- Chancengerechtigkeit bei John Rawls
- Prämissen: Grundgüter und Grundsätze der Gerechtigkeit
- Begründung: Urzustand, Rationalität und Maximin-Regel
- Verteilungskonsequenzen: „Faire Chancengleichheit“
- Chancengerechtigkeit bei Amartya Sen
- Prämissen: Individuelle Freiheit
- Begründung: Optimale Wahlfreiheit
- Verteilungskonsequenzen: „Selbst bestimmte Chancengerechtigkeit“
- Fazit: Chancengerechtigkeit im 21. Jahrhundert
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konzepte der Chancengerechtigkeit bei drei einflussreichen liberalen Denkern: Friedrich August von Hayek, John Rawls und Amartya Sen. Ziel ist es, die unterschiedlichen Auffassungen von Chancengerechtigkeit und deren Verteilungskonsequenzen zu vergleichen und zu analysieren. Der Fokus liegt auf den jeweiligen Prämissen, Begründungen und den daraus resultierenden Schlussfolgerungen für die Gestaltung einer gerechten Gesellschaft.
- Vergleich der Konzepte von Chancengerechtigkeit bei Hayek, Rawls und Sen
- Analyse der unterschiedlichen Prämissen und Begründungen
- Untersuchung der Verteilungskonsequenzen der jeweiligen Theorien
- Bewertung der Tauglichkeit der Konzepte für moderne Gesellschaften
- Diskussion der Rolle von Staat und Markt bei der Gestaltung gerechter Chancenverteilungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Verteilungsgerechtigkeit ein und differenziert zwischen ausgleichender und verteilender Gerechtigkeit. Sie argumentiert für die wachsende Bedeutung von Chancengerechtigkeit in modernen Gesellschaften und kündigt den Vergleich der Konzepte von Hayek, Rawls und Sen an, wobei die Unterschiede in Prämissen, Begründungen und Verteilungskonsequenzen im Mittelpunkt stehen. Die Arbeit betont die unterschiedlichen theoretischen Ansätze der drei Autoren und ihre jeweilige Relevanz für die Diskussion um Chancengerechtigkeit im 21. Jahrhundert.
1. Chancengerechtigkeit bei Friedrich August von Hayek: Dieses Kapitel untersucht Hayeks Verständnis von Chancengerechtigkeit, das stark mit seinem Konzept der individuellen Freiheit und des freien Marktes verbunden ist. Hayek priorisiert die uneingeschränkte Freiheit des Individuums und sieht in staatlichen Eingriffen zur Umverteilung von Ressourcen eine Gefahr für diese Freiheit. Eigentum wird als Voraussetzung und Ergebnis von Freiheit betrachtet. Das Kapitel analysiert Hayeks Ablehnung von staatlicher Intervention zur Erreichung von sozialer Gerechtigkeit und konzentriert sich auf seine Betonung der formalen Gleichheit vor dem Gesetz als Basis für eine gerechte Gesellschaft. Der Fokus liegt auf der Bedeutung des freien Marktes als Mechanismus zur Chancengestaltung, ohne dabei explizit eine gerechte Verteilung von Chancen zu definieren.
Schlüsselwörter
Chancengerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit, Friedrich August von Hayek, John Rawls, Amartya Sen, Liberalismus, Freiheit, Markt, Eigentum, soziale Gerechtigkeit, Grundgüter, faire Chancengleichheit, individuelle Freiheit, Verteilungskonsequenzen, Miniminalstaat, wohlfahrtsstaatliche Modelle.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Chancengerechtigkeit bei Hayek, Rawls und Sen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht und analysiert die Konzepte der Chancengerechtigkeit bei drei einflussreichen liberalen Denkern: Friedrich August von Hayek, John Rawls und Amartya Sen. Der Fokus liegt auf den jeweiligen Prämissen, Begründungen und den daraus resultierenden Schlussfolgerungen für die Gestaltung einer gerechten Gesellschaft.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die unterschiedlichen Auffassungen von Chancengerechtigkeit und deren Verteilungskonsequenzen. Es werden die Prämissen und Begründungen der drei Denker verglichen, die Verteilungskonsequenzen ihrer Theorien analysiert und die Tauglichkeit der Konzepte für moderne Gesellschaften bewertet. Die Rolle von Staat und Markt bei der Gestaltung gerechter Chancenverteilungen wird ebenfalls diskutiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit enthält eine Einleitung, Kapitel zu Chancengerechtigkeit bei Hayek, Rawls und Sen, sowie ein Fazit. Jedes Kapitel zu den einzelnen Denkern untersucht deren Prämissen (z.B. Freiheit, Eigentum, Grundgüter), Begründungen (z.B. Vertragsfreiheit, Urzustand, optimale Wahlfreiheit) und die daraus resultierenden Verteilungskonsequenzen (z.B. libertäre Ungleichheit, faire Chancengleichheit, selbstbestimmte Chancengerechtigkeit).
Was ist Hayeks Verständnis von Chancengerechtigkeit?
Hayeks Verständnis von Chancengerechtigkeit ist eng mit seinem Konzept der individuellen Freiheit und des freien Marktes verknüpft. Er priorisiert die uneingeschränkte Freiheit des Individuums und sieht staatliche Eingriffe zur Umverteilung als Gefahr für diese Freiheit. Eigentum wird als Voraussetzung und Ergebnis von Freiheit betrachtet. Hayek betont die formale Gleichheit vor dem Gesetz, lehnt staatliche Intervention zur Erreichung sozialer Gerechtigkeit ab und sieht den freien Markt als Mechanismus zur Chancengestaltung.
Wie definiert Rawls Chancengerechtigkeit?
Rawls' Konzept basiert auf Grundgütern und Grundsätzen der Gerechtigkeit, die im Urzustand unter Bedingungen der Rationalität und der Maximin-Regel ermittelt werden. Dies führt zu einer „fairen Chancengleichheit“, die Ungleichheiten nur dann zulässt, wenn sie auch den am schlechtesten gestellten Mitgliedern der Gesellschaft zugutekommen.
Was ist Sens Ansatz zur Chancengerechtigkeit?
Sen betont die individuelle Freiheit und die optimale Wahlfreiheit als Grundlage für Chancengerechtigkeit. Seine Theorie zielt auf eine „selbstbestimmte Chancengerechtigkeit“, die den Individuen die Möglichkeit gibt, ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten frei zu entfalten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Chancengerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit, Friedrich August von Hayek, John Rawls, Amartya Sen, Liberalismus, Freiheit, Markt, Eigentum, soziale Gerechtigkeit, Grundgüter, faire Chancengleichheit, individuelle Freiheit, Verteilungskonsequenzen, Minimalstaat, wohlfahrtsstaatliche Modelle.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit der Arbeit fasst die unterschiedlichen Konzepte von Chancengerechtigkeit zusammen und bewertet deren Tauglichkeit für moderne Gesellschaften im 21. Jahrhundert. Es diskutiert die Herausforderungen und Chancen einer gerechten Gestaltung von Chancenverteilungen unter Berücksichtigung der jeweiligen Stärken und Schwächen der vorgestellten Theorien.
- Quote paper
- Julia Merkel (Author), 2005, Chancengerechtigkeit bei Friedrich August von Hayek, John Rawls und Amartya Sen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/50285