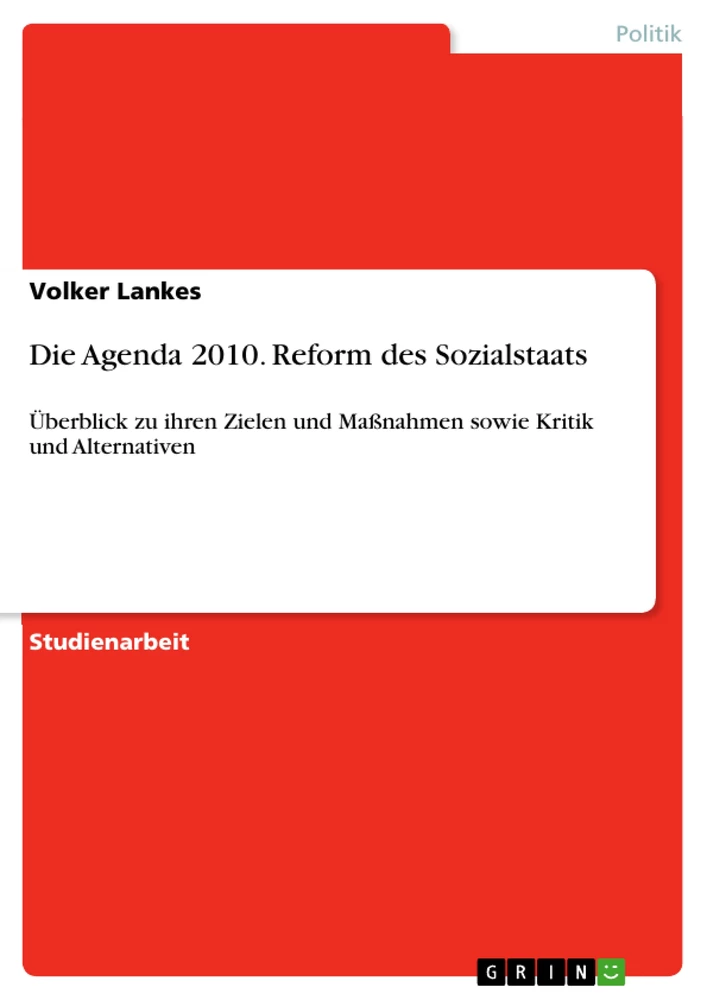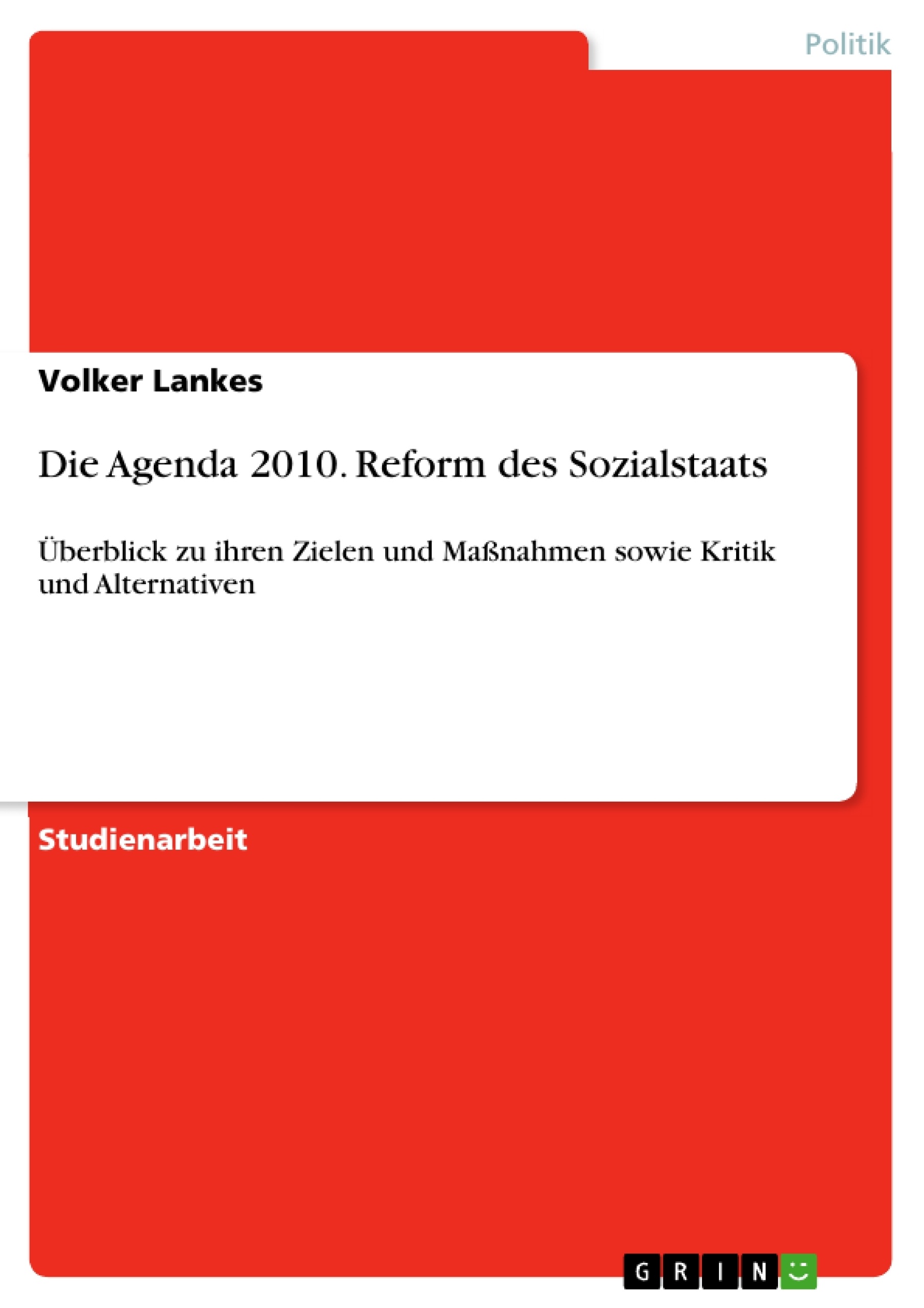Im März 2003 legte die Bundesregierung unter Kanzler Gerhard Schröder ein Programm zur Reform des Sozialstaates vor. Die so genannte „Agenda 2010“ traf sowohl im regierenden als auch im opponierenden Teil des Bundestages auf breite Zustimmung. Gegenstimmen gab es vor allem in den Gewerkschaften und der Wirtschaft, aber auch in linksgerichteten Politiklagern. Die Forderungen Schröders an die Reformen lauten: „Wir werden Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fördern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen“ 1. Notwendig wurden die sozialen Reformen aus verschiedenen Gründen.
Zum einen sorgt die schwache Konjunktur in Deutschland, die sich nicht nur auf die allgemein schlechte Wirtschaftslage in der Welt, sondern auch auf hohe Lohnnebenkosten zurückführen lässt, allmählich für ein Abwandern der Betriebe ins Ausland und in Verbindung mit einem insgesamt unflexiblen Arbeitsmarkt somit zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit. Die Zurückhaltung der Verbraucher beim Konsum verunsichert die Unternehmer und verstärkt dadurch diesen Trend zusätzlich.
Zum anderen ist die finanzielle Lage im Bereich der Sozialleistungen einerseits durch das teuere Gesundheitswesen, andererseits durch die demografische Schieflage unserer Gesellschaft – zu wenige Kinder für die immer weiter ansteigende Zahl von älteren Menschen – in hohem Maße angespannt. „Bis zum so genannten „Pillenknick“ des Jahres 1969 brachte jede Frau in Deutschland durchschnittlich 2,1 Kinder zur Welt – damit blieb das zahlenmäßige Verhältnis zwischen den Generationen stabil. Seit 1975 hat sich die Geburtenrate in den alten Bundesländern jedoch bei nur 1,4 Kindern eingependelt. Auch in den neuen Bundesländern nähert sich die Geburtenrate seit 1990 diesem Wert an. Die Altersstruktur in Deutschland – also das zahlenmäßige Verhältnis zwischen beitragszahlenden und beitragsempfangenden Generationen – und unser darauf aufbauendes Rentensystem gerät daher zunehmend aus dem Gleichgewicht.
Die Ursachen gilt es in den Griff zu bekommen, um die derzeitige Situation zu verbessern und damit das Land sowohl im Inneren als auch nach außen hin wieder handlungsfähiger, flexibel und wettbewerbsfähig zu machen. Die Agenda 2010 stellt den Lösungsvorschlag der rot-grünen Bundesregierung dar und soll im Folgenden in ihrer Beschaffenheit vorgestellt und anschließend durch das Hinzuziehen kritischer Stimmen hinterfragt, sowie mit eventuellen Alternativen verglichen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Ziele und Maßnahmen der Agenda 2010
- Ziele
- Einzelne Maßnahmen
- Wirtschaft
- Arbeitsmarkt
- Steuern
- Gesundheit
- Rente
- Ausbildung
- Bildung
- 20-Punkte-Programm
- Kritik
- Alternativen
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Agenda 2010, ein im März 2003 von der Bundesregierung unter Gerhard Schröder vorgelegtes Reformpaket, zielte auf eine grundlegende Überarbeitung des Sozialstaats. Die Agenda hatte zum Ziel, Deutschlands Wirtschaft zu stärken, die Staatsfinanzen zu konsolidieren und die soziale Sicherheit zu gewährleisten, wenngleich auch in eingeschränktem Umfang. Die Reformen stießen auf breite Zustimmung im Bundestag, stießen aber auch auf Kritik, insbesondere von Gewerkschaften, der Wirtschaft und linksgerichteten Politikern.
- Reform des Sozialstaats und Stärkung der Wirtschaft
- Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im internationalen Kontext
- Steuerung der demografischen Entwicklung und Sicherung der Altersvorsorge
- Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und Reduzierung der Arbeitslosigkeit
- Verbesserung der Bildung und Ausbildung für den Nachwuchs
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Ziele und Maßnahmen der Agenda 2010, die die Bundesregierung für die Erreichung einer dynamischen Wirtschaft, konsolidierte Staatsfinanzen und soziale Sicherheit als notwendig erachtete. Dabei werden verschiedene Maßnahmen im Detail vorgestellt, darunter die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes durch die Aufhebung des Kündigungsschutzes für Kleinbetriebe, die Erleichterung von Unternehmensgründungen durch die Aufhebung des Meisterzwangs in bestimmten Handwerksberufen und die Einführung von befristeten Arbeitsverträgen.
Schlüsselwörter
Agenda 2010, Sozialstaat, Reform, Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Kündigungsschutz, Meisterzwang, Staatsfinanzen, Konsolidierung, Bildung, Ausbildung, Wettbewerbsfähigkeit, Demografischer Wandel, Altersvorsorge, Arbeitslosigkeit.
- Quote paper
- Volker Lankes (Author), 2005, Die Agenda 2010. Reform des Sozialstaats, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/50249