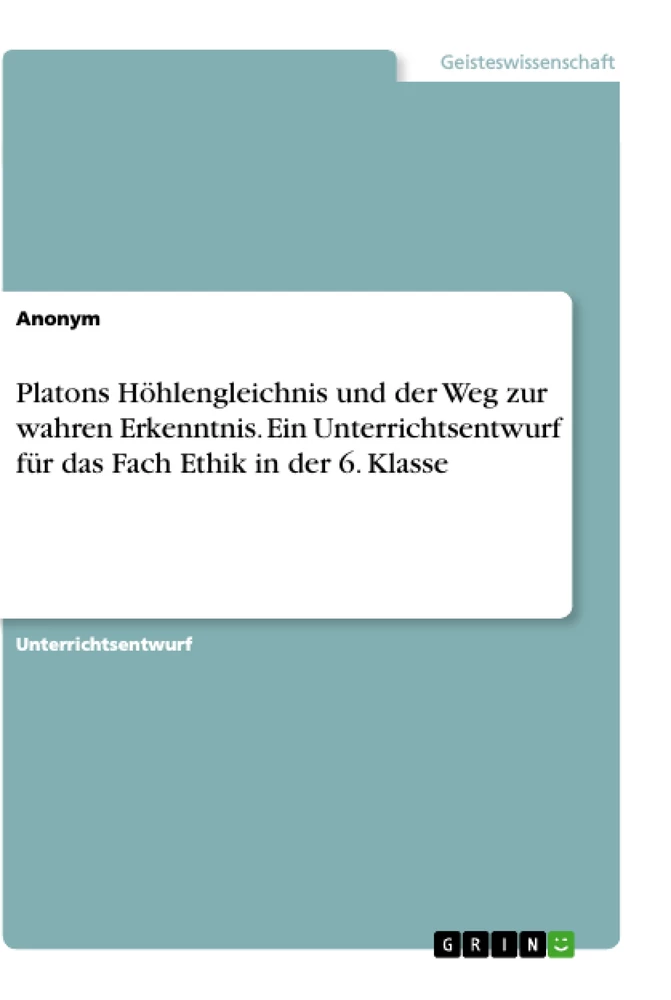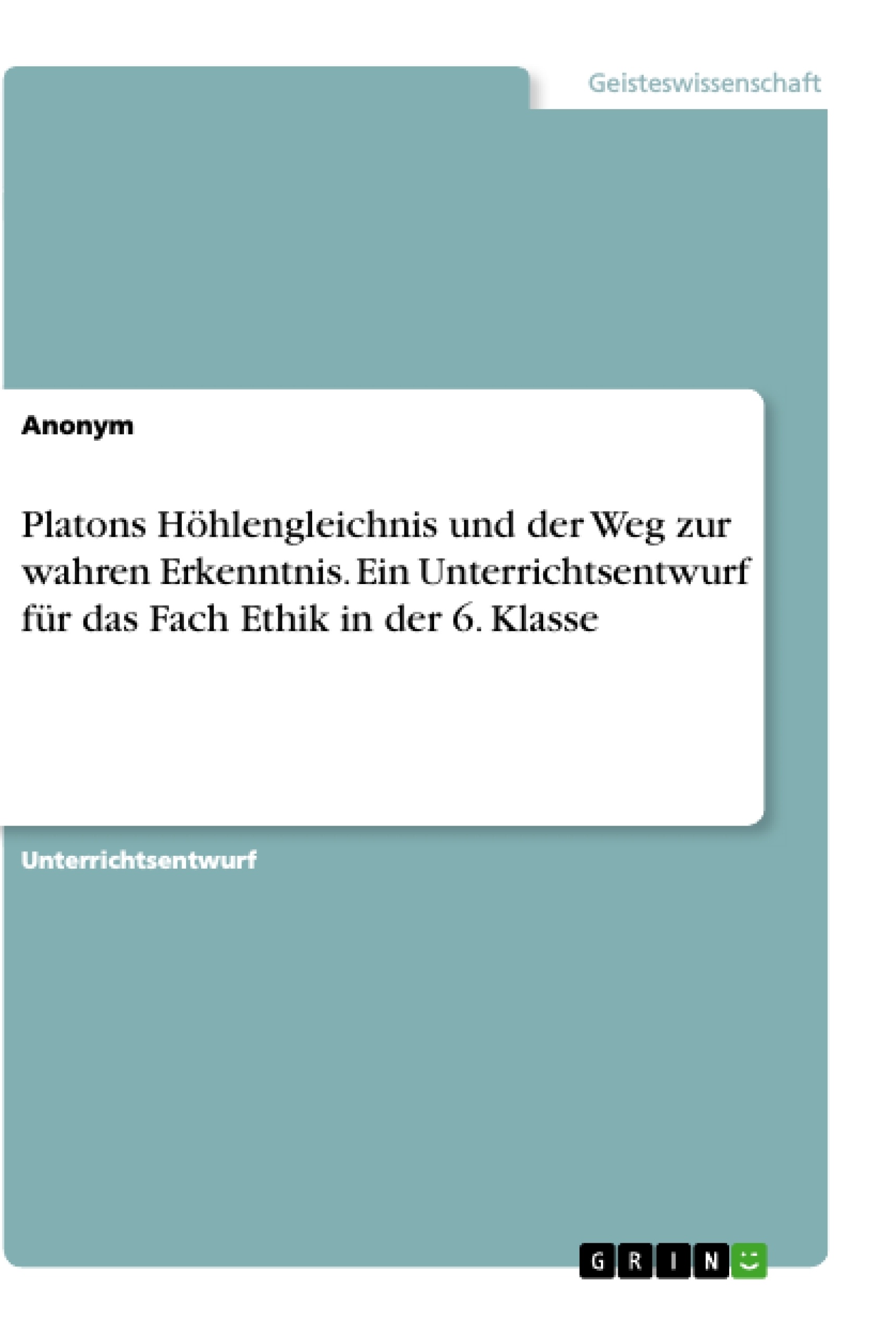Mit Hilfe dieses Unterrichtsentwurfs entwickeln die Schüler ein Bewusstsein dafür, dass ihre Wahrnehmung nur unzulänglich dafür geeignet ist, die Wirklichkeit zu erkennen und es mehr braucht, um zur wahren Erkenntnis zu gelangen, indem sie sich mit Platons Höhlengleichnis auseinandersetzen und Platons Weg zur wahren Erkenntnis analysieren.
Das Höhlengleichnis befindet sich im siebten Buch Platons, der "Politeia". Dieses Werk befasst sich in erster Linie mit Platons Versuch eines idealen Staates, stellt dabei aber auch die Frage nach der wahren Erkenntnis. Dieser Frage liegt die Vorstellung zugrunde, die als Ideenlehre bekannt ist. Platon beschreibt dabei ein angenommenes Reich immaterieller, ewiger und unveränderlicher Wesenheiten, die er als Ideen bzw. Urbilder bezeichnet.
Diese Ideen können als übergeordnete Musterbilder verstanden werden, die hinter den verschiedenen, sinnlich wahrnehmbaren Phänomenen in der Natur stehen. Platon verfolgt dabei die Annahme, dass die Seele des Menschen sich an die Idee wieder erinnern kann, da sie sie schon aus einem früheren, jenseitigen Dasein kennen würde. Diesen Vorgang bezeichnet er als Anamnesis: "Wiedererinnerung". Der Mensch hatte in gewisser Weise Einblick auf die Ideen, dies aber vergessen. Wenn wir nun den Abbildern, den Nachahmungen, der wahren Ideen in der Welt begegnen, kehrt diese Erinnerung wieder zurück.
Inhaltsverzeichnis
- Kompetenzlernziele
- Bemerkungen zum Kurs
- Eigene Tätigkeit
- Bild des Kurses
- Stand der Klasse
- Sachanalyse
- Begründung der didaktischen Entscheidung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Unterrichtseinheit zielt darauf ab, dass die Schüler ein Bewusstsein für die Unzulänglichkeit ihrer Wahrnehmung entwickeln und erkennen, dass mehr notwendig ist, um zu wahrer Erkenntnis zu gelangen. Dies geschieht anhand der Auseinandersetzung mit Platons Höhlengleichnis und der Analyse seines Weges zur wahren Erkenntnis.
- Kritik an der sinnlichen Wahrnehmung
- Platons Ideenlehre und die Unterscheidung zwischen Idee und Ding
- Der Weg zur wahren Erkenntnis nach Platon
- Die Idee des Guten als Ursprung aller Ideen
- Das Höhlengleichnis als Veranschaulichung des Weges zur wahren Erkenntnis
Zusammenfassung der Kapitel
Kompetenzlernziele
Das Lernziel der Unterrichtseinheit ist es, dass die Schüler ein Bewusstsein für die Unzulänglichkeit ihrer Wahrnehmung entwickeln und erkennen, dass mehr notwendig ist, um zu wahrer Erkenntnis zu gelangen. Dies geschieht anhand der Auseinandersetzung mit Platons Höhlengleichnis und der Analyse seines Weges zur wahren Erkenntnis.
Bemerkungen zum Kurs
Die Einheit findet im Rahmen eines Ethikkurses an einem Gymnasium statt, der von dem Ersteller der Unterrichtsplanung geleitet wird. Der Kurs besteht aus 28 Schülern, darunter zwei Schülerinnen mit Deutschlernschwierigkeiten, die am Unterricht teilnehmen, jedoch oft mit DAZ Aufgaben beschäftigt sind. Die Lerngruppe ist im Allgemeinen aufgeweckt, neugierig und motiviert, zeigt ein gut ausgeprägtes Kommunikationsverhalten und nimmt aktiv am Unterricht teil. Einige Schüler müssen jedoch häufig ermuntert werden, sich zu beteiligen und die geforderten Aufgaben zu bearbeiten. Das allgemeine Leistungsniveau der Lerngruppe wird als hoch eingeschätzt, es gibt jedoch auch 12 Schüler, die versetzungsgefährdet sind.
Sachanalyse
Das Höhlengleichnis ist ein zentrales Element in Platons Werk "Politeia", in dem er sich mit der Frage nach der wahren Erkenntnis beschäftigt. Platon beschreibt ein Reich immaterieller, ewiger und unveränderlicher Wesenheiten, die er als Ideen oder Urbilder bezeichnet. Diese Ideen können als übergeordnete "Musterbilder" verstanden werden, die hinter den verschiedenen, sinnlich wahrnehmbaren Phänomenen in der Natur stehen. Platon geht davon aus, dass die Seele des Menschen sich an die Idee erinnern kann, da sie sie schon "aus einem früheren, jenseitigen Dasein" kennen würde. Diesen Vorgang bezeichnet er als Anamnesis - Wiedererinnerung. Jeder Mensch kann demnach zu diesen Ideen gelangen, allerdings nicht durch sinnliche Wahrnehmung, sondern nur durch die Zuhilfenahme der Vernunft. Über alles in der sinnlich wahrnehmbaren Welt, kann er niemals sicheres Wissen erlangen, sondern nur Meinungen und Gefühle, da die Sinne uns täuschen können und alles, außer den ewigen Ideen veränderlich und vergänglich ist.
Der zentrale Punkt in der Philosophie Platons ist die Idee des Guten - Agathon. Für Platon war das Gute der Ursprung aller Ideen und wird zum Beispiel im Sonnengleichnis durch die Sonne symbolisiert. Die Sonne verhält sich dabei zum Bereich des Sichtbaren, wie die Idee des Guten zum Denkbaren. So wie die Sonne uns die Erkenntnis sinnlicher Dinge ermöglicht, so ermöglicht uns die Idee des Guten die Erkenntnis von Intelligiblem. Das Höhlengleichnis veranschaulicht dabei den Weg, den ein Mensch gehen muss, um die Idee des Guten schauen zu können. Es ist der Weg des Philosophen von den unklaren Vorstellungen zu den wirklichen Ideen hinter den Phänomenen in der Natur.
Zusammengefasst lässt sich das Höhlengleichnis wie folgt beschreiben: Eine Gruppe von Menschen haust ihr Leben lang in einer unterirdischen Höhle, angekettet mit dem Gesicht ins Höhleninnere blickend. Hinter ihnen brennt ein Feuer, das die Schatten von Gegenständen an die Wand wirft. Dies ist das Einzige, was die Höhlenmenschen je gesehen haben und sie halten es für die Wirklichkeit. Eines Tages bricht einer aus ihren Reihen die Ketten, gelangt an die Oberfläche und erkennt, nachdem er vorerst von der Sonne geblendet wird, die wahre Welt, also die Urbilder. Nach seiner Entdeckung kehrt er in die Höhle zurück, um seinen Mitmenschen von seiner Entdeckung zu unterrichten. Er will sie überreden ihm diesen Aufstieg nachzutun. Sie verschreien ihn als Ketzer und Lügner und bringen ihn um.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Themen dieser Unterrichtseinheit sind: Platons Höhlengleichnis, wahre Erkenntnis, sinnliche Wahrnehmung, Ideenlehre, Idee des Guten, Anamnesis, Vernunft, Philosophie, Wirklichkeit.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Platons Höhlengleichnis und der Weg zur wahren Erkenntnis. Ein Unterrichtsentwurf für das Fach Ethik in der 6. Klasse, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/499094