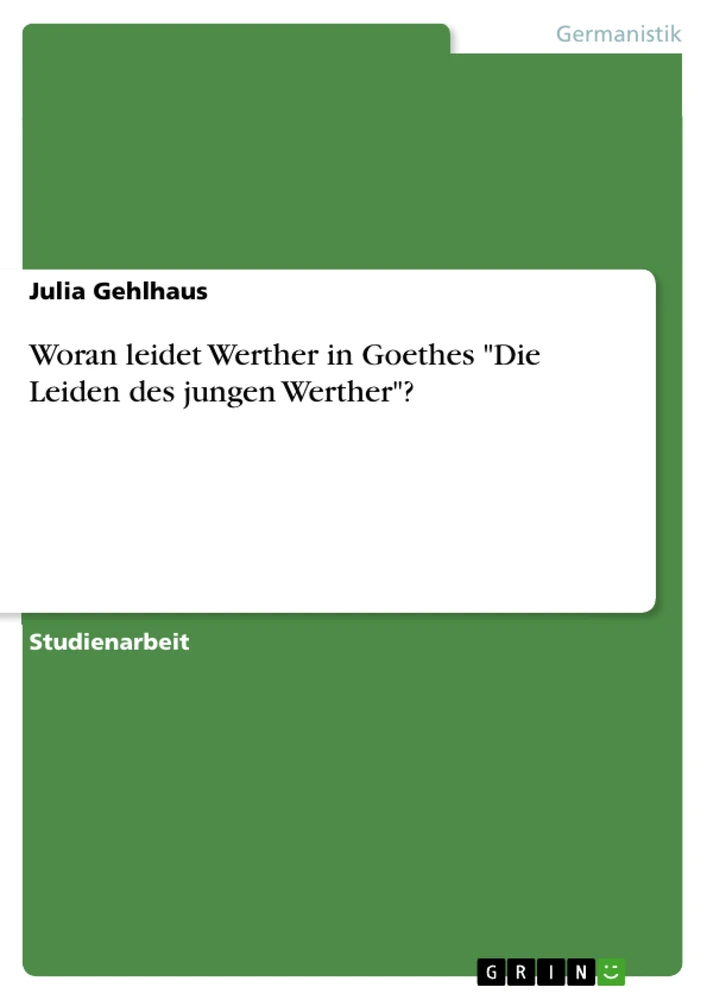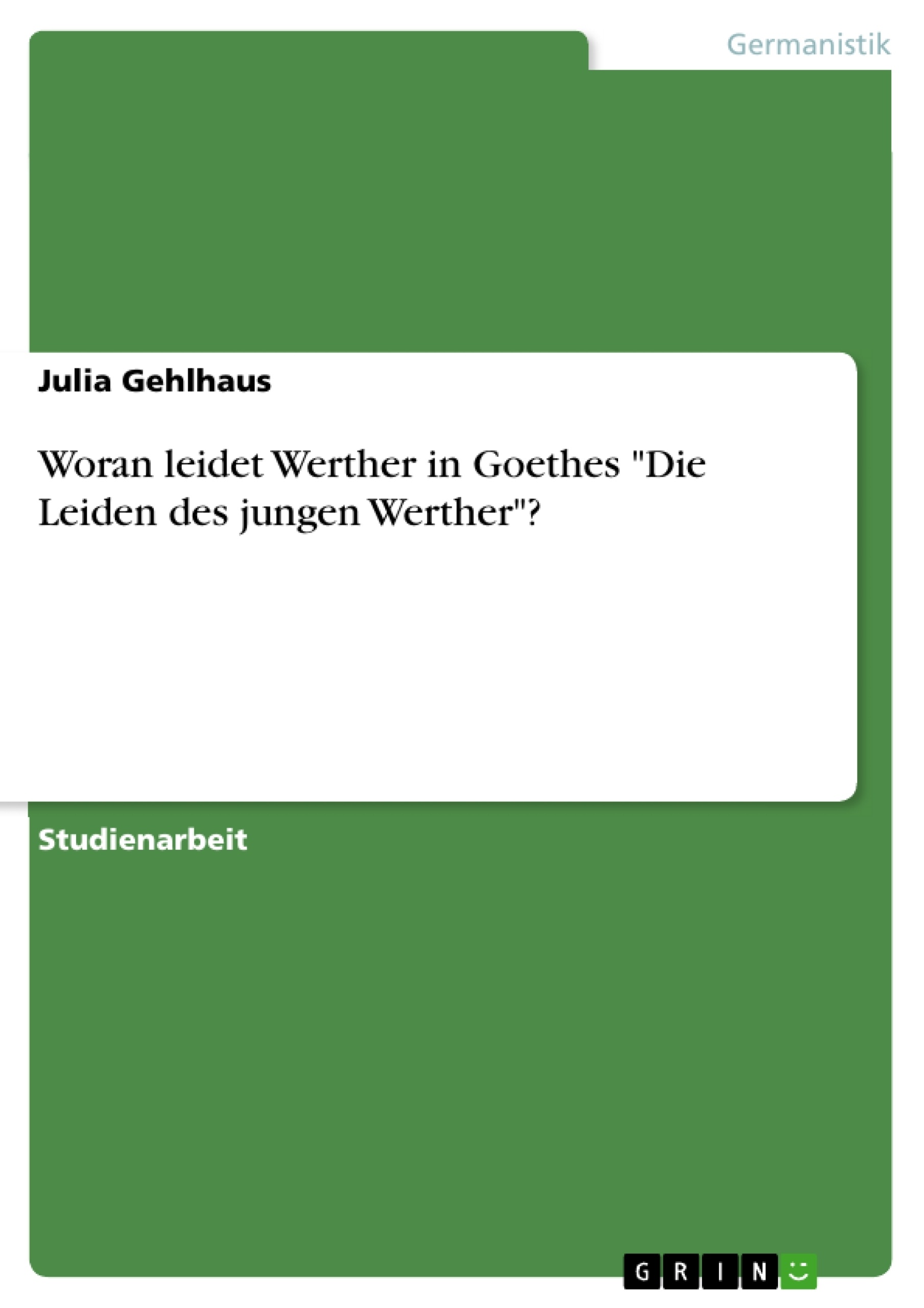In dieser Arbeit wird erörtert, welche Leidensaspekte Werthers Selbstmord in Goethes Roman "Die Leiden des jungen Werther" zugrunde liegen könnten. Im ersten Teil der Arbeit wird hierfür zunächst Werthers Leiden im Allgemeinen dargestellt. In den darauffolgenden Teilen werden dann im Spezifischen seine "Krankheit zum Tode" und sein "Leiden an der Gesellschaft" betrachtet. Da beide Themen sehr große Bereiche im Roman darstellen, beschränkt sich die Autorin auf folgende Teilgebiete: Werthers erster Eindruck von Wahlheim sowie dessen Wirkung auf ihn (3.1), die Ständegesellschaft und die sich daraus ergebende Problematik für Werther (3.2), seine Definition der Krankheit zum Tode (4.1) und sein Krankheitsverlauf, welcher sich über den gesamten Roman erstreckt (4.2). Abschließend folgen ein Fazit sowie ein Ausblick. Als Grundlage der Textarbeit dient die von Goethe überarbeitete zweite Version des Romans, welche erstmals 1787 veröffentlicht wurde.
Die von der katholischen Kirche und der vorausgegangenen Aufklärung überaus geprägte Gesellschaft des 18. Jahrhunderts empfindet Selbstmord als eine unvernünftige und feige Sünde. Dass nun gerade der hochgebildete Sympathieträger von Goethes Roman einen freiwilligen Tod vorzieht, entfacht seither Debatten und macht "Die Leiden des jungen Werther" bis heute zu einem viel beachteten und diskutierten Roman. Doch nicht alle Zeitgenossen reagieren mit Empörung und Abscheu, viele fühlen sich endlich verstanden. Dieses Gefühl des Verstandenwerdens führt zu vielen jungen Nachahmern und dem sogenannten "Wertherfieber". Doch was hat Werther in dem Roman dazu bewegt, sich selbst das Leben zu nehmen? War es lediglich die Trauer über seine unerwiderten Liebesgefühle zu Lotte? Oder kann sein Selbstmord sogar pathologisch am Text begründet werden?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Werthers Leiden
- 3. Leiden an der Gesellschaft
- 3.1 Werthers erster Eindruck von Wahlheim
- 3.2 Die Ständeproblematik
- 4. Krankheit zum Tode
- 4.1 Werthers Definition
- 4.2 Werthers Krankheitsverlauf
- 5. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Leidensaspekte, die zu Werthers Selbstmord in Goethes „Die Leiden des jungen Werther“ beitragen. Die Analyse konzentriert sich auf die Darstellung von Werthers Leiden im Allgemeinen, sein Leiden an der Gesellschaft und seine „Krankheit zum Tode“. Die Arbeit vermeidet weitreichende psychologische Interpretationen und konzentriert sich auf eine textnahe Analyse.
- Werthers Leiden im Allgemeinen und seine Vielschichtigkeit
- Werthers Schwierigkeiten, sich in die Gesellschaft zu integrieren
- Die Rolle der Ständekonflikte in Werthers Leid
- Werthers Verständnis seiner eigenen „Krankheit zum Tode“
- Der Verlauf von Werthers psychischem Zustand im Roman
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Ursachen von Werthers Selbstmord vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Reaktionen auf den Roman. Sie skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der sich auf eine textnahe Analyse konzentriert und verschiedene Aspekte von Werthers Leiden beleuchtet: sein Leiden im Allgemeinen, sein Leiden an der Gesellschaft (mit Fokus auf seinen ersten Eindruck von Wahlheim und die Ständeproblematik) und seine „Krankheit zum Tode“ (einschließlich seiner Definition und des Krankheitsverlaufs). Der Einleitung wird deutlich die vielschichtige Deutung des Selbstmords in der Literaturwissenschaft aufgezeigt.
2. Werthers Leiden: Dieses Kapitel analysiert die vielschichtigen Aspekte von Werthers Leiden, wie sie in der Literatur diskutiert werden. Es wird die Vielschichtigkeit des Themas betont und auf die Schwierigkeit hingewiesen, eine einzige Ursache für Werthers Selbstmord zu identifizieren. Es wird die Briefromanform und die interne Fokalisierung als Mittel zur Darstellung von Werthers Innenwelt hervorgehoben. Das Kapitel stellt die verschiedenen Interpretationsansätze vor, die von gesellschaftlichem Leiden bis hin zu psychischen Problemen reichen, und betont die Bedeutung einer textnahen Analyse, um übermäßige Interpretationen zu vermeiden. Bereits frühzeitig werden suizidale Tendenzen Werthers vor dem Treffen mit Lotte erwähnt.
3. Leiden an der Gesellschaft: Dieses Kapitel fokussiert sich auf Werthers Schwierigkeiten, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Der Abschnitt 3.1 beschreibt Werthers anfängliche Begeisterung für Wahlheim, die schnell in Enttäuschung umschlägt, als er die Schwierigkeiten feststellt, dort Anschluss zu finden. Sein Gefühl der Isolierung und seine kritische Betrachtung der Menschen in Wahlheim werden hier analysiert. Abschnitt 3.2 (nicht im Auszug enthalten) würde sich wahrscheinlich mit den sozialen und standesbedingten Beschränkungen befassen, die Werthers Leben prägen und zu seinem Leiden beitragen.
4. Krankheit zum Tode: Dieses Kapitel analysiert Werthers Verständnis seiner eigenen „Krankheit zum Tode“. Abschnitt 4.1 (nicht im Auszug enthalten) würde vermutlich Werthers eigene Definition seiner Krankheit und seine Wahrnehmung seines Zustands untersuchen. Abschnitt 4.2 (nicht im Auszug enthalten) würde den Verlauf von Werthers Krankheit über die gesamte Romanhandlung hinweg detailliert nachzeichnen und analysieren, wie sich sein psychischer Zustand entwickelt und verschlechtert.
Schlüsselwörter
Die Leiden des jungen Werther, Selbstmord, Gesellschaft, Ständegesellschaft, Liebeskummer, psychische Krankheit, textnahe Analyse, Briefroman, interne Fokalisierung, Goethe.
Häufig gestellte Fragen zu „Die Leiden des jungen Werther“-Analyse
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Ursachen von Werthers Selbstmord in Goethes „Die Leiden des jungen Werther“. Der Fokus liegt auf einer textnahen Untersuchung von Werthers Leiden im Allgemeinen, seinem Leiden an der Gesellschaft und seiner „Krankheit zum Tode“, wobei weitreichende psychologische Interpretationen vermieden werden.
Welche Themen werden in der Analyse behandelt?
Die Analyse befasst sich mit der Vielschichtigkeit von Werthers Leiden, seinen Schwierigkeiten, sich in die Gesellschaft zu integrieren, der Rolle von Ständekonflikten, Werthers Verständnis seiner eigenen „Krankheit zum Tode“ und dem Verlauf seines psychischen Zustands im Roman. Die Briefromanform und die interne Fokalisierung als narrative Mittel werden ebenfalls berücksichtigt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, die die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz beschreibt. Es folgen Kapitel zu Werthers Leiden im Allgemeinen, seinem Leiden an der Gesellschaft (einschließlich seines ersten Eindrucks von Wahlheim und der Ständeproblematik) und seiner „Krankheit zum Tode“ (einschließlich seiner Definition und des Krankheitsverlaufs). Die Arbeit schließt mit einem Fazit und Ausblick.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in ihnen?
Kapitel 1 (Einleitung): Stellt die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz vor, beleuchtet die vielschichtige Deutung des Selbstmords in der Literaturwissenschaft. Kapitel 2 (Werthers Leiden): Analysiert die vielschichtigen Aspekte von Werthers Leiden und die Schwierigkeiten, eine einzige Ursache für seinen Selbstmord zu identifizieren. Die Briefromanform und interne Fokalisierung werden hervorgehoben. Kapitel 3 (Leiden an der Gesellschaft): Untersucht Werthers Schwierigkeiten, sich in die Gesellschaft zu integrieren, seinen ersten Eindruck von Wahlheim und die Ständeproblematik. Kapitel 4 (Krankheit zum Tode): Analysiert Werthers Verständnis seiner „Krankheit zum Tode“, seine Definition seiner Krankheit und den Verlauf seines psychischen Zustands. Kapitel 5 (Fazit und Ausblick): Zusammenfassung und Ausblick (nicht im Detail im Auszug beschrieben).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Die Leiden des jungen Werther, Selbstmord, Gesellschaft, Ständegesellschaft, Liebeskummer, psychische Krankheit, textnahe Analyse, Briefroman, interne Fokalisierung, Goethe.
Welcher methodische Ansatz wird verfolgt?
Die Arbeit verfolgt einen textnahen Ansatz. Übermäßige psychologische Interpretationen werden vermieden, der Fokus liegt auf der Analyse des Textes selbst.
Welche Aspekte von Werthers Leiden werden besonders betont?
Besonders betont werden die Vielschichtigkeit von Werthers Leiden, sein Leiden an der Gesellschaft (insbesondere die Ständeproblematik und seine Schwierigkeiten, in Wahlheim Anschluss zu finden) und seine „Krankheit zum Tode“, einschließlich des Verlaufs seines psychischen Zustands.
- Arbeit zitieren
- Julia Gehlhaus (Autor:in), 2019, Woran leidet Werther in Goethes "Die Leiden des jungen Werther"?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/497551