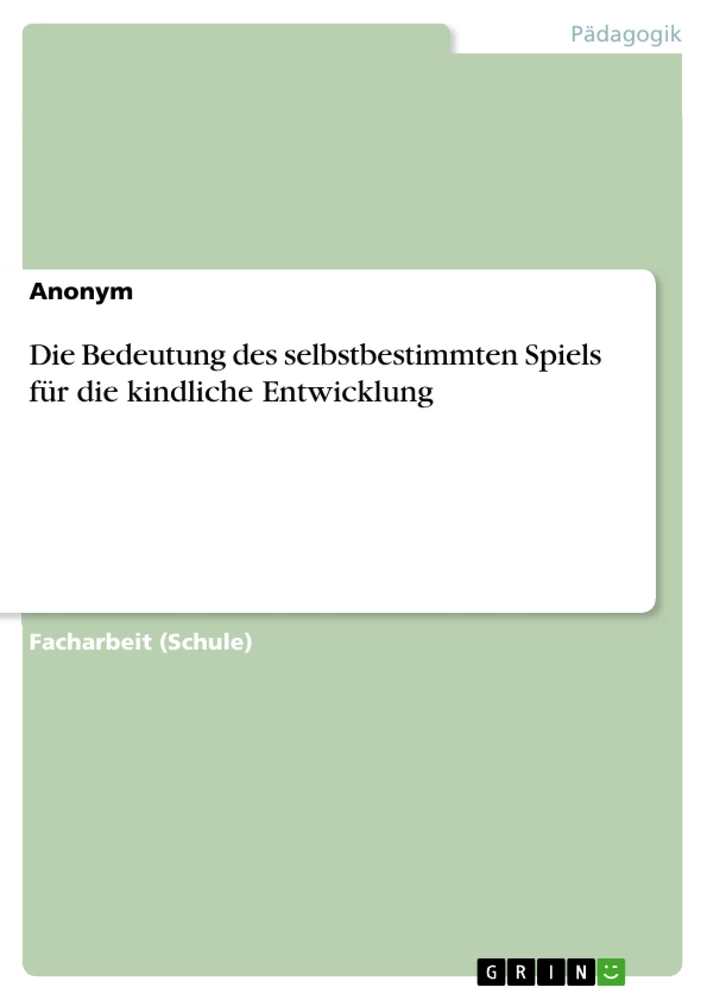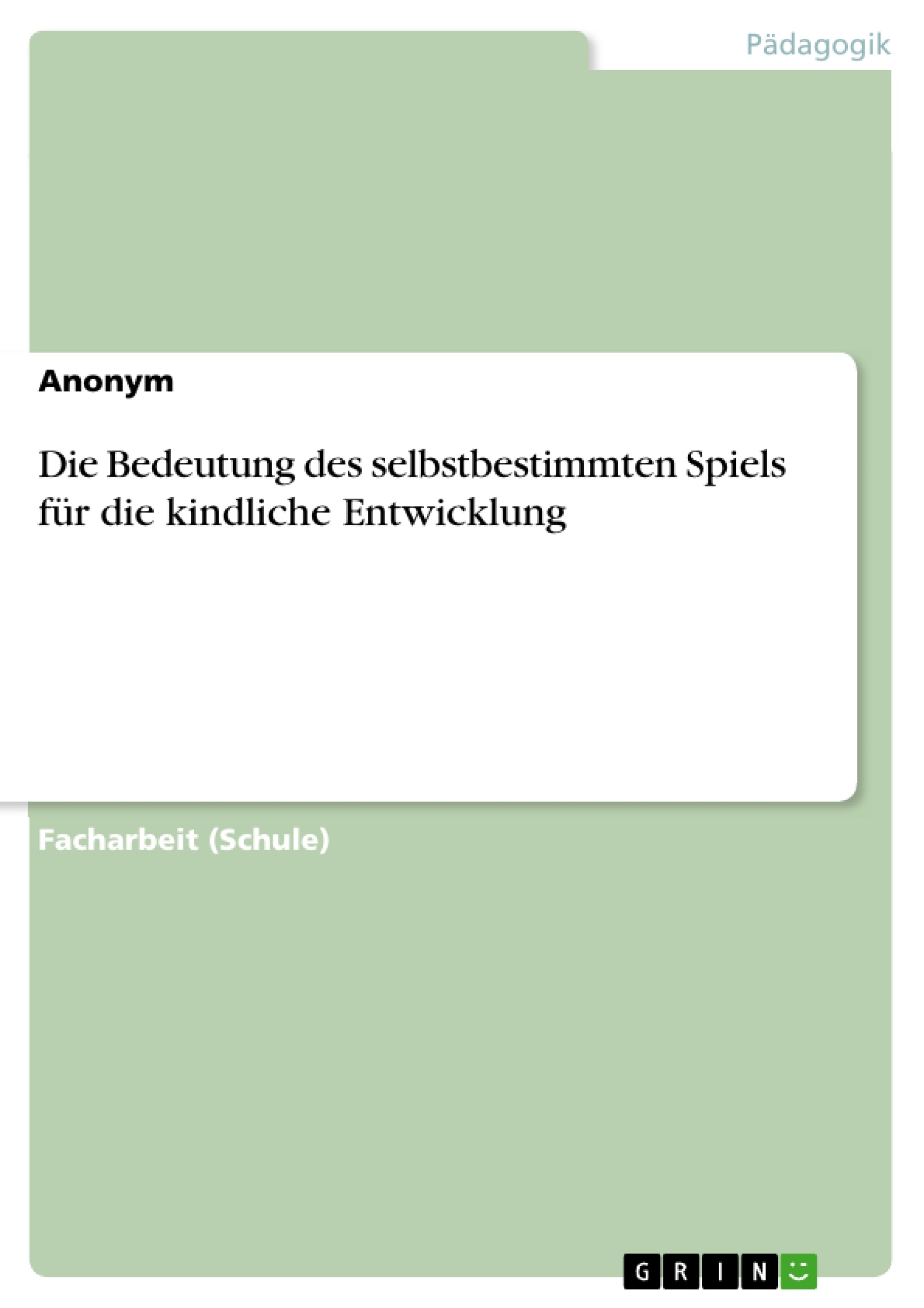Diese wissenschaftliche Arbeit behandelt die Bedeutung des selbstbestimmten Spiels für die kindliche Entwicklung. Für eine bessere Lesbarkeit, werde ich die maskuline Sprachform des Erziehers verwenden, selbstverständlich sind Frauen ebenso gemeint. Zurzeit arbeite ich in der Kita Turmspatzen in Eiche. In der Einrichtung werden 135 Kinder im Alter von 0- 12 Jahren betreut. Zusätzlich gibt es ein Hortgebäude auf dem Grundstück der Ludwig Renn Grundschule für weitere 70 Hortkinder. Da ich im Kindergartenbereich tätig bin, werden meine praktischen Beispiele hauptsächlich auf das Alter von 0-6 Jahre beziehen. Für das Thema habe ich mich entscheiden, weil das Spielen zu den Grundtätigkeiten der Kinder gehört. Aus diesem Grund möchte ich mich mit diesem Thema näher auseinandersetzen, um meinen Blick zu schärfen und mein Wissen darüber zu erweitern. Zudem möchte ich dem Stellenwert des selbstbestimmten Spiels mehr Bedeutung geben und die Wichtigkeit verdeutlichen. Durch die Fachliteratur möchte ich nachweisen, dass im selbstbestimmten Spiel, die Kinder mehr lernen, als wenn Erwachsene versuchen, sie zu „fördern“. Infolgedessen werde ich auf das selbstbestimmte Spiel den Schwerpunkt setzen. Folgende Fragen werde ich in meiner Arbeit näher beleuchten: Was heißt überhaupt spielen und woran erkennt man es? Wo liegt die Abgrenzung von Spielen und Lernen oder haben beide Wörter die gleiche Bedeutung? Wie erweben Kinder ihr Wissen? Wie selbstbestimmt ist das Spielen in der Praxis?
Im Folgenden erläutere ich die Definition des Spiels und die dazugehörigen Merkmale. Des Weiteren werde ich mich mit der Forschung beschäftigen und die wissenschaftlichen Erkenntnisse daraus zusammenfassen. Im Zuge dessen werde ich die wichtigen Voraussetzungen für die Entwicklung der bestimmten Spielformen darlegen. Danach erläutere ich die Spielvorläufer und die Spielformen mit ihren Funktionalitäten, die ich in der Fachliteratur gefunden habe. Anschließend gebe ich Handlungsvorschläge für die pädagogischen Fachkräfte, wenn die Kinder „Langeweile“ äußern. Zusätzlich werde ich mich mit dem Wert des Spiels und die Haltung des Erziehers auseinandersetzen. Folgend erläutere ich die elementaren gesetzlichen Grundlagen zum Thema Spiel. Nachfolgend setze ich mich mit der Raumgestaltung auseinander und stelle die Spielräume in der Praxis dar. Daraufhin befasse ich mich mit den Spielmaterialien und benenne die wichtigsten Kriterien zur Auswahl eines kindgerechten Spielzeugs.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition
- Fünf Merkmale des Spiels
- Verhaltensforschung
- Hirnforschung
- Evolutionsforschung
- Bindungsforschung
- Entwicklungspsychologie
- Entwicklungsvorrausetzungen für bestimmte Spielformen
- Objektpermanenz
- Symbolverständnis
- Perspektivenübernahme
- Unterscheidung von Wirklichkeit und Schein
- Bedürfnisaufschub und Impulskontrolle
- Regelverständnis
- Spielformen und Spielphasen
- Einzelspiel und Parallelspiel
- Spielvorläufer
- Funktionsspiele
- Bewegungsspiele
- Als-ob-Spiele
- Konstruktionsspiele
- Rollenspiele
- Regelspiele
- Wie lernen Kinder
- Wenn Kinder sich langweilen
- Der Wert des Spiels
- Gesetzliche Grundlagen
- Die UN Kinderrechtskonvention
- Das Recht auf Freizeit und Spiel
- Der Raum als Pädagoge
- Spielräume in der Kita Turmspatzen
- Spielmaterialien
- Zehn Kriterien für kindgerechtes Spielzeug
- Was heißt selbstbestimmtes Spiel?
- Wie frei ist das Freispiel in der Kita Turmspatzen?
- Die optimale Spielsituation für Kinder
- Beobachtung eines Freispiels im Theaterraum
- Pädagogisches Handeln anhand der fünf Merkmale des Spiels
- Persönliches Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Bedeutung des selbstbestimmten Spiels für die kindliche Entwicklung. Der Fokus liegt dabei auf der Praxis in der Kita Turmspatzen und den Erfahrungen von Kindern im Alter von 0-6 Jahren. Die Arbeit zielt darauf ab, den Stellenwert des selbstbestimmten Spiels aufzuzeigen und zu verdeutlichen, wie Kinder im selbstbestimmten Spiel mehr lernen, als durch gelenkte Förderung durch Erwachsene.
- Definition des Spiels und seine Merkmale
- Wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Verhaltensforschung
- Entwicklungsvorrausetzungen für verschiedene Spielformen
- Spielformen und ihre Funktionalitäten
- Das selbstbestimmte Spiel in der Kita Turmspatzen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas „Selbstbestimmtes Spiel“ für die kindliche Entwicklung dar und formuliert die zentralen Fragestellungen der Arbeit. Das zweite Kapitel definiert den Begriff „Spiel“ und erläutert die fünf Merkmale des Spiels nach Bernhard Hauser. Kapitel drei präsentiert wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Verhaltensforschung, insbesondere aus der Hirnforschung, Evolutionsforschung, Bindungsforschung und Entwicklungspsychologie. Kapitel vier beschäftigt sich mit den Voraussetzungen für die Entwicklung verschiedener Spielformen. Kapitel fünf beleuchtet verschiedene Spielformen und ihre Funktionalitäten, wie z.B. Einzelspiel, Parallelspiel, Spielvorläufer, Funktionsspiele, Bewegungsspiele, Als-ob-Spiele, Konstruktionsspiele, Rollenspiele und Regelspiele.
Schlüsselwörter
Selbstbestimmtes Spiel, kindliche Entwicklung, Spielformen, Spielphasen, Verhaltensforschung, Entwicklungspsychologie, Pädagogisches Handeln, Kita Turmspatzen, Spielräume, Spielmaterialien, kindgerechtes Spielzeug, Freispiel.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Die Bedeutung des selbstbestimmten Spiels für die kindliche Entwicklung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/493919