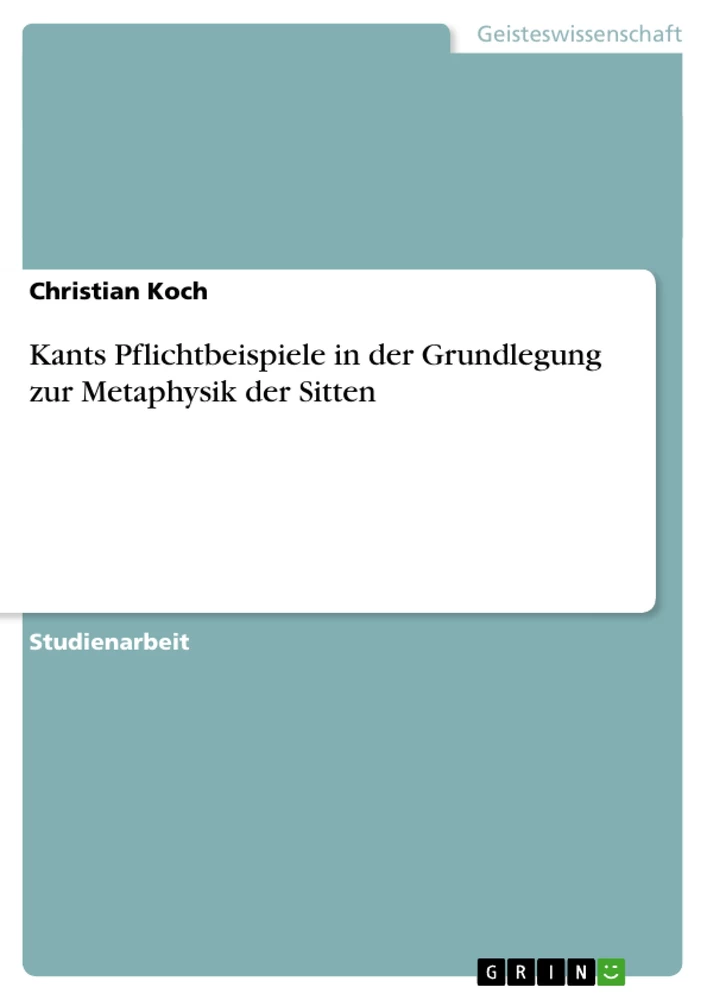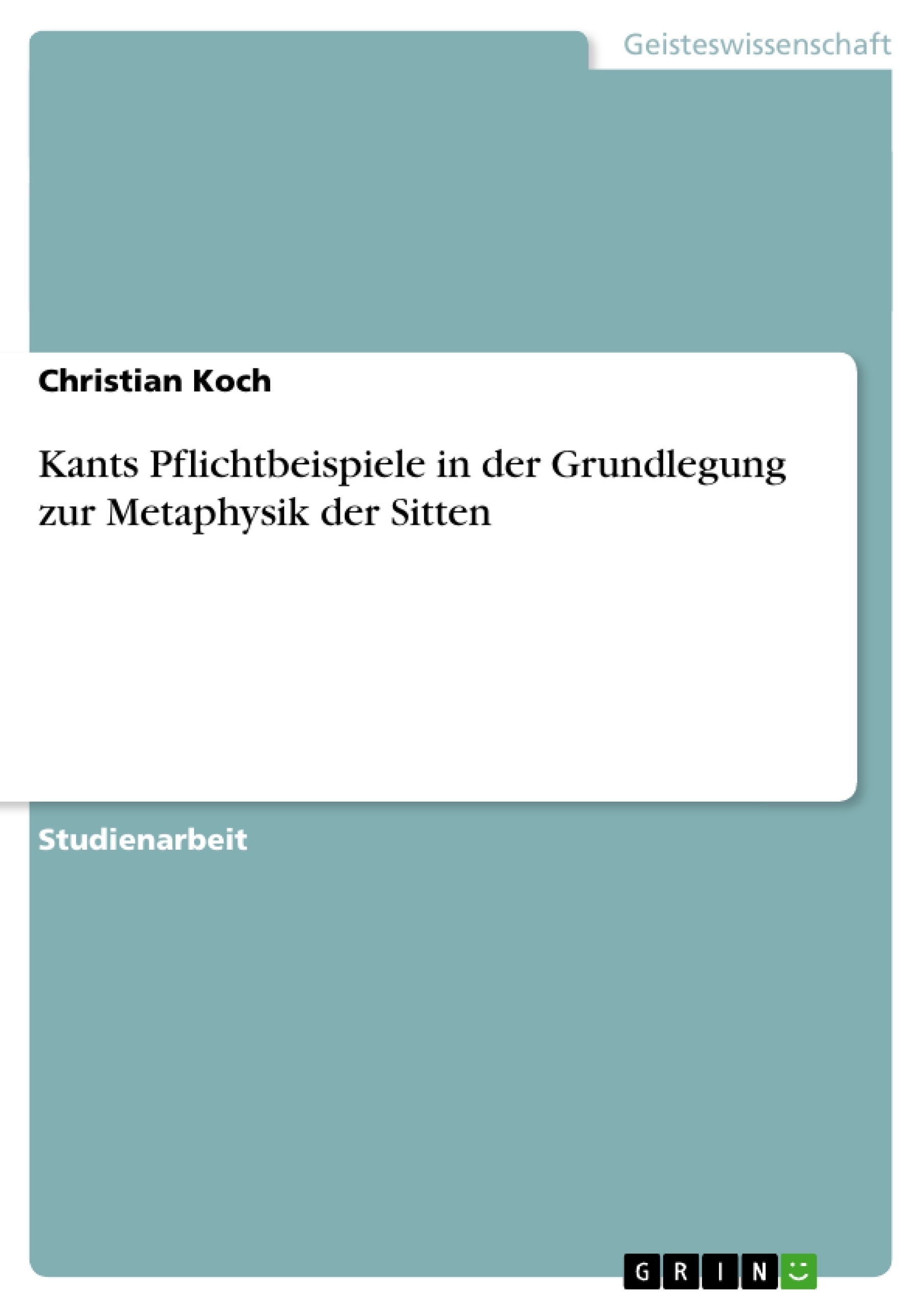Der Königsberger Philosoph Immanuel Kant (1724-1804) hat in seiner Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (GMS) mit dem Kategorischen Imperativ eines der bekanntesten, wenn nicht das bekannteste Beispiel für eine deontologische Ethikkonzeption geschaffen. Kennzeichen einer deontologischen Ethik ist es, dass sie Handlungen ausschließlich danach bemisst, ob sie „von einer bestimmten inneren Beschaffenheit ist, eine Handlung eines bestimmten Typs ist“.Als Gegenstück zur deontologischen Ethik kann man die teleologische Ethik nennen, welche das Ziel, oder den Zweck einer Handlung in den Mittelpunkt stellt.
Die Fragestellung der hier vorliegenden Arbeit ist nun, welche Beispiele für vollkommene und unvollkommene Pflichten Kant in seiner Arbeit heranzieht und welche Beweiskraft sie für seine Argumentation haben.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Der Kategorische Imperativ
- III. Die Beispiele:
- A. Das Beispiel des Krämers
- B. Das Suizidbeispiel
- C. Das Beispiel des falschen Versprechens
- D. Das Beispiel der Entwicklung von Anlagen
- E. Das Beispiel der Wohltätigkeit
- IV. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert Kants Pflichtbeispiele im Kontext seines Kategorischen Imperativs in der "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten". Sie untersucht, welche Beispiele Kant für vollkommene und unvollkommene Pflichten heranzieht und welche Beweiskraft diese für seine Argumentation haben. Der Schwerpunkt liegt auf der Bewertung der Beispiele und ihrer Relevanz für das Verständnis des Kategorischen Imperativs.
- Der Kategorische Imperativ als ethisches Konzept und seine verschiedenen Formulierungen
- Analyse der Beispiele für vollkommene und unvollkommene Pflichten in Kants "Grundlegung"
- Bewertung der Beispiele im Hinblick auf ihre Beweiskraft und ihre Relevanz für das Verständnis des Kategorischen Imperativs
- Zusammenführung der Ergebnisse in einer Schlussbetrachtung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und stellt den Kategorischen Imperativ als ethisches Konzept vor. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Formulierungen des Kategorischen Imperativs und skizziert die Forschungslandschaft zum Thema.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Kategorischen Imperativ als einem zentralen Element von Kants Ethik. Es erläutert die verschiedenen Arten von Imperativen bei Kant und die Bedeutung des Kategorischen Imperativs als Testverfahren für moralische Richtigkeit.
Das dritte Kapitel widmet sich den Pflichtbeispielen Kants. Es analysiert die Beispiele für vollkommene und unvollkommene Pflichten und hinterfragt die Beweiskraft der Beispiele im Hinblick auf den Kategorischen Imperativ.
Schlüsselwörter
Kategorischer Imperativ, deontologische Ethik, Pflichtbeispiele, vollkommene und unvollkommene Pflichten, Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, ethische Konzepte, moralische Richtigkeit, Handlungsanleitung, Maxime, Anwendungsbeispiele.
- Arbeit zitieren
- Christian Koch (Autor:in), 2004, Kants Pflichtbeispiele in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/49164