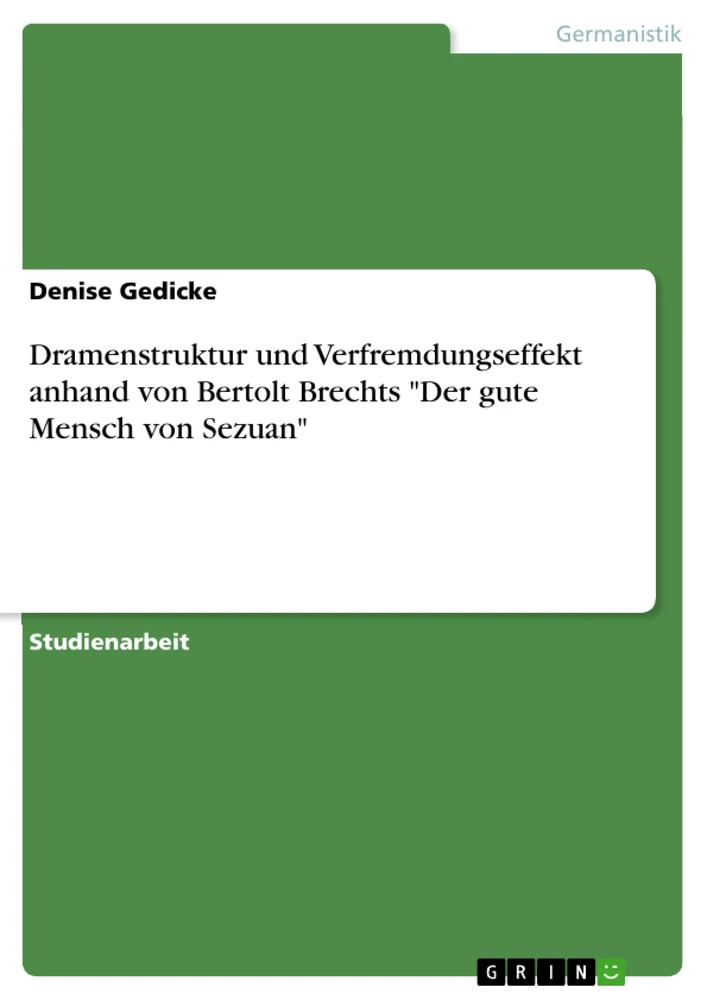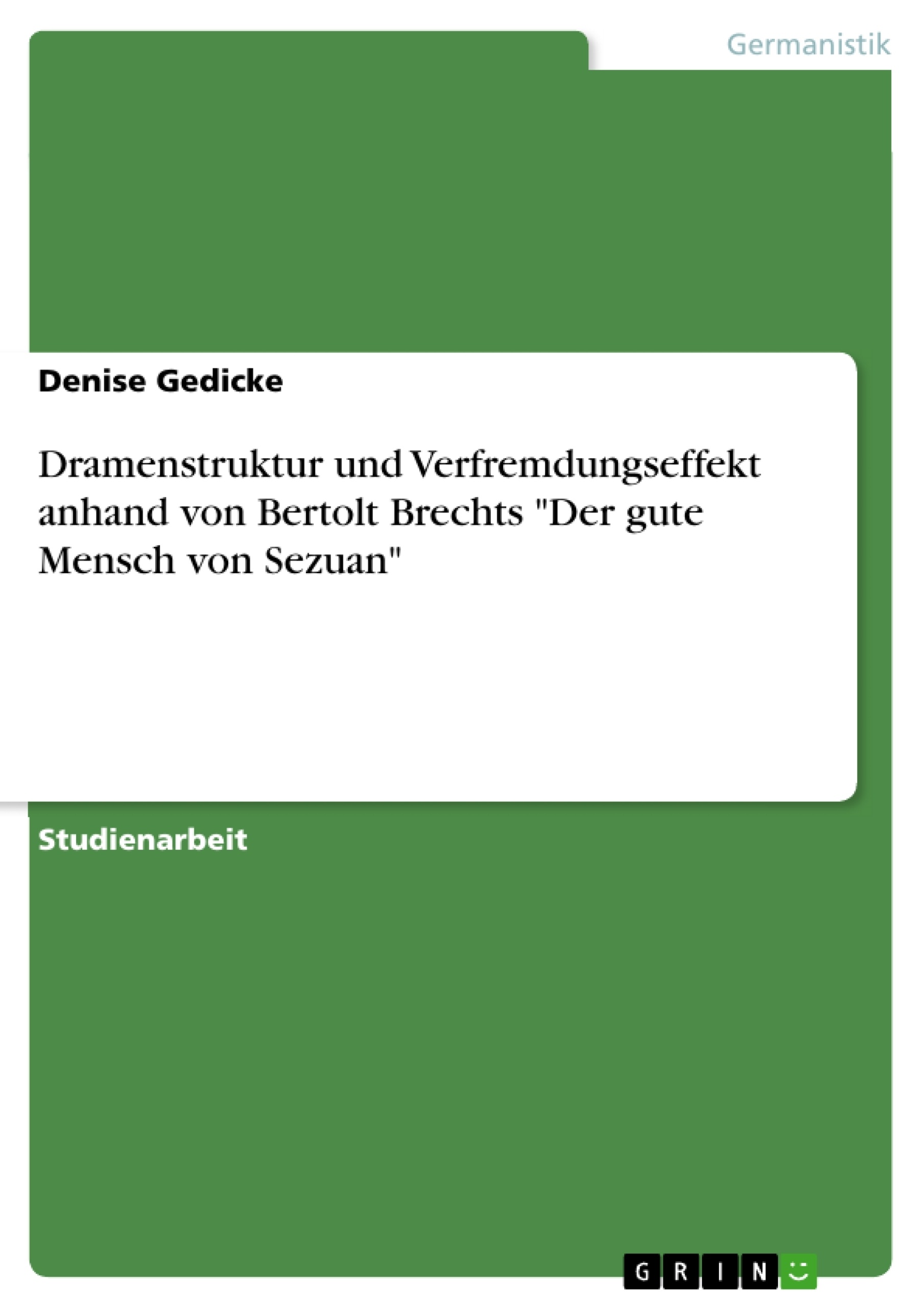Im Zuge der gesellschaftlichen Umwälzungen der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert, empfand Bertolt Brecht die bis dahin gängige Form des „aristotelischen Theaters“ als nicht mehr zeitgemäß. Aus diesem Grundgedanken heraus entstand das „epische Theater“, welches die Scheinrealität des Gespielten aufbrechen und den Zuschauer zum eigenen Handeln und reflektieren anregen sollte. Brecht verstand es mit verschiedenen Mitteln die Tradition zu brechen, auf diese Mittel soll in dieser Seminararbeit am Beispiel seines Parabelstücks „Der gute Mensch von Sezuan“ näher eingegangen werden. Dieses gilt als Musterbeispiel für das epische Theater, aus dem viele Elemente des klassischen Dramas entfernt wurden. Diese Elemente und deren Wirkungsabsicht werden, nach einer kurzen Einführung über das epische Theater, in den folgenden Kapiteln näher beleuchtet.
Zum Ende der vorliegenden Arbeit wird im letzten Kapitel ein Fazit gezogen, in denen die Kerngedanken zur Wirkungsabsicht von Bertolt Brecht noch einmal zusammengefasst werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das epische Theater
- 3. Verfremdungseffekte in „Der gute Mensch von Sezuan“
- 3.1 Sprache
- 3.2 Das distanzierte Spiel
- 3.3 Historisierung
- 3.4 Musik
- 3.5 Strukturaufbau
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Dramenstruktur und den Verfremdungseffekt in Bertolt Brechts „Der gute Mensch von Sezuan“. Ziel ist es, Brechts episches Theater anhand dieses Beispiels zu analysieren und die Mittel zu beleuchten, mit denen er die Tradition des aristotelischen Theaters bricht und den Zuschauer zu kritischer Reflexion anregt.
- Das epische Theater und seine Abkehr vom aristotelischen Theater
- Der Verfremdungseffekt als zentrales Element des epischen Theaters
- Analyse der verschiedenen Verfremdungstechniken in „Der gute Mensch von Sezuan“
- Die Wirkungsabsicht Brechts und seine Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen
- Die Bedeutung von "Der gute Mensch von Sezuan" als Musterbeispiel für das epische Theater
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert den Kontext der Entstehung des epischen Theaters als Reaktion auf das aristotelische Theater im 19. Jahrhundert. Brecht strebte mit seinem epischen Theater eine Aufbrechung der Scheinrealität an, um den Zuschauer zum kritischen Denken und Handeln anzuregen. „Der gute Mensch von Sezuan“ wird als Paradebeispiel für das epische Theater vorgestellt, in dem viele Elemente des klassischen Dramas entfernt wurden. Die Arbeit kündigt die detaillierte Untersuchung der Elemente und deren Wirkungsabsicht an.
2. Das epische Theater: Dieses Kapitel beschreibt die Grundzüge des epischen Theaters, insbesondere dessen Abkehr von der emotionalen Identifikation des Zuschauers mit den Figuren hin zu einer rationalen Auseinandersetzung mit dem dargestellten Geschehen. Im Gegensatz zum aristotelischen Theater, das auf Mitleid und Katharsis setzt, zielt das epische Theater auf eine kritische Distanz und Reflexion des Zuschauers ab. Brecht verwendet Metaphern wie das Karussell, um die Illusion des aristotelischen Theaters zu verdeutlichen und die Notwendigkeit einer neuen Theaterform zu unterstreichen. Das Kapitel beleuchtet die Gedanken Brechts und anderer Theoretiker wie Walter Benjamin und hebt die Bedeutung des Abstands für die kritische Betrachtung hervor.
3. Verfremdungseffekte in „Der gute Mensch von Sezuan“: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Verfremdungstechniken in Brechts Stück. Es betont die Bedeutung der Verfremdung für den Aufbau von Distanz, die dem Zuschauer ermöglicht, mitzudenken und Lehren aus dem Gesehenen zu ziehen. Der Bezug auf die Provinz Sezuan schafft örtliche Distanz und verallgemeinert die Thematik der Ausbeutung. Das Kapitel diskutiert verschiedene Techniken wie die besondere Sprache, das distanzierte Spiel, die Historisierung und die Musik, ohne jedoch auf einzelne Unterkapitel (3.1-3.5) im Detail einzugehen. Der Fokus liegt auf der Gesamtwirkung der Verfremdungsmittel.
Schlüsselwörter
Episches Theater, Bertolt Brecht, Der gute Mensch von Sezuan, Verfremdungseffekt, Aristotelisches Theater, Distanzierung, kritische Reflexion, Gesellschaftkritik, Dramenstruktur, Schauspielkunst.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Der gute Mensch von Sezuan" - Seminararbeit
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert die Dramenstruktur und den Verfremdungseffekt in Bertolt Brechts Stück "Der gute Mensch von Sezuan". Sie untersucht, wie Brecht mit seinem epischen Theater die Tradition des aristotelischen Theaters bricht und den Zuschauer zu kritischer Reflexion anregt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das epische Theater und seine Abkehr vom aristotelischen Theater, den Verfremdungseffekt als zentrales Element, die Analyse verschiedener Verfremdungstechniken in "Der gute Mensch von Sezuan", Brechts Wirkungsabsicht und seine Gesellschaftskritik sowie die Bedeutung des Stücks als Beispiel für das epische Theater.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zum epischen Theater, ein Kapitel zur Analyse der Verfremdungseffekte in "Der gute Mensch von Sezuan" und ein Fazit. Die Einleitung gibt einen Überblick über die Thematik und den Kontext. Das zweite Kapitel beschreibt die Grundzüge des epischen Theaters. Das dritte Kapitel analysiert verschiedene Verfremdungstechniken im Detail (Sprache, Spiel, Historisierung, Musik, Aufbau). Das vierte Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen.
Was sind die zentralen Verfremdungstechniken in "Der gute Mensch von Sezuan"?
Die Seminararbeit erwähnt verschiedene Verfremdungstechniken, darunter die Sprache, das distanzierte Spiel, die Historisierung und die Musik. Eine detaillierte Analyse dieser Techniken findet sich im dritten Kapitel. Die Gesamtwirkung dieser Mittel auf den Zuschauer steht im Fokus.
Wie unterscheidet sich das epische Theater vom aristotelischen Theater?
Im Gegensatz zum aristotelischen Theater, das auf Mitleid und Katharsis abzielt, strebt das epische Theater eine kritische Distanz und Reflexion des Zuschauers an. Es verzichtet auf die emotionale Identifikation mit den Figuren und fördert stattdessen eine rationale Auseinandersetzung mit dem dargestellten Geschehen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit werden im Fazit zusammengefasst. Die Arbeit zielt darauf ab, Brechts episches Theater anhand von "Der gute Mensch von Sezuan" zu analysieren und dessen Mittel zur kritischen Reflexion des Zuschauers aufzuzeigen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Episches Theater, Bertolt Brecht, Der gute Mensch von Sezuan, Verfremdungseffekt, Aristotelisches Theater, Distanzierung, kritische Reflexion, Gesellschaftkritik, Dramenstruktur, Schauspielkunst.
- Quote paper
- Denise Gedicke (Author), 2018, Dramenstruktur und Verfremdungseffekt anhand von Bertolt Brechts "Der gute Mensch von Sezuan", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/491449