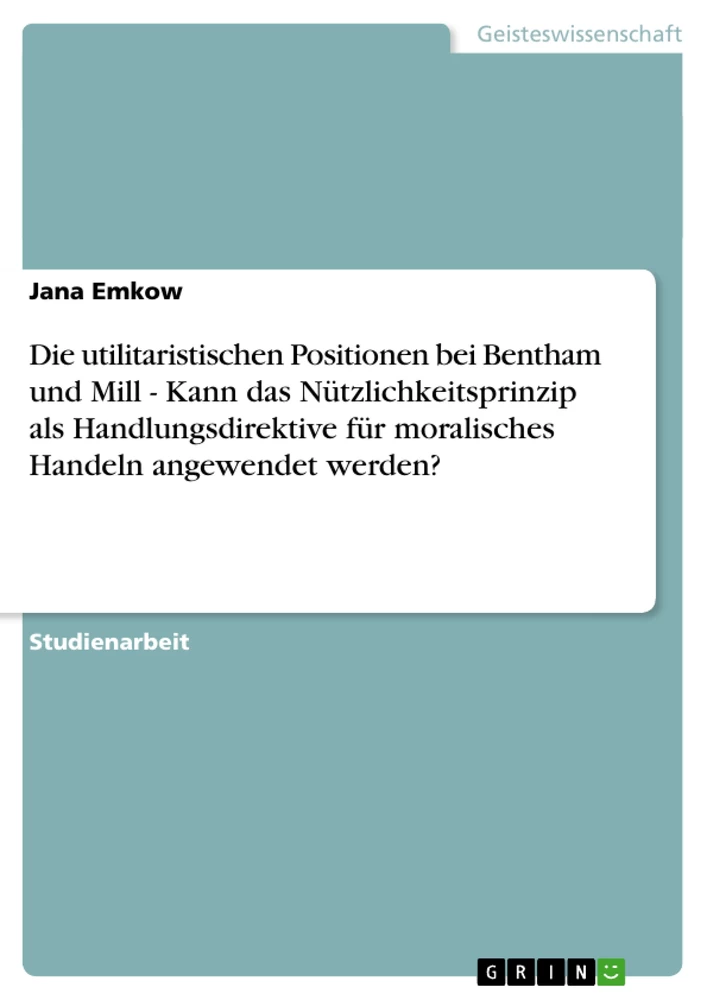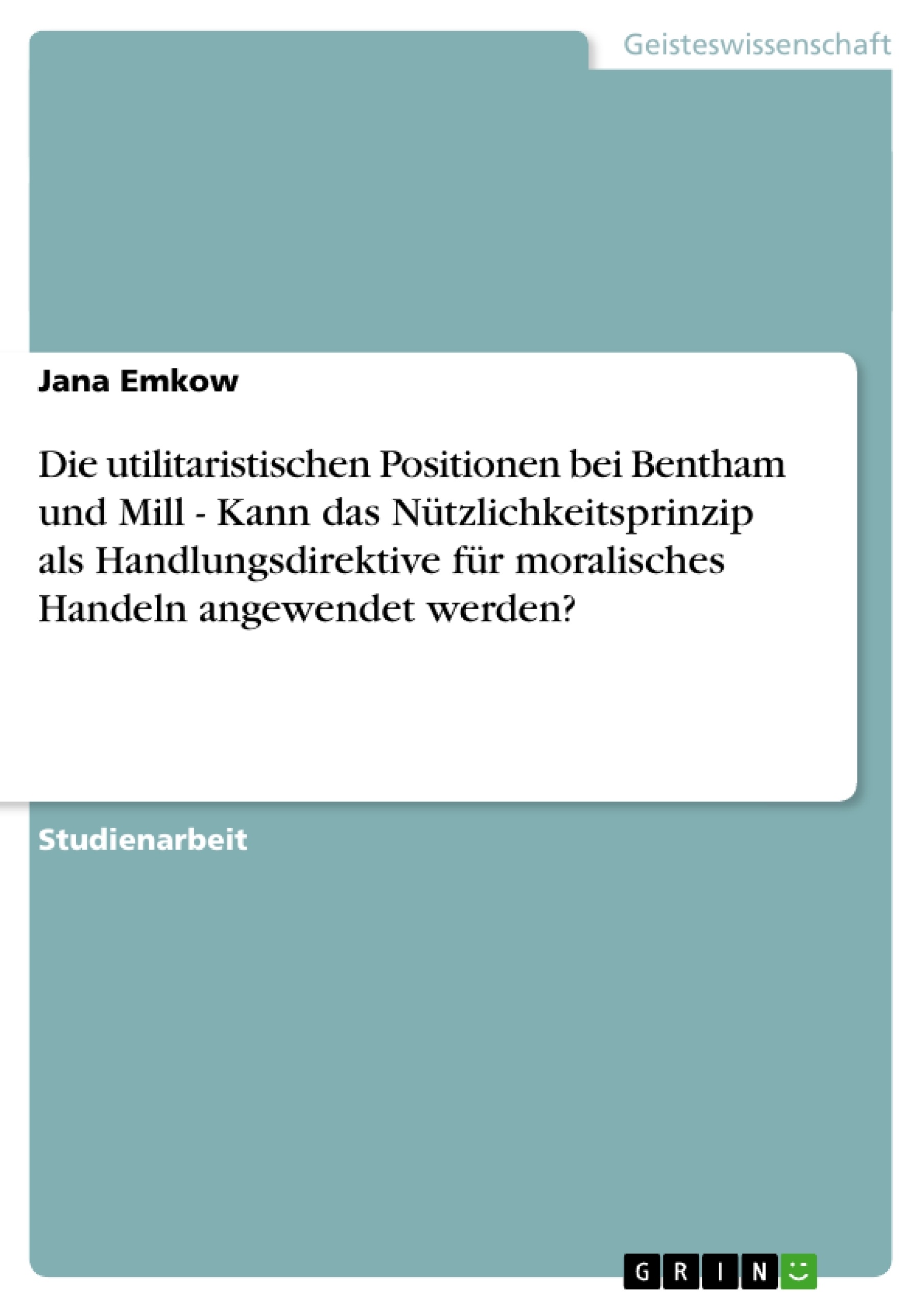Auch im aktuellen Kontext der Ethik hat der Utilitarismus (lat. utile = nützlich) nicht an Bedeutung verloren, obwohl seine Theorie mehr als 200 Jahre alt ist. Zur gleichen Zeit, als Kant seine „Kritik der praktischen Vernunft“ (1788) verfasste, erschien in England Jeremy Benthams Werk „An Introduction to the Principles of Moral and Legislation“ (1789). Hierin versucht Bentham ein Konzept einer Moralphilosophie zu entwerfen, indem er den Begriff „utilitarian“ (nützlich) einführt. Kants und Benthams Konzeptionen werden heutzutage als gegensätzlich betrachtet, prägen aber bis in die Gegenwart die Erörterungen darüber, wie moralische Problemstellungen und deren Lösungen ausgedrückt werden können. Der große Unterschied beider Betrachtungsweisen besteht in den Kriterien darüber, ob eine Handlung als moralisch gut oder verwerflich betrachtet wird. Kants Ethik wird als deontologisch (griech. deon: Pflicht) bezeichnet. Hierbei werden ausschließlich Handlungen, die aus Pflicht und nicht aus Nutzen geschehen, als moralisch richtig und gut bewertet. Im Utilitarismus hingegen verfährt man teleologisch (griech. telos: Ziel), hier werden Ziele und Folgen einer Handlung ausschließlich von den zu erwartenden Konsequenzen her beurteilt. Dabei wird vorausgesetzt, dass sich diese Folgen möglichst umfassend ermitteln und präzise vorhersagen lassen.
Ziel dieser Arbeit ist es, die Frage zu klären, ob und inwiefern das Nützlichkeitsprinzip beider Philosophen heutzutage als Handlungsgrundlage gelten kann. Ist es möglich, Handlungen als moralisch gut zu bewerten, die nach dem Prinzip vollzogen wurden? In den folgenden Ausführungen soll die utilitaristische Ethik anhand zweier Hauptvertreter, Jeremy Bentham und John Stuart Mill, näher beleuchtet und miteinander verglichen werden. Dafür werden im zweiten Punkt die utilitaristischen Thesen Benthams vorgestellt. Worauf baute seine Theorie auf, wie ist das Nützlichkeitsprinzip in seiner Lehre konzipiert und welche Rahmenbedingungen schafft er für das funktionieren seiner Ethik? Der dritte Punkt befasst sich mit den Positionen Mills. In welchen Punkten knüpft er modifiziert an seinen Vordenker Bentham an und was führt er zusätzlich ein, um den Kritiken an der ‚alten Theorie’ zu entgehen? Im zweiten und dritten Punkt soll zunächst rein objektiv die Ethik beider Utilitaristen beleuchtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der klassische Utilitarismus Jeremy Benthams
- Die hedonistische Grundlage und das Prinzip der Nützlichkeit
- Der hedonistische Kalkül
- Das Sanktionsmodell Benthams
- John Stuart Mills Utilitarismus
- Gegenstand und Zweck des Nützlichkeitsprinzips
- Die Einführung des qualitativen Aspekts
- Die fundamentale Sanktion des Nützlichkeitsprinzips
- Kritik und Schlussbetrachtung
- Vorteile und Probleme in Benthams Ethik
- Die Kritik an Mills Theorie
- Resümee und Ausblicke
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Anwendbarkeit des Nützlichkeitsprinzips von Bentham und Mill als Handlungsgrundlage für moralisches Handeln. Sie vergleicht die utilitaristischen Positionen beider Philosophen und analysiert deren Stärken und Schwächen.
- Der hedonistische Utilitarismus Benthams und seine quantitative Herangehensweise.
- Mills Modifikation des Utilitarismus und die Integration qualitativer Aspekte.
- Die Kritik an den jeweiligen Theorien und deren Berücksichtigung von individuellen vs. kollektiven Interessen.
- Die Rolle von Lust und Leid in der moralischen Bewertung von Handlungen.
- Die Anwendbarkeit des Nützlichkeitsprinzips im heutigen Kontext.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Utilitarismus ein und stellt die Gegenüberstellung der deontologischen Ethik Kants und der teleologischen Ethik des Utilitarismus dar. Sie hebt den Unterschied in der Bewertung moralischer Handlungen hervor – auf Basis der Pflicht versus auf Basis der Konsequenzen – und benennt die Zielsetzung der Arbeit: die Untersuchung der Anwendbarkeit des Nützlichkeitsprinzips als Handlungsgrundlage im heutigen Kontext anhand der Theorien von Bentham und Mill.
2. Der klassische Utilitarismus Jeremy Benthams: Dieses Kapitel präsentiert die Grundzüge von Benthams Utilitarismus, dessen hedonistische Grundlage und das Prinzip der Nützlichkeit im Detail erläutert werden. Benthams Fokus auf das „größte Glück der größten Zahl“ und sein hedonistischer Kalkül als Methode zur Maximierung von Lust und Minimierung von Leid werden ausführlich beschrieben. Es wird Benthams empirische Sicht des Menschen als von Leid und Freude gelenkt dargestellt und sein Versuch, das Nützlichkeitsprinzip als Rechtfertigungsmaßstab für juristische Regelungen zu etablieren, erläutert.
3. John Stuart Mills Utilitarismus: Dieses Kapitel beschreibt Mills Utilitarismus als Weiterentwicklung und Modifikation von Benthams Theorie. Der Fokus liegt auf Mills Integration qualitativer Aspekte neben quantitativen Überlegungen im Nützlichkeitsprinzip, wodurch er die Kritik an der rein quantitativen Ausrichtung von Benthams Hedonismus aufgreift. Mills fundamentale Sanktion des Nützlichkeitsprinzips und die Unterschiede zu Benthams Ansatz werden detailliert analysiert.
Schlüsselwörter
Utilitarismus, Bentham, Mill, Hedonismus, Nützlichkeitsprinzip, Glück, Leid, Handlungsethik, Teleologie, Deontologie, Moralphilosophie, Konsequenzen, quantitative und qualitative Aspekte, Nutzenkalkül.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Utilitarismus bei Bentham und Mill
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über den Utilitarismus, insbesondere die Theorien von Jeremy Bentham und John Stuart Mill. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzungserklärung, Kapitelzusammenfassungen, Schlüsselwörter und vergleicht die Ansätze beider Philosophen hinsichtlich Stärken und Schwächen.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt den klassischen Utilitarismus Benthams mit seinen hedonistischen Grundlagen, dem Prinzip der Nützlichkeit und dem hedonistischen Kalkül. Er analysiert Mills Modifikation des Utilitarismus, insbesondere die Integration qualitativer Aspekte. Es wird die Kritik an beiden Theorien beleuchtet, sowie die Rolle von Lust und Leid in der moralischen Bewertung und die Anwendbarkeit des Nützlichkeitsprinzips im heutigen Kontext.
Wer sind die zentralen Figuren des Textes?
Die zentralen Figuren sind Jeremy Bentham und John Stuart Mill, zwei einflussreiche Philosophen des Utilitarismus. Der Text vergleicht und kontrastiert ihre jeweiligen Ansätze und Beiträge zur utilitaristischen Ethik.
Was ist der Unterschied zwischen Benthams und Mills Utilitarismus?
Benthams Utilitarismus ist ein quantitativer Hedonismus, der auf dem Prinzip des "größten Glücks der größten Zahl" basiert und einen hedonistischen Kalkül zur Berechnung des Nutzens verwendet. Mill hingegen integriert qualitative Aspekte in seinen Utilitarismus, differenziert zwischen höheren und niederen Freuden und kritisiert die rein quantitative Ausrichtung von Benthams Ansatz.
Welche Kritikpunkte werden an den Theorien von Bentham und Mill geäußert?
Der Text thematisiert die Kritik an der rein quantitativen Ausrichtung von Benthams Hedonismus und die damit verbundenen Probleme der Messbarkeit von Glück und Leid. Die Kritik an Mills Theorie umfasst vermutlich die Schwierigkeit, qualitative Aspekte des Glücks objektiv zu bewerten und die Berücksichtigung individueller versus kollektiver Interessen.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über Benthams klassischen Utilitarismus, ein Kapitel über Mills Utilitarismus und abschließend eine Kritik und Schlussbetrachtung, sowie ein Literaturverzeichnis.
Was sind die Schlüsselwörter des Textes?
Schlüsselwörter sind: Utilitarismus, Bentham, Mill, Hedonismus, Nützlichkeitsprinzip, Glück, Leid, Handlungsethik, Teleologie, Deontologie, Moralphilosophie, Konsequenzen, quantitative und qualitative Aspekte, Nutzenkalkül.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Dieser Text richtet sich an Personen, die sich akademisch mit dem Utilitarismus auseinandersetzen möchten. Er ist besonders geeignet für Studenten der Philosophie, Ethik oder Politikwissenschaft.
Wo finde ich die Quellen?
Die Quellen sind im Text separat aufgeführt (siehe Inhaltsverzeichnis).
- Quote paper
- Jana Emkow (Author), 2005, Die utilitaristischen Positionen bei Bentham und Mill - Kann das Nützlichkeitsprinzip als Handlungsdirektive für moralisches Handeln angewendet werden?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/49051