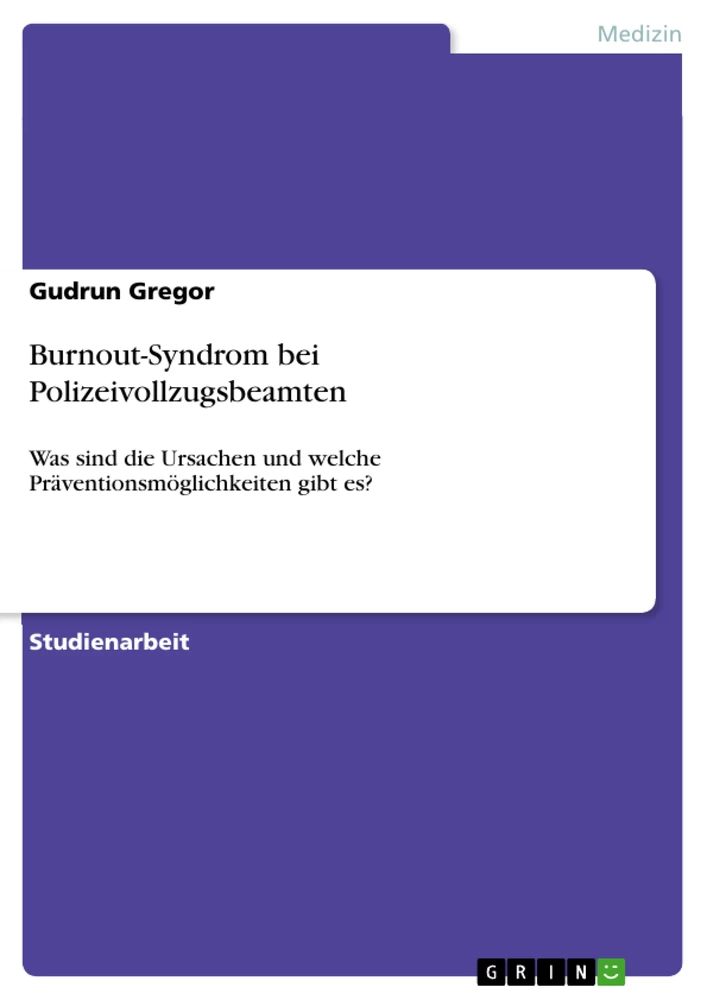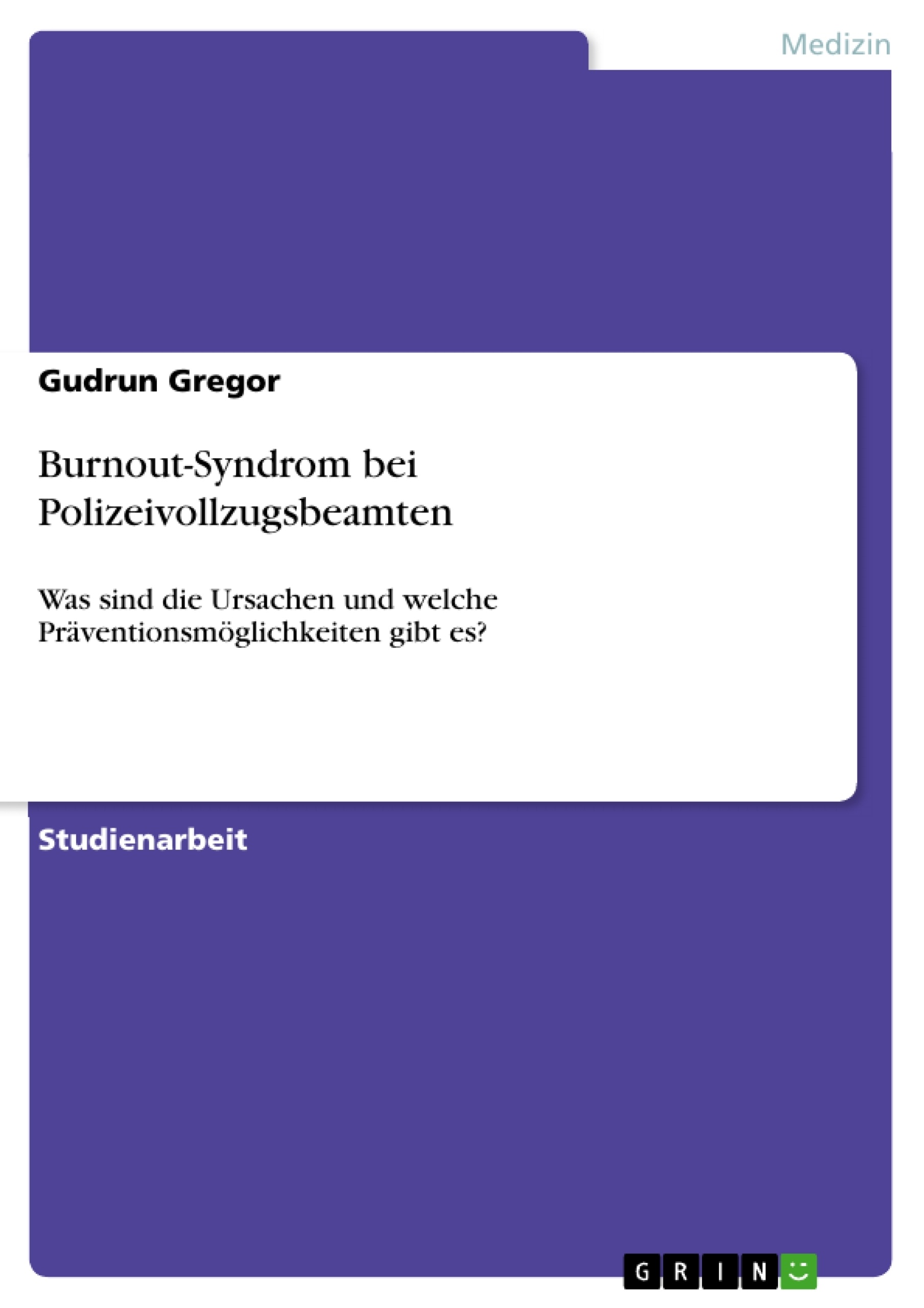Was sind die tätigkeitsbedingten Ursachen des Burnout-Syndroms bei Polizeivollzugsbeamten (PVB) der Bundespolizei und wie kann diesen entgegengewirkt werden? Auf diese Frage geht die vorliegende Arbeit ein. Es werden Handlungsempfehlungen für PVB und Führungskräfte der Bundespolizei auf verhaltensorientierter Ebene abgeleitet, die Möglichkeiten aufzeigen, wie ein „Ausbrennen“ verhindert bzw. die Gesundheit erhalten werden kann.
Die zentralen Hauptaufgaben der Polizei sind die Gefahrenabwehr, Strafverfolgung und Vollzugshilfe. Der Polizeivollzugsbeamte (PVB) handelt auf Grundlage der Gesetze, es besteht in den seltensten Fällen ein Ermessensspielraum. Er ist verpflichtet nach den gesetzlichen Vorgaben zu handeln und darf sich nicht von seinen Emotionen beeinflussen lassen . Die sogenannte Beerlage Studie hat die hoch belastete Situation für die Beschäftigten der Polizei klar aufgezeigt. Mehr als 10% der befragten Beamten der Landespolizei zeigten deutlich Symptome eines Burnouts, Beamte der Bundespolizei wurden mit 20,2 % doppelt so hoch bewertet. Insgesamt wurden bei der Polizei eine massive andauernde inhaltliche und zeitliche Überforderung (quantitative Arbeitsbelastung) festgestellt, welche sich negativ auf das psychische Wohlbefinden auswirken
Von entscheidender Bedeutung ist hier, dass die hohe Belastung von etwa der Hälfte der Befragten (49,5 %) kaum ausgeglichen bzw. kompensiert werden kann. Ein Burnout wirkt sich immer negativ auf die Gesundheit der Betroffenen aus, sei dies durch körperliche oder psychosomatische Beschwerden, die oft auch von depressiven Symptomen begleitet werden. Die Ergebnisse der TK-Stressstudie (2016) ergaben, dass 64% der stark gestressten Personen unter Erschöpfung und dem Gefühl des ausgebrannt seins leiden. Etwa 46 % klagen über Schlafstörungen, Gereiztheit und Nervosität.
Neben den physischen und psychischen Folgen eines Burnout-Syndroms bestehen auch wirtschaftliche Folgen (finanzielle Abhängigkeiten wie z.B. Haus, Familie). Aus langen Krankheits- und Ausfallzeiten resultieren finanzielle Einbußen. Bei einer Krankschreibungsdauer ab 6 Wochen erhält der Versicherte Krankengeld von seiner Krankenkasse. Die Dauer der Krankengeldzahlungen ist begrenzt. Der Versicherte erhält diesen Lohnersatz maximal 78 Wochen lang.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Das Burnout-Syndrom
- 2.1.1 Begriffsbestimmung
- 2.1.2 Entstehungsursachen, Verlauf und Symptomatik
- 2.1.3 Folgen und Auswirkungen
- 2.1.4 Differenzialdiagnosen
- 2.2 Prävention und Gesundheitsförderung
- 2.3 Polizei in Deutschland
- 2.3.1 Berufliche Realität Polizeivollzugsbeamter der Bundespolizei
- 2.3.2 Psychische Stressoren
- 3. Ursachenanalyse Burnout im Kontext der Bundespolizei
- 3.2 Situationsbedingte Faktoren
- 3.2.1 Arbeitsorganisatorische Anforderungen
- 3.2.2 Polizeidienstspezifische Tätigkeiten
- 3.2.3 Extreme Einsatzsituationen
- 3.3 Persönliche Faktoren
- 3.3.1 Erwartungen an den Beruf
- 3.3.2 Wahrgenommene soziale Unterstützung
- 3.3.3 Psychisches und körperliches Wohlbefinden
- 4. Fazit und Handlungsempfehlungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Ursachen des Burnout-Syndroms bei Polizeivollzugsbeamten (PVB) der Bundespolizei. Ziel ist die Darstellung und Analyse von Belastungs- und Ressourcenkonstellationen und deren Auswirkungen auf die Gesundheit der PVB. Die Arbeit beantwortet die Frage nach tätigkeitsbedingten Burnout-Ursachen und möglichen Gegenmaßnahmen.
- Definition und Abgrenzung des Burnout-Syndroms
- Analyse situationsbedingter Faktoren (Arbeitsorganisation, polizeispezifische Tätigkeiten, extreme Einsatzsituationen)
- Untersuchung persönlicher Faktoren (Berufserwartungen, soziale Unterstützung, psychisches und körperliches Wohlbefinden)
- Prävention und Gesundheitsförderung im Polizeidienst
- Ableitung von Handlungsempfehlungen für PVB und Führungskräfte
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die hohe Anzahl von Polizisten in Deutschland und deren zentrale Aufgaben. Sie hebt die belastende Situation von Polizeibeamten hervor, insbesondere im Hinblick auf Burnout-Symptome, basierend auf der Beerlage-Studie und weiteren Studien, die hohe Arbeitsbelastung und negative Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden belegen. Die Einleitung führt in das Thema ein und benennt das Ziel der Arbeit: die Analyse der Ursachen von Burnout bei Bundespolizisten und die Ableitung von Handlungsempfehlungen.
2. Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel liefert eine fundierte Basis für die anschließende Ursachenanalyse. Es definiert das Burnout-Syndrom, beschreibt seine Entstehungsursachen, seinen Verlauf und seine Symptomatik, sowie die Folgen und Auswirkungen. Differenzialdiagnosen werden ebenfalls behandelt. Zusätzlich werden Prävention und Gesundheitsförderung im Allgemeinen und der Kontext der Polizei in Deutschland, einschließlich der beruflichen Realität und psychischer Stressoren für Bundespolizisten, beleuchtet. Dieses Kapitel liefert das notwendige theoretische Rüstzeug, um die später folgende empirische Analyse zu verstehen und einzuordnen.
3. Ursachenanalyse Burnout im Kontext der Bundespolizei: Der Hauptteil der Arbeit analysiert die Ursachen von Burnout bei Bundespolizisten. Er unterteilt die Ursachen in situationsbedingte und persönliche Faktoren. Zu den situationsbedingten Faktoren gehören arbeitsorganisatorische Anforderungen, polizeispezifische Tätigkeiten und extreme Einsatzsituationen. Persönliche Faktoren umfassen Berufserwartungen, wahrgenommene soziale Unterstützung und das psychische und körperliche Wohlbefinden der Beamten. Dieser Abschnitt stellt einen zentralen Beitrag der Arbeit dar, indem er die komplexen Ursachen von Burnout im spezifischen Kontext des Bundespolizeidienstes detailliert untersucht.
Schlüsselwörter
Burnout-Syndrom, Bundespolizei, Polizeivollzugsbeamte, psychische Belastung, Arbeitsstress, Prävention, Gesundheitsförderung, Einsatzsituationen, soziale Unterstützung, psychisches Wohlbefinden, Handlungsempfehlungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Burnout bei Bundespolizisten
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Ursachen des Burnout-Syndroms bei Polizeivollzugsbeamten (PVB) der Bundespolizei. Sie analysiert Belastungs- und Ressourcenkonstellationen und deren Auswirkungen auf die Gesundheit der PVB. Das zentrale Ziel ist die Beantwortung der Frage nach tätigkeitsbedingten Burnout-Ursachen und möglichen Gegenmaßnahmen.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst eine Definition und Abgrenzung des Burnout-Syndroms, eine Analyse situationsbedingter Faktoren (Arbeitsorganisation, polizeispezifische Tätigkeiten, extreme Einsatzsituationen), die Untersuchung persönlicher Faktoren (Berufserwartungen, soziale Unterstützung, psychisches und körperliches Wohlbefinden), Prävention und Gesundheitsförderung im Polizeidienst und die Ableitung von Handlungsempfehlungen für PVB und Führungskräfte.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit besteht aus einer Einleitung, einem theoretischen Hintergrund, einer Ursachenanalyse im Kontext der Bundespolizei und einem Fazit mit Handlungsempfehlungen. Der theoretische Hintergrund umfasst die Definition und Erläuterung des Burnout-Syndroms, Prävention und Gesundheitsförderung sowie die berufliche Realität und psychische Stressoren bei Bundespolizisten. Die Ursachenanalyse unterteilt die Faktoren in situationsbedingte (arbeitsorganisatorische Anforderungen, polizeispezifische Tätigkeiten, extreme Einsatzsituationen) und persönliche Faktoren (Berufserwartungen, soziale Unterstützung, psychisches und körperliches Wohlbefinden).
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Burnout-Syndrom, Bundespolizei, Polizeivollzugsbeamte, psychische Belastung, Arbeitsstress, Prävention, Gesundheitsförderung, Einsatzsituationen, soziale Unterstützung, psychisches Wohlbefinden, Handlungsempfehlungen.
Welche konkreten Fragen werden in der Hausarbeit beantwortet?
Die Arbeit beantwortet die Frage nach den tätigkeitsbedingten Ursachen von Burnout bei Bundespolizisten und entwickelt daraus Handlungsempfehlungen zur Prävention und Gesundheitsförderung.
Welche Studien oder Daten werden in der Arbeit verwendet?
Die Einleitung verweist auf die Beerlage-Studie und weitere Studien, die eine hohe Arbeitsbelastung und negative Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden von Polizeibeamten belegen. Die genaue Methodik und die verwendeten Daten werden im Hauptteil der Arbeit detailliert beschrieben.
An wen richten sich die Handlungsempfehlungen?
Die Handlungsempfehlungen richten sich an Polizeivollzugsbeamte (PVB) der Bundespolizei und deren Führungskräfte.
Welche Art von Faktoren werden bei der Ursachenanalyse von Burnout betrachtet?
Die Ursachenanalyse unterscheidet zwischen situationsbedingten Faktoren (z.B. Arbeitsorganisation, extreme Einsatzsituationen) und persönlichen Faktoren (z.B. Berufserwartungen, soziale Unterstützung).
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel: Einleitung (Beschreibung der Situation von Polizeibeamten und Zielsetzung), Theoretischer Hintergrund (Definition und Erläuterung des Burnout-Syndroms, Prävention und Kontext Polizei), Ursachenanalyse (situationsbedingte und persönliche Faktoren im Kontext der Bundespolizei), und Fazit mit Handlungsempfehlungen.
- Quote paper
- Gudrun Gregor (Author), 2016, Burnout-Syndrom bei Polizeivollzugsbeamten, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/490062