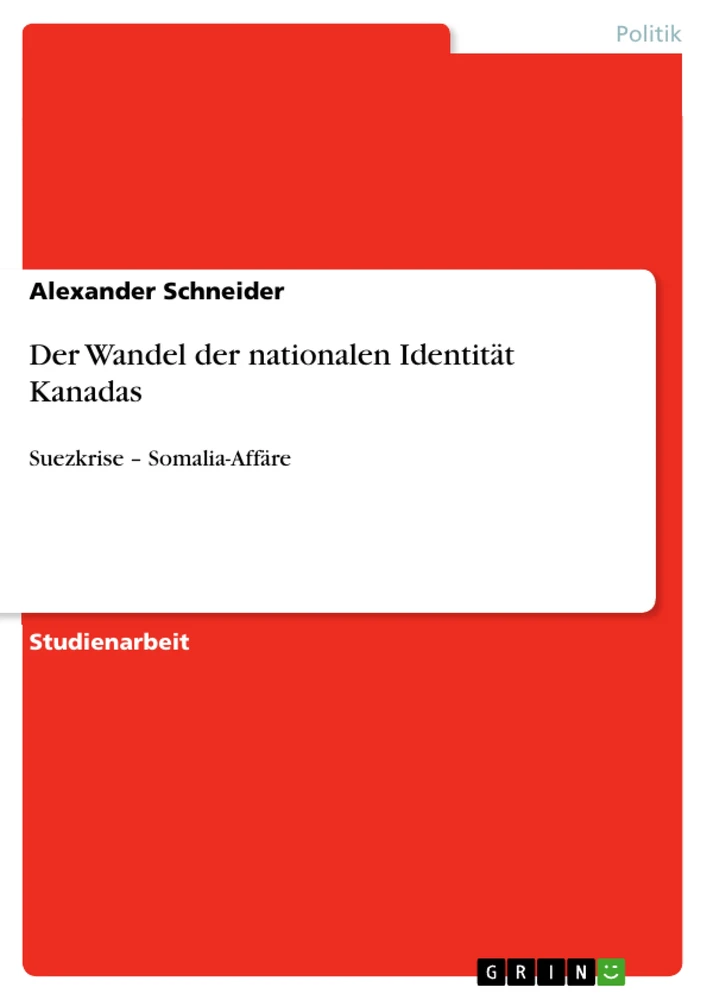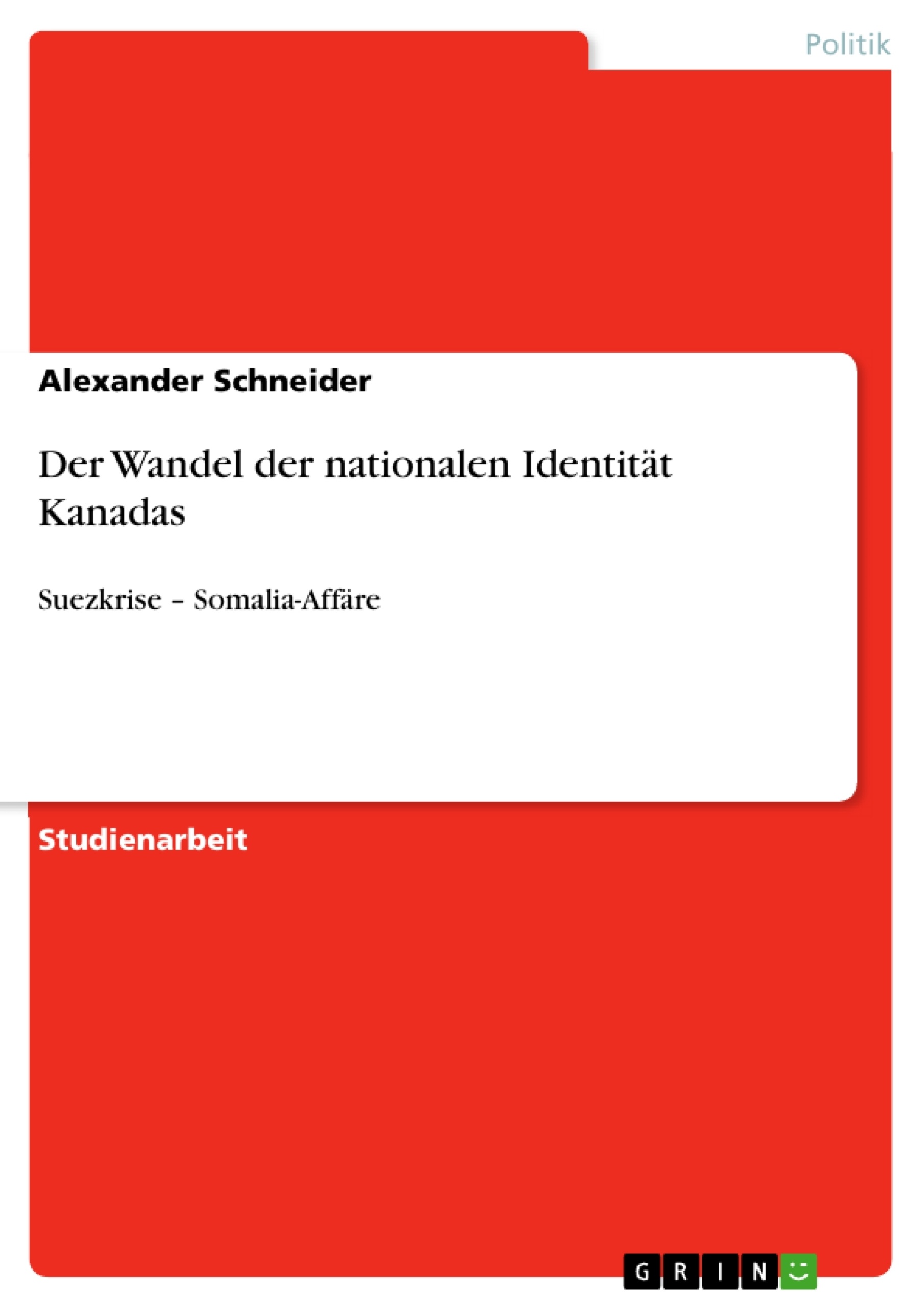Angesichts der einschneidenden Vorkommnisse wird im Rahmen dieser Seminararbeit zur Disposition gestellt, ob sich nach der sogenannten Somalia-Affäre ein Wandel in der nationalen Identität Kanadas feststellen lässt. Dabei wird dem Leser zunächst ein Einblick in ausgewählte UN-Einsätze Kanadas seit dem Ende des II. Weltkriegs gewährt, und, dem Forschungsthema entsprechend, detailliert auf den Konflikt im Suezkanal (1956) wie auch den Bürgerkrieg in Somalia (1993) eingegangen.
Des Weiteren werden im dritten Kapitel sämtliche Grundannahmen und Kernaussagen des Sozialkonstruktivismus, einer Theorie der Internationalen Beziehungen, resümiert und erklärt, um diese dann im Schwerpunkt der wissenschaftlichen Arbeit anhand einer theorienbasierten qualitativen Inhaltsanalyse auf Auszüge damaliger Parlamentsdebatten anzuwenden.
Schließlich werden im letzten Abschnitt dieser Seminararbeit die daraus erzielten Ergebnisse gegenübergestellt, durch ein Fazit zur durchgeführten Untersuchung abgerundet und in heutige wie ebenso zukünftige Chancen, Entwicklungen und Herausforderungen der kanadischen Außenpolitik ausgeblickt.
Als ein zentrales Element der nationalen Identität wie auch der Außenpolitik Kanadas zählt das sogenannte peace-keeping, also der Einsatz kanadischer Friedenstruppen in Krisengebieten, wie das Zitat des ehemaligen kanadischen Außen- und Premierministers Lester B. Pearson bei seiner Verleihung des Friedensnobelpreises im Jahr 1957 für den maßgeblichen Beitrag zur Lösung der Suezkrise eindrucksvoll übermittelt.
In zahlreichen Missionen bewiesen sich kanadische UN-Blauhelmtruppen als stützendes Instrument, wenn es darum ging, einen Konflikt zu stillen, einen ausgehandelten Frieden langfristig zu sichern oder zusätzlich Menschen in Not zu helfen, sei es im Nahen Osten zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn oder bei humanitären Aktionen in Asien und Afrika.
Seit dem letzten bedeutenden Einsatz mit kanadischer Beteiligung, und zwar 1993 in Somalia, wandelte sich jedoch das Bild der "Erfinder des peace-keeping", bei dem es während den offiziell von der UN beauftragten Missionen UNISOM I/II, entgegen der dort geltenden Einsatzregeln, zu massiven Verstößen und Gewaltakten vonseiten des kanadischen Militärs an der Zivilbevölkerung gekommen ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgewählte peace-keeping – Missionen Kanadas
- Suezkrise
- Kanadische UN-Friedensmissionen von 1957 - 1992
- Somalia-Affäre
- Weitere Einsätze seit 1993
- Theorie
- Grundannahmen
- Schlüsselbegriffe
- Analyse ausgewählter Texte zur Suezkrise - Somalia-Affäre
- Bewertung
- Zusammenstellung der Untersuchungsergebnisse
- Kanadas Sicherheitsstrategie/Agenda
- Vom peace-keeping zur Human Security Agenda
- Resümee & Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Wandel der nationalen Identität Kanadas anhand der Suezkrise und der Somalia-Affäre. Sie analysiert, ob sich nach den einschneidenden Vorkommnissen in Somalia eine Veränderung in der kanadischen Identität feststellen lässt. Die Arbeit beleuchtet ausgewählte UN-Einsätze Kanadas seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und fokussiert dabei insbesondere auf die Konflikte am Suezkanal (1956) und den Bürgerkrieg in Somalia (1993). Sie untersucht diese Ereignisse im Kontext des Sozialkonstruktivismus, einer Theorie der Internationalen Beziehungen, und verwendet dazu eine theoriebasierte qualitative Inhaltsanalyse. Schließlich werden die Ergebnisse der Untersuchung diskutiert und in einen Ausblick auf zukünftige Chancen, Entwicklungen und Herausforderungen der kanadischen Außenpolitik eingebettet.
- Kanadische nationale Identität und peace-keeping
- Die Rolle Kanadas in der Suezkrise und der Somalia-Affäre
- Der Einfluss der Somalia-Affäre auf die kanadische Identität
- Die Anwendung des Sozialkonstruktivismus in der Analyse
- Zukünftige Herausforderungen für die kanadische Außenpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentrale Frage der Arbeit vor: Ob sich nach der Somalia-Affäre ein Wandel in der nationalen Identität Kanadas feststellen lässt. Sie erläutert die Bedeutung des peace-keeping für die kanadische Identität und gibt einen Überblick über die ausgewählten UN-Einsätze Kanadas. Das zweite Kapitel beleuchtet ausgewählte UN-Einsätze, mit besonderem Fokus auf die Suezkrise und die Somalia-Affäre. Es beschreibt die historischen Hintergründe und die Rolle Kanadas in diesen Konflikten. Das dritte Kapitel präsentiert die Grundannahmen und Schlüsselbegriffe des Sozialkonstruktivismus. Das vierte Kapitel analysiert anhand einer theoriebasierten qualitativen Inhaltsanalyse Auszüge damaliger Parlamentsdebatten zur Suezkrise und der Somalia-Affäre. Im fünften Kapitel werden die Untersuchungsergebnisse zusammengetragen, die Sicherheitsstrategie Kanadas beleuchtet und die Entwicklung vom peace-keeping zur Human Security Agenda diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen nationale Identität, peace-keeping, Suezkrise, Somalia-Affäre, Sozialkonstruktivismus, qualitative Inhaltsanalyse, kanadische Außenpolitik, Human Security Agenda. Sie untersucht den Wandel der kanadischen Identität im Kontext internationaler Konflikte und analysiert die Rolle Kanadas in der internationalen Politik unter Einbezug der Theorie des Sozialkonstruktivismus. Die Arbeit bietet einen Einblick in die Geschichte des kanadischen peace-keeping, die Entwicklung der kanadischen Sicherheitsstrategie und die Herausforderungen der kanadischen Außenpolitik in der heutigen Zeit.
- Arbeit zitieren
- Alexander Schneider (Autor:in), 2016, Der Wandel der nationalen Identität Kanadas, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/489697