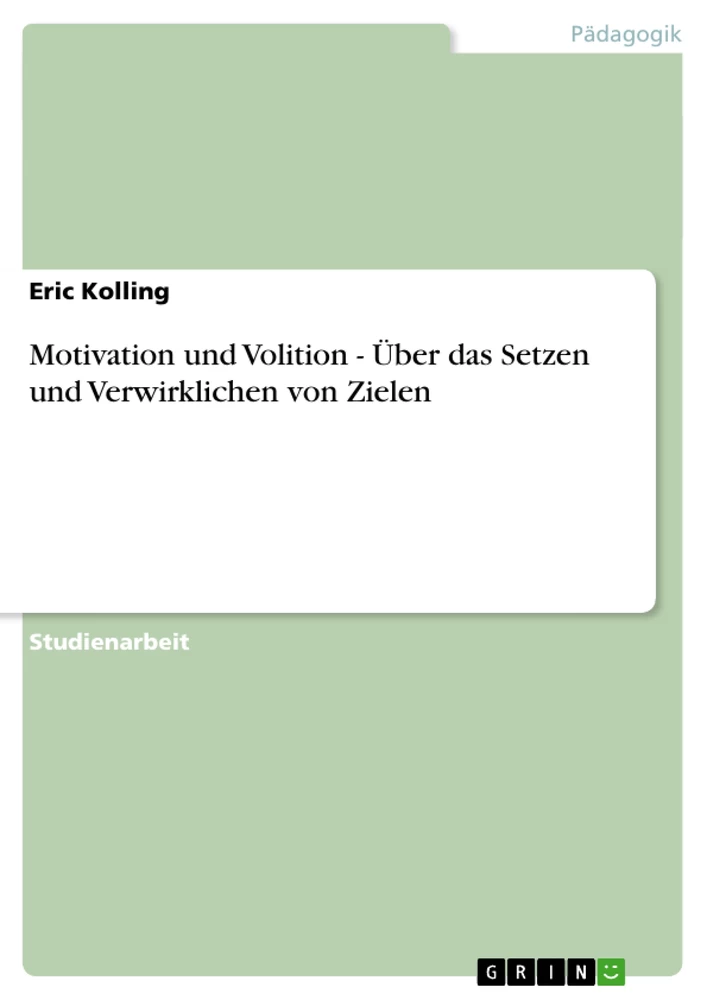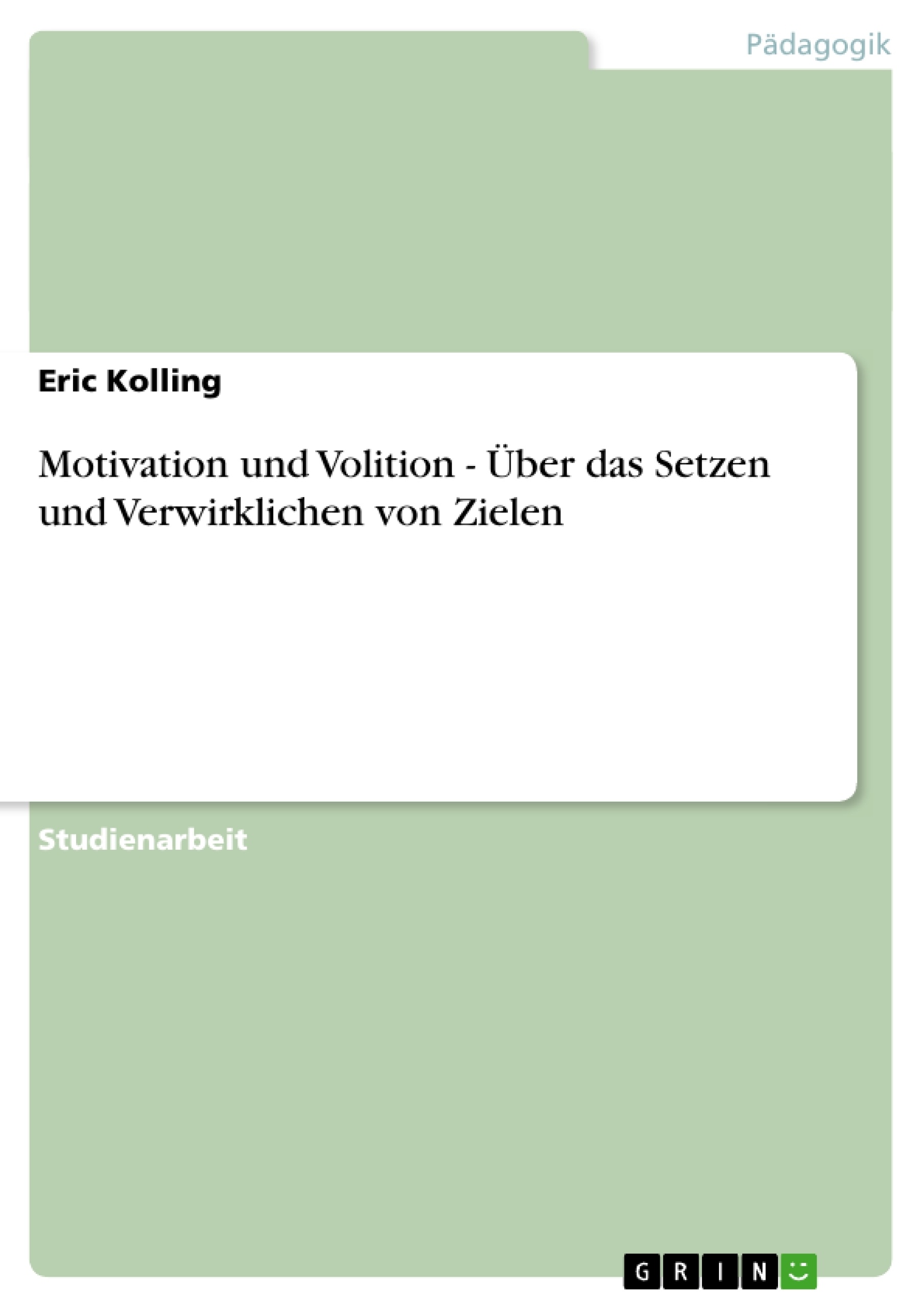Nicht all unsere Handlungen führen wir aus, weil wir dazu motiviert sind. Ein Seminar etwa, welches ein Student aufgrund des Curriculums seines Studienfaches besuchen muss, dessen Inhalten er aber nichts abgewinnen kann, wird er als anstrengend erleben. Dennoch muss er auch hier seine Leistung bringen – ein Willensprozess ist dazu nötig. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Motivation und Volition und geht insbesondere auf die Prozesse und Variablen ein, die bei der Volition eine Rolle spielen. Wie spielt Setzen und Verwirklichen von Zielen hier mit? Welche Bedingungen sind für eine Zielerreichung oder erfolgreiche Selbstregulation förderlich bzw. hinderlich. Um die Beantwortung dieser Fragen geht es in der vorliegenden Arbeit. Sie widmet sich zunächst den theoretischen Grundlagen, also etwa imperativen und sequentiellen Modellen von Motivation und Volition wie dem Rubikon-Modell. Auch die theoretische Fundierung von Kuhl Konzept der Handlungs- und Lageorientierung soll hier beleuchtet werden. Auch soll es darum gehen, in ausgewählten Testverfahren zu zeigen, wie volitionale Fähigkeiten und Schwächen gemessen werden können. Es soll herausgefunden werden, was Menschen unterscheidet, die ihre Ziele mehr oder weniger realisieren können. Zuletzt wird noch eine konkrete Anwendung vorgestellt, die Menschen mit Problemen bei der Zielerreichung helfen sollen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Zielkonzept
- Sequentielle und imperative Konzepte des Willens
- Sequentielle Konzeptionen
- Imperative Konzeptionen
- Setzen und Verwirklichen von Zielen
- Allgemeines zu Zielen
- Beschaffenheit von Zielen
- Kuhls Theorie der Handlungskontrolle
- Weitere Theorien zur Zielverwirklichung
- Wirkung von Implementations-Absichten
- Wirkung von Zielsetzung auf die Leistung
- Testverfahren zur Messung volitionaler Komponenten
- Der Selbstregulations- und Konzentrationstest für Kinder (SRST-K) und der Selbstregulations-Strategientest für Kinder (SRKT-K)
- Begriff der Selbstregulation
- Konzeption des SRKT-K
- Zusammenhang zwischen SRST-K und SRKT-K
- Testdurchführung des SRST-K
- Testauswertung und -interpretation des SRST-K
- Handlungs- und Lageorientierungsmessung mit dem HAKEMP
- Das Selbststeuerungsinventar: Dekomponierung volitionaler Funktionen
- Der Selbstregulations- und Konzentrationstest für Kinder (SRST-K) und der Selbstregulations-Strategientest für Kinder (SRKT-K)
- Trainingsprogramm zur Schulung von Lern- und Volitionsstrategien für Studenten
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Motivation und Volition, insbesondere die Prozesse und Variablen, die beim Setzen und Verwirklichen von Zielen eine Rolle spielen. Sie beleuchtet theoretische Grundlagen wie sequentielle und imperative Modelle, analysiert Kuhls Theorie der Handlungskontrolle und präsentiert Testverfahren zur Messung volitionaler Fähigkeiten. Abschließend wird eine Anwendung vorgestellt, die Menschen bei der Zielerreichung unterstützen soll.
- Zusammenhang zwischen Motivation und Volition
- Prozesse beim Setzen und Verwirklichen von Zielen
- Sequentielle und imperative Modelle des Willens (z.B. Rubikon-Modell)
- Theorien zur Handlungskontrolle und Selbstregulation
- Testverfahren zur Messung volitionaler Fähigkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und verdeutlicht die Notwendigkeit, den Willensprozess neben der Motivation zu betrachten, insbesondere bei Handlungen, die trotz fehlender intrinsischer Motivation ausgeführt werden müssen. Die Arbeit stellt die Forschungsfragen nach den Prozessen beim Setzen und Verwirklichen von Zielen und den Bedingungen für erfolgreiche Selbstregulation in den Mittelpunkt.
Das Zielkonzept: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Zielkonzepte, beginnend mit behavioristischen Ansätzen und ihren Grenzen. Es beschreibt die Entwicklung hin zu Theorien, die subjektive, internale Ziele als zentrale Auslöser zielgerichteten Handelns betrachten. Wichtige Beiträge der Mentalisten (James, McDougall) und der deutschen Willenspsychologie (Ach, Lewin) werden vorgestellt, wobei die unterschiedlichen Sichtweisen auf die Rolle von Motivation und Entschluss herausgestellt werden. Lewins Ansatz mit der Unterscheidung von Gewohnheits- und Vornahmehandeln wird als Grundlage für die Unterscheidung sequentieller und imperativer Modelle eingeführt.
Sequentielle und imperative Konzepte des Willens: Dieses Kapitel unterscheidet sequentielle und imperative Konzeptionen des Willens. Sequentielle Konzepte betonen den sukzessiven Ablauf willentlicher Handlungen mit mehreren Phasen und Alternativen, wie im Rubikon-Modell von Heckhausen und Gollwitzer dargestellt. Das Modell unterteilt den Prozess in motivationale und volitionale Phasen, wobei der "Übergang über den Rubikon" den Punkt des unwiderruflichen Entschlusses markiert. Die abschließende motivationale Phase beinhaltet die Bewertung des Handlungsergebnisses und Kausalattribution.
Schlüsselwörter
Motivation, Volition, Zielsetzung, Zielverwirklichung, Selbstregulation, Handlungskontrolle, sequentielle Modelle, imperative Modelle, Rubikon-Modell, Handlungsorientierung, Lageorientierung, Testverfahren.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Motivation, Volition und Zielerreichung
Was ist der allgemeine Gegenstand des Textes?
Der Text befasst sich umfassend mit dem Zusammenhang zwischen Motivation und Volition, insbesondere den Prozessen und Variablen beim Setzen und Verwirklichen von Zielen. Er analysiert theoretische Grundlagen, präsentiert Testverfahren zur Messung volitionaler Fähigkeiten und beschreibt ein Anwendungsprogramm zur Unterstützung der Zielerreichung.
Welche theoretischen Modelle werden im Text behandelt?
Der Text behandelt sequentielle und imperative Modelle des Willens, mit besonderem Fokus auf das Rubikon-Modell von Heckhausen und Gollwitzer. Es werden verschiedene Zielkonzepte von behavioristischen Ansätzen bis hin zu Theorien, die subjektive, internale Ziele betrachten, erläutert. Die Beiträge von Mentalisten (James, McDougall) und der deutschen Willenspsychologie (Ach, Lewin) werden ebenfalls vorgestellt.
Welche Rolle spielt Kuhls Theorie der Handlungskontrolle?
Kuhls Theorie der Handlungskontrolle wird als wichtiger Bestandteil der Analyse der Zielverwirklichung vorgestellt. Der Text beschreibt, wie diese Theorie die Prozesse der Selbstregulation und Zielerreichung erklärt.
Welche Testverfahren zur Messung volitionaler Komponenten werden beschrieben?
Der Text beschreibt den Selbstregulations- und Konzentrationstest für Kinder (SRST-K) und den Selbstregulations-Strategientest für Kinder (SRKT-K), die Handlungs- und Lageorientierungsmessung mit dem HAKEMP und das Selbststeuerungsinventar zur Dekomponierung volitionaler Funktionen.
Was beinhaltet der SRST-K und SRKT-K?
Die Beschreibung des SRST-K und SRKT-K umfasst den Begriff der Selbstregulation, die Konzeption des SRKT-K, den Zusammenhang zwischen beiden Tests, die Testdurchführung und Testauswertung/Interpretation des SRST-K.
Gibt es ein beschriebenes Trainingsprogramm?
Ja, der Text erwähnt ein Trainingsprogramm zur Schulung von Lern- und Volitionsstrategien für Studenten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Die Schlüsselwörter umfassen Motivation, Volition, Zielsetzung, Zielverwirklichung, Selbstregulation, Handlungskontrolle, sequentielle Modelle, imperative Modelle, Rubikon-Modell, Handlungsorientierung, Lageorientierung und Testverfahren.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von Kapiteln zum Zielkonzept, sequentiellen und imperativen Willenskonzepten, Testverfahren, einem Trainingsprogramm und einer Zusammenfassung. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind enthalten.
Für welche Zielgruppe ist der Text bestimmt?
Der Text richtet sich an eine akademische Zielgruppe, die sich mit Motivation, Volition und der Psychologie der Zielerreichung auseinandersetzt. Die detaillierte Beschreibung von Theorien und Testverfahren spricht für einen wissenschaftlichen Kontext.
Welche Forschungsfragen werden im Text behandelt?
Die zentralen Forschungsfragen drehen sich um die Prozesse beim Setzen und Verwirklichen von Zielen und die Bedingungen für erfolgreiche Selbstregulation, insbesondere in Situationen, in denen die intrinsische Motivation fehlt.
- Quote paper
- Eric Kolling (Author), 2004, Motivation und Volition - Über das Setzen und Verwirklichen von Zielen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/48638