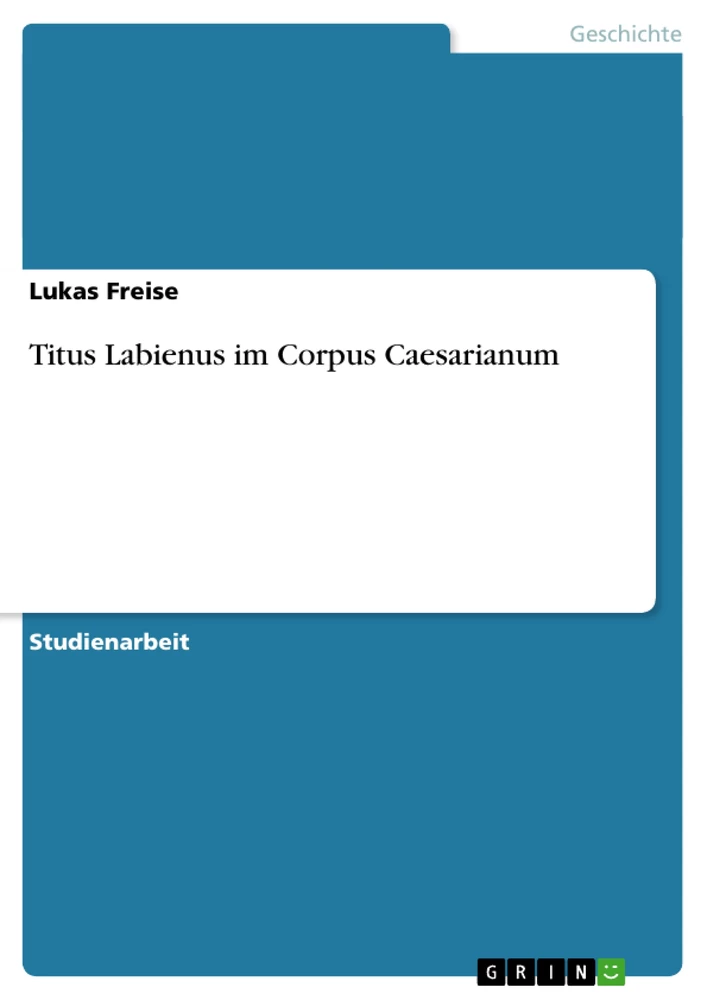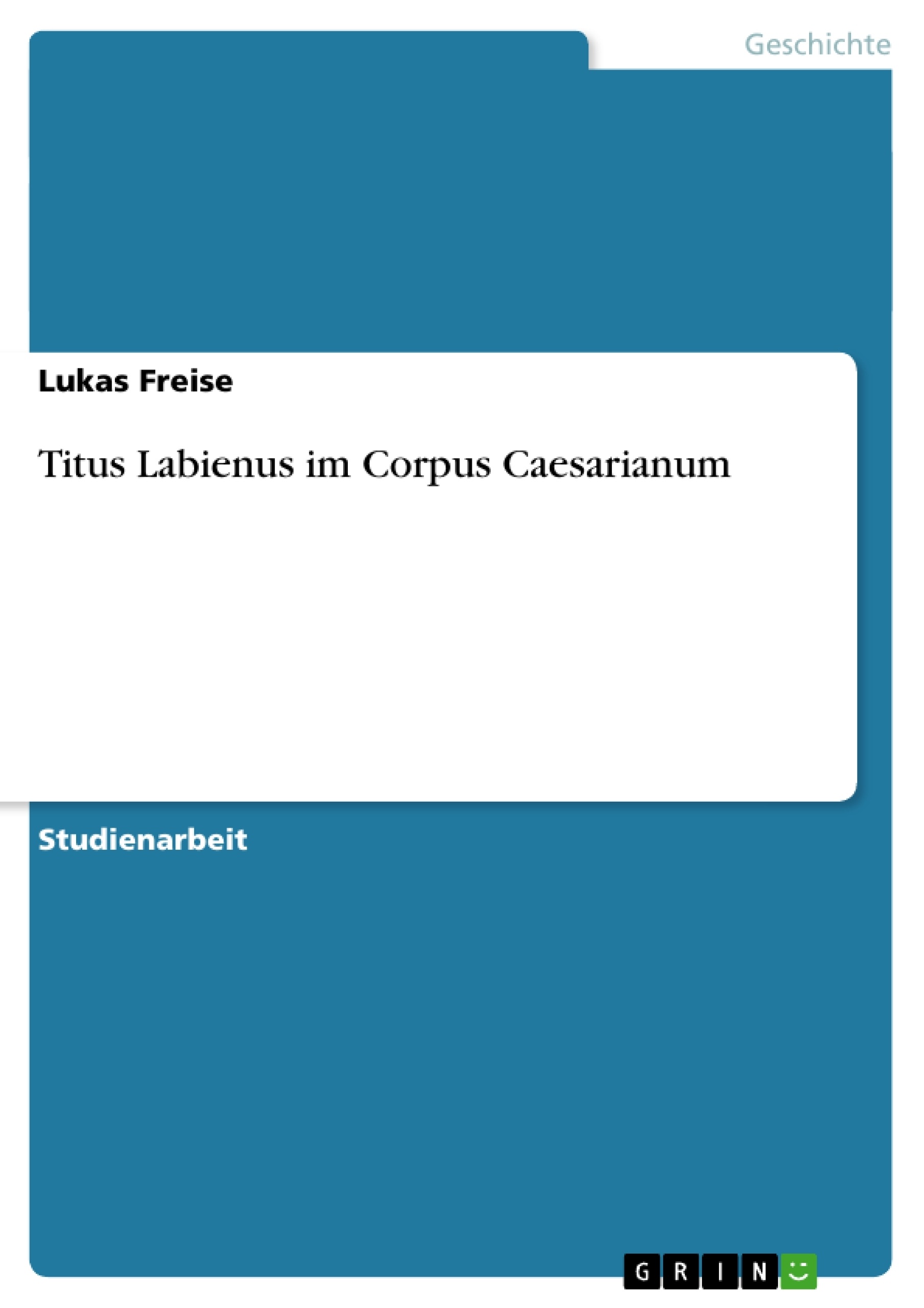Der römische Legat Titus Labienus machte während der Feldzüge Caesars in Gallien 58-50 v.Chr. eine beeindruckende Karriere. Von Beginn an Caesars oberster General, wurden ihm im Laufe des Krieges immer schwierigere Manöver selbst überlassen und er erwarb sich mit seinen Fähigkeiten das uneingeschränkte Vertrauen seines Feldherrn.
Ausgestattet mit Ruhm und Reichtum, sowie dem Oberbefehl in Gallien während Caesars Abwesenheit 49, schlug er sich dann überraschend nach Ausbruch der Bürgerkrieges auf die Seite des Pompeius. Auch nach dessen Tod bei Alexandria 48 verfolgte Labienus weiterhin die Sache der Gegner Caesars, zuerst mit Cato Uticensis in der Provinz Africa, dann mit den Söhnen des Pompeius in Spanien, wo er 45 v.Chr. den Tod in der Schlacht bei Munda fand.
Das sog. Corpus Caesarianum umfasst das bekannte, von Caesar selbst geschriebene „De bello Gallico“, weiter das 8. Buch eben dieses Werkes über die letzten beiden Jahre in Gallien (51-50 v.Chr.) ab dem Tod des Vercingetorix bis zum Ausbruch des Bürgerkrieges, verfasst von Aulus Hirtius nach dem Tod Caesars 44 und außerdem den Bürgerkrieg vom Ausbruch 49 bis zur letzten Niederlage des Pompeius bei Pharsalos 48 v.Chr. Dieser Teil ist wieder von Caesar selbst verfasst („De bello Civili“). Die drei ebenfalls zum Corpus zugehörigen Anschlusswerke, das „bellum Alexandrinum“, „bellum Africum“ und „bellum Hispaniense“ behandeln die Zeit bis zum Ende des Bürgerkriegs bei der Schlacht von Munda 45; ihre genaue Autorschaft ist bis heute ungeklärt.
Titus Labienus begleitet das Corpus Caesarianum von den ersten Kampfhandlungen in Gallien bis nach Munda in Spanien. Diese Arbeit möchte einen Blick auf Caesars General werfen und seine Darstellung in den verschiedenen Teilen des Corpus untersuchen, um die charakteristischen Unterschiede der Autoren herauszuarbeiten. Besonders die Problematik der Werke der Autorschaft Caesars ist dabei hervorzuheben: Dem sprachlich einfachen und klaren Text des Commentarius, dessen inhaltlich sowie taktische Aussagen z.T. sogar archäologisch verifiziert werden konnten, steht eine komplexe propagandistische Verfasserintention diametral entgegen.
Zuletzt sollen antike Quellen und moderne Forschungsliteratur über den „Seitenwechsel“ des Labienus untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die politische Karriere in Rom
- Herkunft
- Karriere
- Labienus in de bello Gallico
- Die ersten Erwähnungen durch Caesar
- Caesars Legaten in Gallien
- Die Bewährung in Gallien
- Der Höhepunkt der Karriere unter Caesar
- Labienus im Entscheidungsjahr 52
- Der Wechsel zu Pompeius
- Die Darstellung in den antiken Quellen
- Die Motive des Labienus
- Labienus bei Aulus Hirtius
- Die neue Darstellung im 8. Buch
- Bewerbung um das Konsulat 48?
- Labienus in Caesars Bellum Civile
- Der Reichtum des Labienus
- Pax esse nulla potest
- Die Propaganda Caesars gegen seine Feinde
- Das strategische Talent des Labienus
- Labienus in Africa
- Die Wahrnehmung des Autors
- Der Autor des Bellum Africum
- Hinterhalte und Misserfolge
- Labienus in Spanien
- Die Loyalität zu den Söhnen des Pompeius
- Das Ende des Labienus
- Fazit
- Die politische Karriere des Labienus in Rom
- Die Darstellung Labienus' in Caesars "De Bello Gallico" und die Frage nach Caesars propagandistischer Intention
- Der Seitenwechsel des Labienus zu Pompeius und die Motive dahinter
- Die Darstellung Labienus' in den verschiedenen Werken des Corpus Caesarianum
- Die Bedeutung von antiken Quellen und moderner Forschungsliteratur für die Untersuchung des "Seitenwechsels" des Labienus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Darstellung des römischen Legaten Titus Labienus im Corpus Caesarianum, insbesondere in den Werken "De Bello Gallico" und "Bellum Civile". Ziel ist es, die charakteristischen Unterschiede in der Darstellung Labienus' durch die verschiedenen Autoren des Corpus herauszuarbeiten, wobei die Problematik der Werke der Autorschaft Caesars im Vordergrund steht.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den historischen Kontext von Titus Labienus' Karriere und dessen Bedeutung für das Corpus Caesarianum dar.
Das erste Kapitel beleuchtet die politische Karriere des Labienus in Rom, seine Herkunft aus einer picenischen Familie und seine ersten politischen Ämter. Dabei wird die Verbindung des Labienus zu den politischen Kreisen von Pompeius und Caesar herausgestellt.
Das zweite Kapitel befasst sich mit Labienus' Rolle in Caesars "De Bello Gallico". Es werden seine frühen Erwähnungen, seine Aufgaben als Legat und seine militärischen Erfolge in Gallien beschrieben.
Im dritten Kapitel wird der Wechsel des Labienus zu Pompeius untersucht. Die Darstellung des Ereignisses in den antiken Quellen und die möglichen Motive für Labienus' Entscheidung werden beleuchtet.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Darstellung des Labienus im 8. Buch des "De Bello Gallico", das von Aulus Hirtius verfasst wurde.
Das fünfte Kapitel untersucht die Darstellung Labienus' in Caesars "Bellum Civile".
Das sechste Kapitel analysiert die Darstellung des Labienus im "Bellum Africum" des Corpus Caesarianum.
Das siebte Kapitel beleuchtet Labienus' Rolle im "Bellum Hispaniense" und sein Ende in der Schlacht bei Munda.
Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Titus Labienus, Corpus Caesarianum, "De Bello Gallico", "Bellum Civile", Pompeius, Caesar, Seitenwechsel, politische Karriere, Legat, Militärgeschichte, antike Quellen, Forschungsliteratur
- Quote paper
- Lukas Freise (Author), 2005, Titus Labienus im Corpus Caesarianum, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/48045