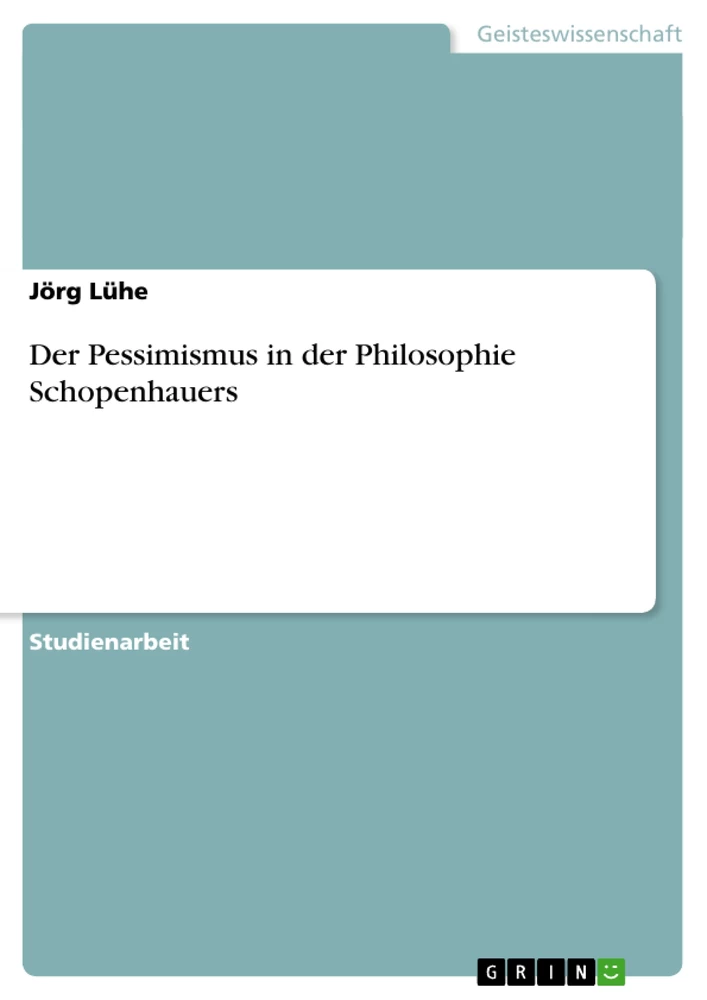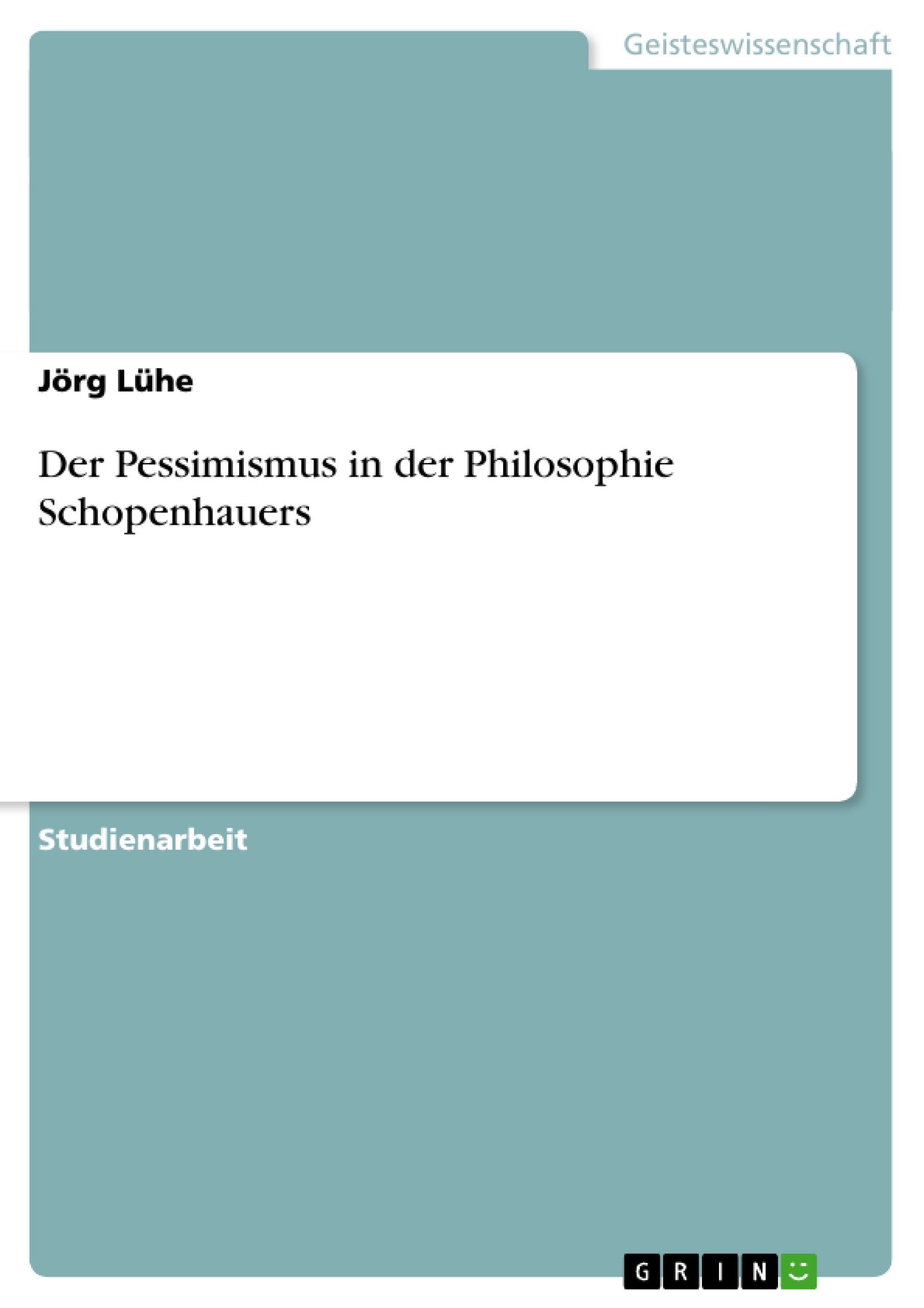Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Zusammenhänge zwischen Arthur Schopenhauers Metaphysik, seiner pessimistischen Weltsicht und seiner Lehre von der Verneinung des Willens darzulegen.
Der Ausgangspunkt der Untersuchungen ist eine Andeutung Schopenhauers am Ende seiner Preisschrift über das Fundament der Moral, in der er darauf hinweist, dass sich die Ethik nicht allein in der Lehre vom tugendhaften Leben erschöpft. Im Folgenden wird versucht zu belegen, dass Schopenhauer sich mit diesen Andeutungen auf die Praxis der Askese bezieht. Unter der Askese versteht Schopenhauer eine Lebensführung, die darum bemüht ist, alles Angenehme zu vermeiden und alles Unangenehme aufzusuchen.
Der Zweck der Askese ist nach Schopenhauer eine bewusste Brechung des Willens, durch die sich der Mensch letztendlich aus einer als leidvoll empfundenen Welt befreien kann.
Vom Besonderen Interesse ist der Umstand, dass Schopenhauer nicht auf dem Wege innerer Erleuchtung sondern, wie er behauptet, ganz allein auf dem Wege philosophischer Reflexion zu dieser Auffassung gelangte, die auch von Mystikern wie Meister Eckhart oder Buddha vertreten wurde. So rühmt sich Schopenhauer etwa, dass in seinem Werk zum ersten Mal eine abstrakte, nicht mystisch oder religiös verkleidete Darlegung der Askese vorgenommen wurde.
Der Theorie der Askese, die auf die Erlösung des Menschen aus der Welt hinweist, steht seine pessimistische Weltsicht gegenüber. Es soll dargelegt werden, dass für Schopenhauer das Leben der Menschen notwendigerweise voller Leid und Schmerz ist, und das dieser Umstand im Wesen des Menschen begründet liegt. Dementsprechend ist dem Kapitel über den Pessimismus eine Übersicht über die Schopenhauersche Metaphysik vorangestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Die Askese - ein Teilgebiet der Ethik
- Metaphysik
- Der Grundgedanke der Schopenhauerschen Metaphysik
- Die Herleitung der Schopenhauerschen Metaphysik
- Schopenhauers Pessimismus
- Der Tod - das Los der Menschen
- Die Ablehnung des Nihilismus
- Die Schuldhaftigkeit des menschlichen Daseins
- Der Mensch als Feind seines Mitmenschen
- Der Zusammenhang zwischen Metaphysik und Ethik
- Die Askese – der Ausweg aus der Welt
- Schopenhauers Ablehnung des Selbstmordes
- Schopenhauers Erklärung einer asketischen Lebensführung
- Die Lebensweise des Asketen
- Die Verneinung des Willens zum Leben
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Arthur Schopenhauers philosophischer Lehre und untersucht den engen Zusammenhang zwischen seiner Metaphysik, seiner pessimistischen Weltsicht und seiner Ethik der Willensverneinung, die in der Askese ihren Ausdruck findet.
- Schopenhauers Metaphysik und der blinde Wille als treibende Kraft der Welt
- Der pessimistische Blick Schopenhauers auf das menschliche Dasein und die allgegenwärtige Präsenz von Leid und Schmerz
- Die Askese als Weg zur Befreiung von der leidvollen Welt durch die bewusste Brechung des Willens
- Der Gegensatz zwischen Schopenhauers Askese und dem protestantischen Verständnis von Ethik
- Die Bedeutung der philosophischen Reflexion für Schopenhauers Lehre und ihre Abgrenzung von mystischen Traditionen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Ziel der Arbeit vor, die Verbindungen zwischen Schopenhauers Metaphysik, Pessimismus und Askese aufzudecken. Sie beleuchtet Schopenhauers Hinwendung zur Askese als Lebensführung, die das Angenehme vermeidet und das Unangenehme sucht, um den Willen zu brechen und Befreiung von der Welt zu erlangen. Das Kapitel hebt Schopenhauers philosophischen Ansatz hervor und betont die Abgrenzung von mystischen Traditionen.
Kapitel 2 widmet sich der Askese als Teilgebiet der Ethik. Schopenhauers Andeutung in seiner Preisschrift über die Bedeutung der Askese, die jedoch aufgrund der Vorgaben der Preisfrage nicht weiter ausgeführt werden konnte, wird beleuchtet. Schopenhauers Kritik am Protestantismus, das er als Abweichung vom „wahren Christentum“ bezeichnet, wird in Bezug auf dessen Verleugnung des asketischen Charakters des Christentums dargestellt.
Kapitel 3 bietet einen Überblick über die Schopenhauersche Metaphysik. Der Grundgedanke der Metaphysik, der blinde Wille als innerer Kern der Welt, wird erläutert. Schopenhauers Begriff des Willens wird im Kontrast zum Willensbegriff der Alltagssprache gesetzt und seine umfassende Bedeutung als treibende Kraft aller Phänomene hervorgehoben. Der Zusammenhang zwischen Metaphysik und Ethik wird betont, da Schopenhauer diese beiden Disziplinen als untrennbar verbunden betrachtet.
Kapitel 4 widmet sich Schopenhauers pessimistischer Weltsicht. Es wird dargelegt, dass für Schopenhauer das Leben der Menschen notwendigerweise voller Leid und Schmerz ist, und dass diese Tatsache im Wesen des Menschen selbst begründet liegt. Der Zusammenhang zwischen Pessimismus und Metaphysik wird beleuchtet und die Rolle des Willens als Quelle des Leids hervorgehoben.
Kapitel 5 beleuchtet die enge Verbindung zwischen Schopenhauers Metaphysik und Ethik. Schopenhauer hebt die Einheit von Ethik und Metaphysik hervor und betont die falsch verstandene Trennung von Seele und Körper, die er in seiner Philosophie überwinden möchte.
Kapitel 6, das sich mit der Askese als Ausweg aus der Welt beschäftigt, wird im vorliegenden Preview nicht behandelt, um Spoiler zu vermeiden.
Schlüsselwörter
Schopenhauer, Metaphysik, Wille, Pessimismus, Askese, Lebensführung, Leid, Schmerz, Befreiung, Willensverneinung, protestantische Ethik, philosophischer Ansatz, Christentum, Mystik, Welt als Wille und Vorstellung, Preisschrift über das Fundament der Moral.
- Quote paper
- Jörg Lühe (Author), 2005, Der Pessimismus in der Philosophie Schopenhauers, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/47628