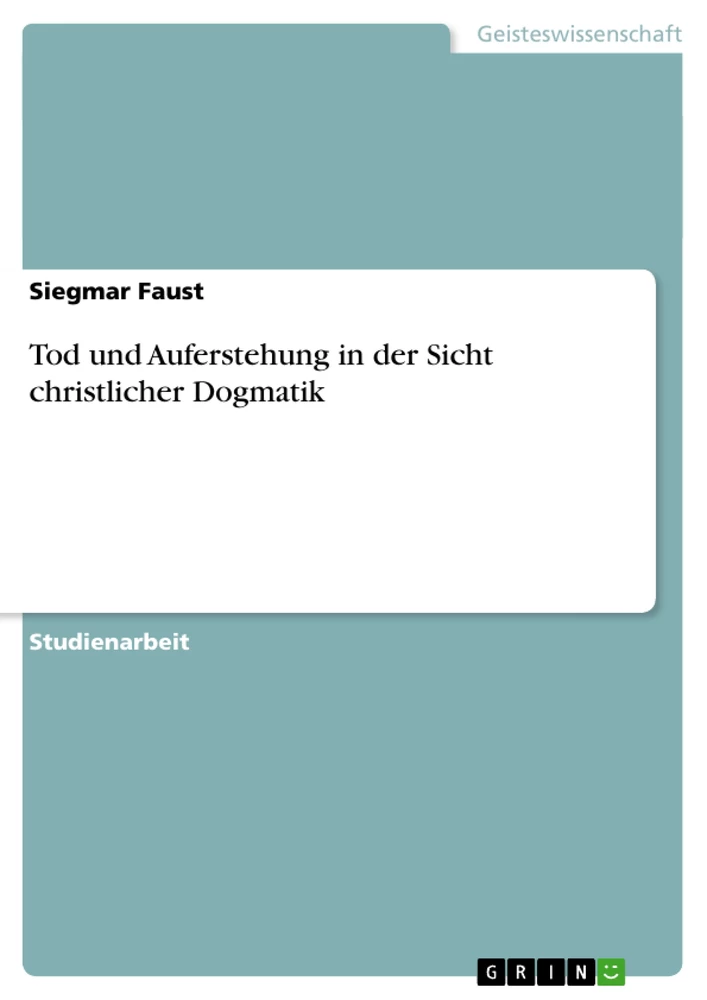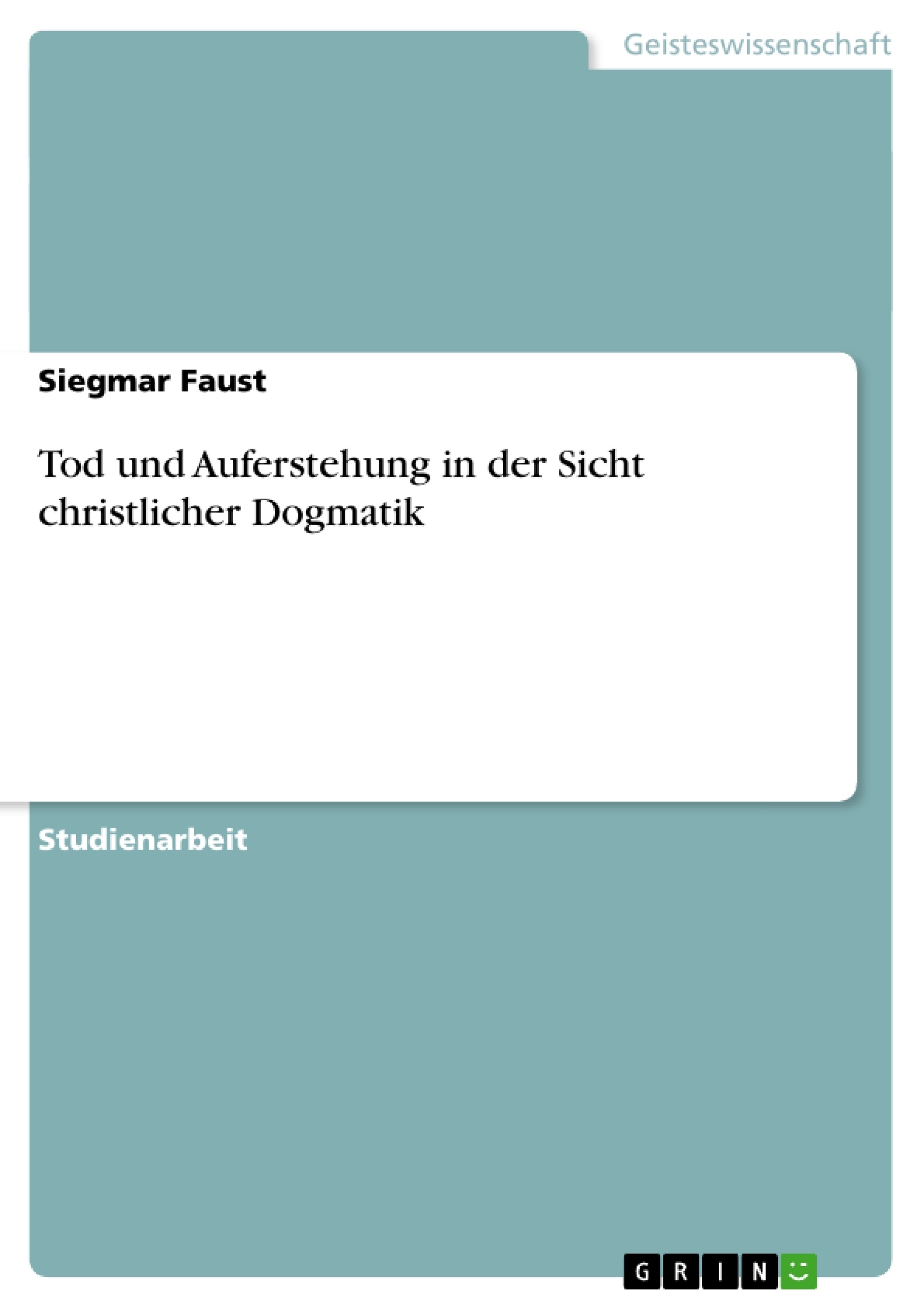Angesichts des Todes ist Schweigen angemessen. Wenn doch darüber gesprochen werden muss, weil es von alters her ein beunruhigendes Thema ist, sollten zuvor die Hände gefaltet, der Kopf gesenkt, die Augen geschlossen und drei Minuten des Gedenkens unseren Vorfahren gewidmet werden.
Das, was wir vom Tod zu wissen glauben, begreifen wir an den Anderen, ohne es zu verstehen, und das nicht, weil wir fassungslos davor stehen, sondern weil wir als Im-Leben-Stehende die Sache des Nichtlebens nicht zu vertreten haben. Genauso wie das Nicht-Sein nicht die Sache des Seins vertreten, also verstehen kann. Wir stehen vor etwas, um es besser verstehen zu wollen, aber das Objekt des Todes, des Nichtmehrdaseins lässt sich vom Dasein nicht vertreten, also vom Verstand her nicht erfassen. So sehr der Tod eines Anderen unser Leben auch zu verändern mag, so können wir dennoch nicht den Tod selber erfahren und erleben, sondern nur unsere eigene Trauer oder klammheimliche Freude oder was auch immer. Ohne die Hoffnung, den Tod mit Gottes Hilfe besiegen zu können, wären nicht so viele Menschen zu Märtyrern geworden, die sich freilich erheblich von Sprengstoffattentätern, raubeinigen Söldnern oder waghalsigen Extremsportlern unterscheiden. In Staaten, wo Christen bekämpft werden, bewähren sie sich überwiegend in Gefängnissen oder Lagern unter den Mitgefangenen als stabilisierend, hilfs- und opferbereit. Sie spenden so den anderen Lebensmut und Hoffnung. Weil Christen, im Gegensatz zu den einer konstruierten Ersatzreligion verfallenen Marxisten, nicht das Paradies auf Erden versprechen, sondern auf das gerechte Leben nach dem Tode hoffen, begründet sich aus ihrem Glauben ein Bewusstsein der Freiheit von allen Mächten dieser Welt, von allen Normen und Sanktionen der Gesellschaft. Diese Haltung hat durchaus zur Individualisierung bis hin zur inflationären Vereinzelung des Einzelnen beigetragen, die auch Perversionen, rücksichtslosen Rückzug ins private Gebet oder ein vordergründiges, ekelerregendes Gutmenschentum im Gefolge haben. Doch insgesamt lässt sich bilanzieren, dass die Entwicklung der Menschenrechte und die Bildung demokratischer Staaten, wo auch Massenwohlstand herrscht, als Weiterentwicklung antiker Vorformen ohne den christlichen Gottesbezug, der jetzt in der europäischen Verfassung wissentlich fallen gelassen wurde, nicht oder nicht so stattgefunden hätte.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkungen
- I. Wolfhart Pannenberg (geb. 1928) geht von der Gegenwart und zugleich von einer gewagten These aus: Die Verdrängung des Todes in der gesellschaftlichen Lebenswelt geht Hand in Hand mit der Privatisierung der Individualität.³
- II. Die Begründung aller Hoffnung unvergänglichen Lebens unter Gottes Schirm ließe sich, so Pannenberg, nur dann voll verstehen, wenn man beachtet, dass der Sinn des Wortes ,,Leben“ überhaupt religiös fundiert ist.
- III. Gibt es eine „,Theologie des Todes“?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die Sichtweise der christlichen Dogmatik auf Tod und Auferstehung, insbesondere im Kontext eines Aufsatzes von Wolfhart Pannenberg. Er untersucht, wie sich der Tod in der gesellschaftlichen Lebenswelt und im individuellen Erleben widerspiegelt, und erörtert die Verbindung zwischen Gott und Leben in der christlichen Tradition.
- Die Verdrängung des Todes in der modernen Gesellschaft
- Die Rolle der Individualität und des Todes in der Geschichte
- Die religiöse Fundierung des Lebens und die Trennung von Gott
- Die Frage der „Theologie des Todes“ und die Schwierigkeit, den Tod in einem christlichen Kontext zu begreifen
- Die Vorstellung von einem „Gerichtstod“ und der Unvergänglichkeit des Menschen
Zusammenfassung der Kapitel
Vorbemerkungen
Der Text beginnt mit einer Reflexion über die Bedeutung des Todes und die menschliche Reaktion auf ihn. Er stellt den Tod als ein „irritierendes wie inspirierendes Faktum“ dar und betont die Notwendigkeit, das Thema „Weltende“ neben dem „Tod“ zu betrachten, um eine umfassende Perspektive zu erhalten.
I. Wolfhart Pannenberg (geb. 1928) geht von der Gegenwart und zugleich von einer gewagten These aus: Die Verdrängung des Todes in der gesellschaftlichen Lebenswelt geht Hand in Hand mit der Privatisierung der Individualität.³
In diesem Abschnitt wird die These Pannenbergs beleuchtet, dass die Verdrängung des Todes in der Gesellschaft mit der Privatisierung der Individualität einhergeht. Es werden historische Beispiele wie die DDR-Literatur und die „Spaßgesellschaft“ angeführt, um die Ambivalenz der Todeswahrnehmung zu verdeutlichen.
II. Die Begründung aller Hoffnung unvergänglichen Lebens unter Gottes Schirm ließe sich, so Pannenberg, nur dann voll verstehen, wenn man beachtet, dass der Sinn des Wortes ,,Leben“ überhaupt religiös fundiert ist.
Der Text beleuchtet die christliche Vorstellung von Leben als etwas, das an Gott gebunden ist. Das Leben wird als Schöpfung Gottes verstanden, und der Tod als Trennung von ihm. Der Abschnitt diskutiert die Verbindung zwischen Gott und Leben, die in der christlichen Tradition eine zentrale Rolle spielt.
III. Gibt es eine „,Theologie des Todes“?
Dieser Teil befasst sich mit der Frage, ob es eine „Theologie des Todes“ gibt, und welche Schwierigkeiten diese mit sich bringt. Die Diskussion um den „natürlichen Tod“ und den „Gerichtstod“ sowie die Verbindung zur Geschöpflichkeit des Menschen werden angesprochen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Textes sind Tod, Auferstehung, christliche Dogmatik, Wolfhart Pannenberg, Individualität, Gesellschaft, Leben, Gott, Trennung, „Theologie des Todes“, „Gerichtstod“, Geschöpflichkeit, Unvergänglichkeit.
- Quote paper
- Siegmar Faust (Author), 2005, Tod und Auferstehung in der Sicht christlicher Dogmatik, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/47447