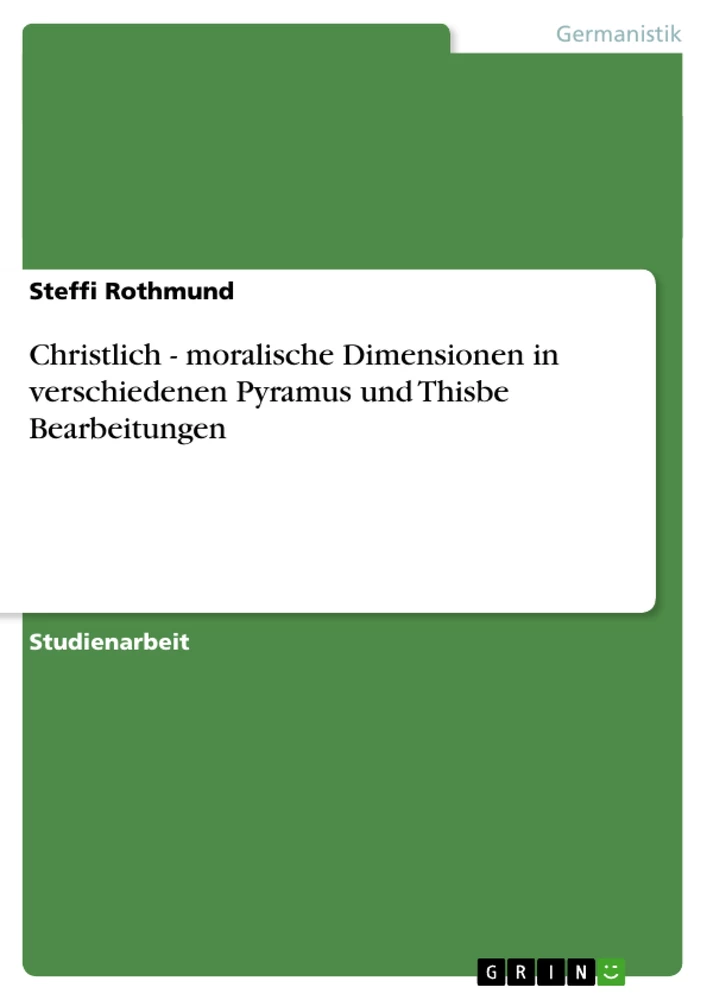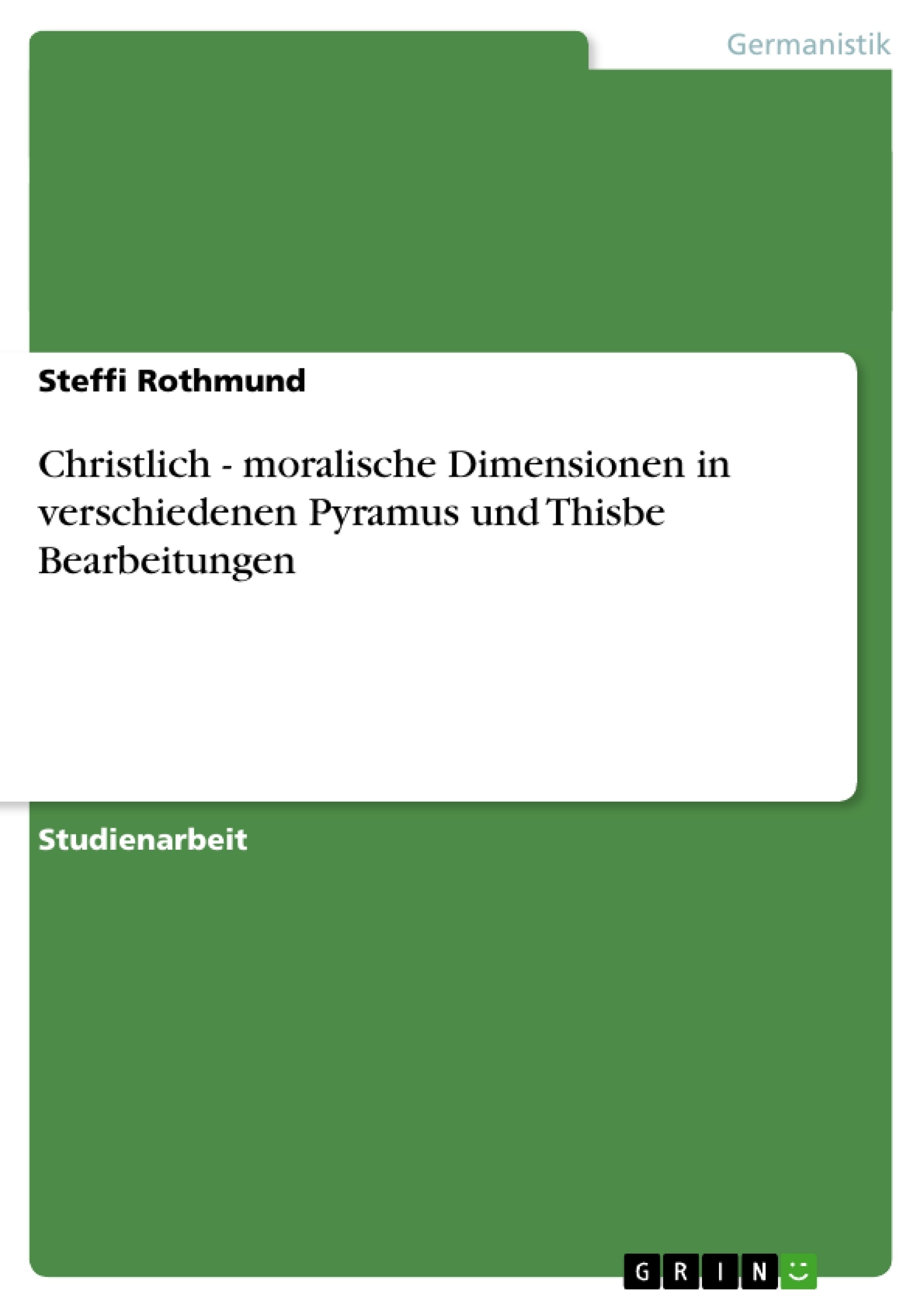Die Metamorphosen des Ovid zählen sicherlich zu den bedeutendsten Werken der Weltliteratur. Es wundert nicht, dass Ovid eine ausgeprägte Rezeptionsgeschichte vorweisen kann, denn Stoff bieten allein die Metamorphosen in Hülle und Fülle. Die Wirkung Ovids setzt im Hohen Mittelalter ein: Künstler aller Sparten „wetteifern in der Nachbildung und Abwandlung ovidischer Motive“. Ovid wurde zum Modeautor; durch seine Allgegenwärtigkeit prägte er schließlich den Begriff der Aetas Ovidiana,wobei vor allem die Metamorphosen ungeheuer beliebt waren.
Jede Metamorphose zeichnet sich durch die Schilderung einer Verwandlung aus, die sich als Folge der Erzählung ergibt. Beispiele hierfür sind sowohl der Götterzorn, der häufig Eingang in die Erzählungen findet, als auch die Liebe, die in den Metamorphosen oft Anlass zu einer Verwandlung bietet. So auch in der Geschichte Pyramus und Thisbe, die dieser Arbeit zugrunde liegt.
Zunächst steht Ovids Original im Mittelpunkt und wird einer ausführlichen Betrachtung unterzogen, damit die Unterschiede zu den zu vergleichenden Textcorpora leichter aufgezeigt werden können. Im Anschluss daran werden die dazugehörigen Auslegungen vorgestellt, näher betrachtet und untereinander verglichen. Sowohl in den bearbeiteten Pyramus und Thisbe-Geschichten als auch in den dazugehörigen Auslegungen finden sich christliche Moralvorstellungen, die für die Entstehungszeit nicht ungewöhnlich sind. Das Erkenntnisinteresse liegt in der Frage, wie die christlichen Moralvorstellungen sowohl in der Bearbeitung von Pyramus und Thisbe als auch in den dazugehörigen Auslegungen umgesetzt sind.
Inhaltsverzeichnis
- I Vorwort
- II Ovids Pyramus und Thisbe
- III Bearbeitungen von Pyramus und Thisbe
- a) Jörg Wickram
- b) Johann Spreng
- IV Die Auslegungen
- a) Gerhard Lorichius
- b) Johann Spreng
- c) Georg Sabinus
- d) Vergleich der Auslegungen
- V Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die christlich-moralischen Dimensionen in verschiedenen Bearbeitungen der Pyramus-und-Thisbe-Geschichte. Die Hauptzielsetzung besteht darin, die Umsetzung christlicher Moralvorstellungen in sowohl den Bearbeitungen des Ovidschen Originals als auch in den dazugehörigen Interpretationen zu analysieren und zu vergleichen. Der Fokus liegt auf der Erforschung der Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Darstellung der Thematik und der Interpretation der moralischen Aspekte.
- Die Rezeption von Ovids Pyramus und Thisbe im Mittelalter und der Frühen Neuzeit
- Die Rolle christlich-moralischer Vorstellungen in den Bearbeitungen
- Vergleichende Analyse verschiedener Interpretationen der Geschichte
- Die Darstellung von Schuld und Verantwortung in der Tragödie
- Analyse der literarischen Mittel und ihrer Wirkung
Zusammenfassung der Kapitel
I Vorwort: Das Vorwort führt in die Thematik ein und erläutert den Hintergrund der Arbeit. Es betont die Bedeutung der Metamorphosen Ovids und deren weitreichende Rezeptionsgeschichte. Die Arbeit konzentriert sich auf die Geschichte von Pyramus und Thisbe und deren Interpretation im Kontext christlicher Moralvorstellungen. Die Methodik wird kurz umrissen: Zuerst wird Ovids Originaltext analysiert, um die Basis für den Vergleich mit späteren Bearbeitungen zu legen. Anschließend werden die ausgewählten Bearbeitungen und deren Interpretationen untersucht und miteinander verglichen, um die Entwicklung und Veränderung der moralischen Aspekte aufzuzeigen.
II Ovids Pyramus und Thisbe: Dieses Kapitel analysiert Ovids Originaltext der Pyramus-und-Thisbe-Geschichte. Es beschreibt den Handlungsverlauf, die Charaktere und die zentralen Motive. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Liebe, des Verbots durch die Eltern und den daraus resultierenden tragischen Konsequenzen. Die Analyse beleuchtet die literarischen Mittel, wie die Personifikation der Wand und die Symbolik des Maulbeerbaums, und deren Bedeutung für die Geschichte. Besonders hervorgehoben wird die Rolle der "Harmatia" (Fehler) des Pyramus als Ursache der Tragödie. Das Kapitel endet mit einer Betrachtung der Schönheit der Protagonisten und der Schlüsselmotive, insbesondere der Liebe, der Wand und des Maulbeerbaumes. Die Beschreibung der Kommunikation der Liebenden durch die Wand wird als ein besonders eindrucksvolles sprachliches Bild hervorgehoben, durch den Chiasmus wird eine Symmetrie geschaffen, die die Situation für den Leser verbildlicht.
Schlüsselwörter
Pyramus und Thisbe, Ovid, Rezeption, Mittelalter, Frühe Neuzeit, Christlich-moralische Dimensionen, Liebesverbot, Tragödie, Harmatia, literarische Analyse, Motiv, Symbolik, Vergleichende Literaturwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse christlich-moralischer Dimensionen in Bearbeitungen der Pyramus-und-Thisbe-Geschichte
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert die christlich-moralischen Dimensionen in verschiedenen Bearbeitungen der antiken Pyramus-und-Thisbe-Geschichte. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Umsetzung christlicher Moralvorstellungen in den Bearbeitungen des Ovidschen Originals und deren Interpretationen im Mittelalter und der Frühen Neuzeit.
Welche Bearbeitungen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht unter anderem Bearbeitungen von Jörg Wickram und Johann Spreng, sowie Interpretationen von Gerhard Lorichius, Johann Spreng und Georg Sabinus. Die Analyse beginnt mit einer detaillierten Untersuchung des Ovidschen Originals, um eine Basis für den Vergleich zu schaffen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Rezeption von Ovids Pyramus und Thisbe, der Rolle christlich-moralischer Vorstellungen in den Bearbeitungen, einer vergleichenden Analyse verschiedener Interpretationen, der Darstellung von Schuld und Verantwortung, sowie der Analyse der verwendeten literarischen Mittel und deren Wirkung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in ein Vorwort, ein Kapitel über Ovids Originaltext, ein Kapitel über ausgewählte Bearbeitungen, ein Kapitel über verschiedene Auslegungen und ein Fazit. Das Vorwort erläutert die Thematik und Methodik. Die Kapitel analysieren den Originaltext, die Bearbeitungen und Interpretationen, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Darstellung der Thematik und der Interpretation der moralischen Aspekte aufzuzeigen.
Was wird im Kapitel zu Ovids Pyramus und Thisbe analysiert?
Dieses Kapitel analysiert den Handlungsverlauf, die Charaktere und zentralen Motive in Ovids Originaltext. Es beleuchtet die Darstellung der Liebe, das Liebesverbot, die tragischen Konsequenzen und die literarischen Mittel wie Personifikation und Symbolik. Besonders wird die Rolle der "Harmatia" (Fehler) des Pyramus und die eindrucksvolle sprachliche Gestaltung, insbesondere die Beschreibung der Kommunikation der Liebenden durch die Wand, untersucht.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Pyramus und Thisbe, Ovid, Rezeption, Mittelalter, Frühe Neuzeit, Christlich-moralische Dimensionen, Liebesverbot, Tragödie, Harmatia, literarische Analyse, Motiv, Symbolik, Vergleichende Literaturwissenschaft.
Welches Fazit zieht die Arbeit?
(Das Fazit ist in der bereitgestellten HTML-Vorschau nicht enthalten und muss aus dem vollständigen Text entnommen werden.)
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für Wissenschaftler und Studenten der Literaturwissenschaft und vergleichenden Literaturwissenschaft gedacht, die sich für die Rezeption antiker Texte im Mittelalter und der Frühen Neuzeit sowie für die Analyse christlich-moralischer Dimensionen in der Literatur interessieren.
- Arbeit zitieren
- Steffi Rothmund (Autor:in), 2005, Christlich - moralische Dimensionen in verschiedenen Pyramus und Thisbe Bearbeitungen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/47191