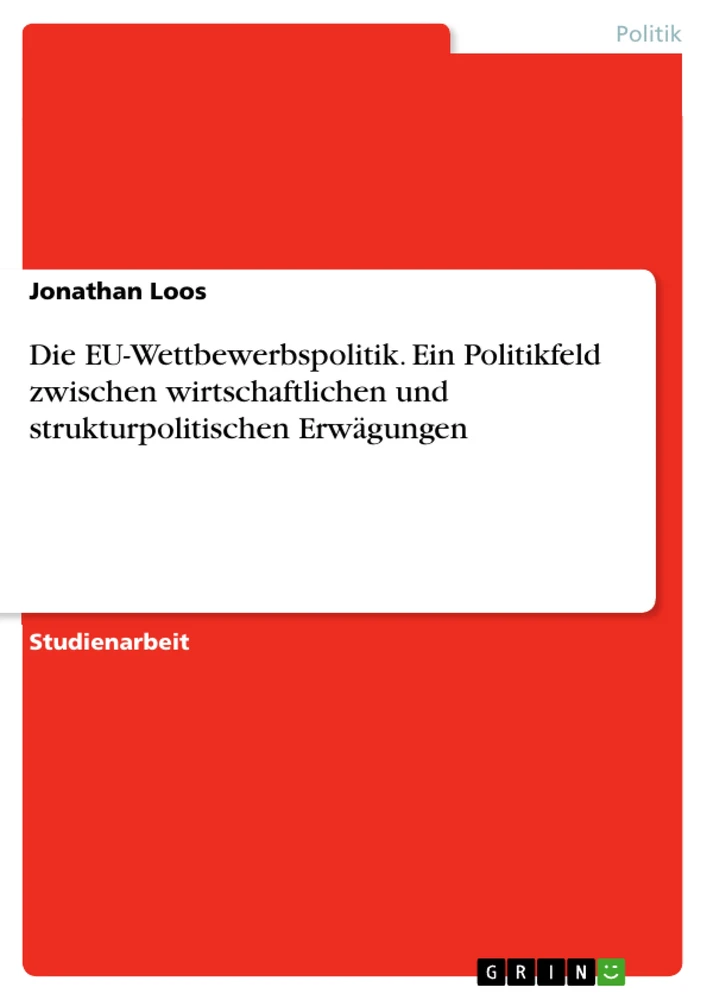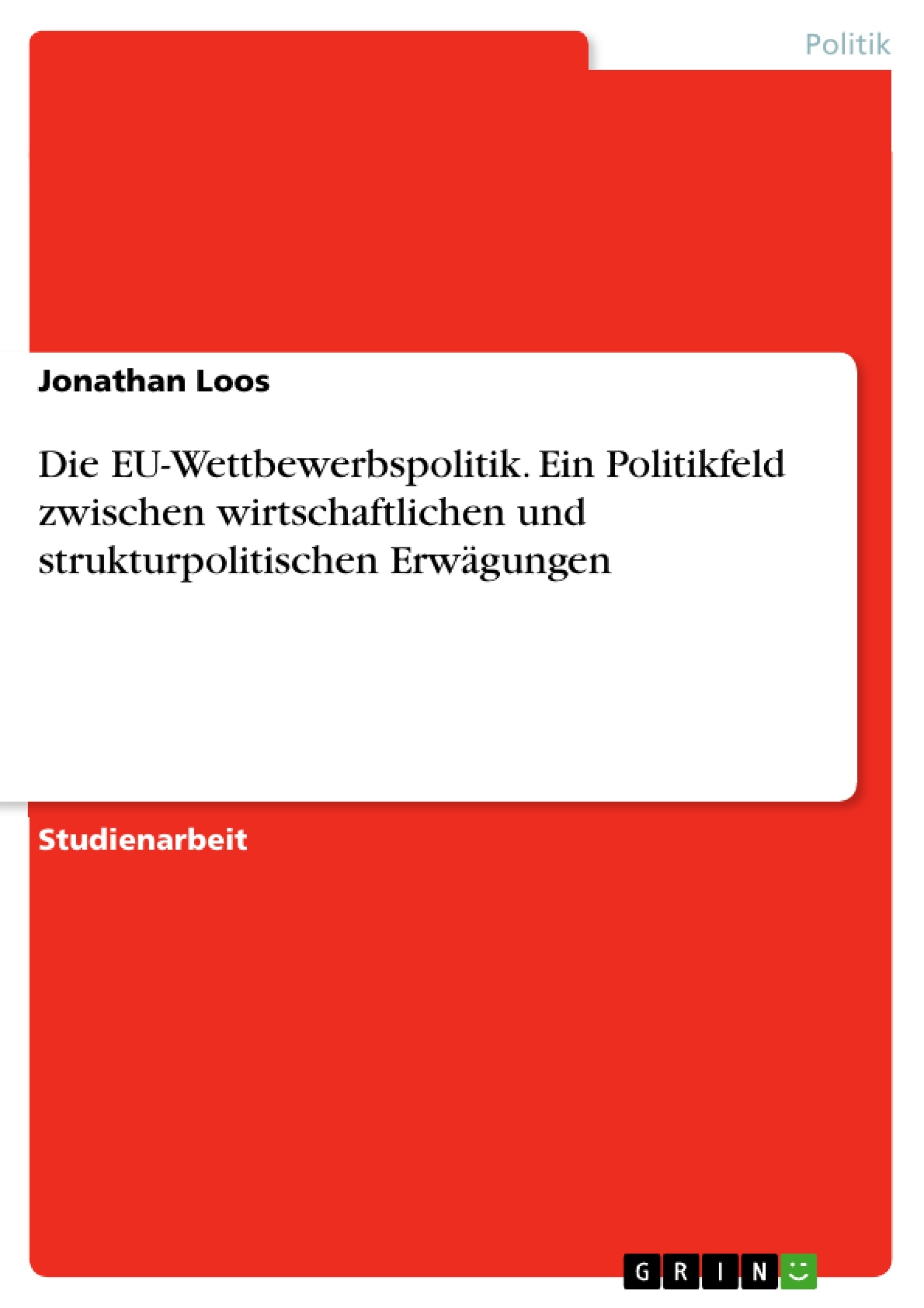Wie sich die Wettbewerbspolitik der EU entwickelt hat und welche zentralen Akteure dafür maßgeblich sind, ist Forschungsgegenstand der folgenden Untersuchungen. Zunächst wird die Bedeutung des Wettbewerbs für die europäische Volkswirtschaft betrachtet. Anschließend werden verschiedene Leitbilder einer guten Wettbewerbspolitik vorgestellt. Danach werden dann die Grundlagen der EU-Wettbewerbspolitik untersucht. Dazu wird zunächst auf die Entwicklung der Wettbewerbspolitik innerhalb der EU eingegangen, anschließend werden die Instrumente und die mit der Wettbewerbspolitik verbundenen Institutionen analysiert. Außerdem werden die entsprechenden Durchsetzungsmechanismen der Kontrollbehörden skizziert und abschließend aktuelle Entwicklungen der EU-Wettbewerbspolitik aufgezeigt.
Die Wettbewerbspolitik der Europäischen Union ist ein Politikfeld, das in den letzten Jahren auch international zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Als "the world’s most famous regulator" beschreibt Sarah Lyall in den New York Times die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager angesichts der Vielzahl an eingeleiteten Untersuchungen gegen amerikanische High-Tech-Unternehmen. So verhängte die Europäische Kommission im Juli 2018 eine Rekordstrafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar gegen den US-Konzern Google. Die Europäische Union ist dabei weltweit bekannt für die Durchsetzung ihres strikten Wettbewerbsrechts, wobei den Regelungen durch die gesteigerte Bedeutung multi- und transnationaler Großunternehmen eine noch wichtigere Rolle zukommt.
Trotz dieser zentralen Schlüsselrolle innerhalb der europäischen Wirtschaftspolitik ist die EU-Wettbewerbspolitik aus politikwissenschaftlicher Perspektive bislang nur selten Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Dabei ist gerade aus politikwissenschaftlicher Sicht der Bereich der Wettbewerbspolitik besonders relevant, zumal sich dort in den letzten Jahren ein gewisser Wandel weg von einer zunächst von ordnungspolitischen Vorstellungen geprägten Politik der Wettbewerbskontrolle hin zu einem marktliberaleren Modell abgezeichnet hat. Weiterhin kommt der Europäischen Kommission als oberste Kartellbehörde eine Kontrollfunktion auf dem europäischen Binnenmarkt zu, sie muss zudem als oberstes Exekutivorgan der EU auch deren gesamtwirtschaftliche Entwicklung im globalen Wettbewerb im Blick behalten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Der Wettbewerb als schützenswertes Gut einer Volkswirtschaft
- 3. Wettbewerbspolitische Leitbilder
- 3.1 Ordoliberalismus der Freiburger Schule
- 3.2 Harvard School – Konzept des funktionsfähigen Wettbewerbs
- 3.3 Chicago School
- 4. Grundlagen der europäischen Wettbewerbspolitik
- 4.1 Entwicklung der europäischen Wettbewerbspolitik
- 4.2 Instrumente der EU-Wettbewerbspolitik
- 4.3 Die zentralen Akteure der EU-Wettbewerbspolitik
- 5. Durchsetzung des Wettbewerbsrechts in der Europäischen Union
- 5.1 Das Netz der Kartellbehörden
- 5.2 Praktische Umsetzung des Wettbewerbsrechts
- 6. Aktuelle Entwicklungen des EU-Wettbewerbsrechts und Ausblick
- 6.1 Privatisierung des EU-Wettbewerbsrechts
- 6.2 Ökonomisierung der EU-Wettbewerbspolitik
- 6.3 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die EU-Wettbewerbspolitik als Politikfeld zwischen wirtschaftlichen und strukturpolitischen Erwägungen. Sie analysiert die Entwicklung, die Instrumente und Akteure der Politik sowie deren Durchsetzung. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Wandel der Wettbewerbspolitik von ordnungspolitischen hin zu marktliberaleren Modellen. Die Rolle der Europäischen Kommission als oberste Kartellbehörde wird ebenfalls beleuchtet.
- Bedeutung des Wettbewerbs für die europäische Volkswirtschaft
- Entwicklung und Grundlagen der EU-Wettbewerbspolitik
- Instrumente und Akteure der EU-Wettbewerbspolitik
- Durchsetzung des Wettbewerbsrechts in der EU
- Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen der EU-Wettbewerbspolitik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einführung beschreibt die wachsende internationale Bedeutung der EU-Wettbewerbspolitik, illustriert durch Beispiele von Strafzahlungen gegen US-amerikanische Tech-Konzerne. Sie hebt den Mangel an politikwissenschaftlicher Forschung zu diesem wichtigen, früh vergemeinschafteten Politikfeld hervor und betont den Wandel von ordnungspolitischen hin zu marktliberaleren Modellen. Die Arbeit fokussiert auf die Entwicklung der EU-Wettbewerbspolitik, die zentralen Akteure und deren Rolle.
2. Der Wettbewerb als schützenswertes Gut einer Volkswirtschaft: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung des Wettbewerbsgedankens in der Nachkriegs-Bundesrepublik Deutschland unter Ludwig Erhard und dem GWB. Es analysiert die ökonomischen und politikwissenschaftlichen Vorteile eines funktionierenden Wettbewerbs, wie z.B. Förderung von Unternehmertum, Effizienz, Produktauswahl, niedrige Preise und hohe Qualität. Die Gefahr wettbewerbsbeschränkenden Verhaltens von Unternehmen wird ebenfalls angesprochen, und die Wettbewerbspolitik als Teilbereich der staatlichen Ordnungspolitik, die die Funktionsfähigkeit der Märkte sichert, wird eingeführt. Die Herausforderungen des Idealmodells vollständiger Konkurrenz durch hohe Entwicklungskosten und Patentrechte werden im Kontext der wirtschaftlichen Realität diskutiert.
3. Wettbewerbspolitische Leitbilder: Dieses Kapitel untersucht verschiedene theoretische Leitbilder der Wettbewerbspolitik. Der Ordoliberalismus der Freiburger Schule, das Konzept des funktionsfähigen Wettbewerbs der Harvard School und die Chicago School werden jeweils dargestellt und verglichen. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen Ansätzen zur Gestaltung und Regulierung des Wettbewerbs und ihren jeweiligen Implikationen für die Politikgestaltung.
4. Grundlagen der europäischen Wettbewerbspolitik: Dieser Abschnitt befasst sich mit der Entwicklung, den Instrumenten und den Institutionen der EU-Wettbewerbspolitik. Die historische Entwicklung wird nachgezeichnet, die zentralen Instrumente zur Wettbewerbsregulierung erläutert und die Rolle der wichtigsten Akteure, insbesondere der Europäischen Kommission, beschrieben. Der Fokus liegt auf den institutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen der EU-Wettbewerbspolitik.
5. Durchsetzung des Wettbewerbsrechts in der Europäischen Union: In diesem Kapitel werden die Mechanismen der Durchsetzung des EU-Wettbewerbsrechts untersucht. Das Netzwerk der Kartellbehörden wird beschrieben, und die praktische Umsetzung des Wettbewerbsrechts wird detailliert dargestellt, einschließlich der Sanktionsmaßnahmen. Die Kapitel analysiert die Herausforderungen bei der Durchsetzung des Rechts in einem komplexen multinationalen Kontext.
Schlüsselwörter
EU-Wettbewerbspolitik, Wettbewerbsrecht, Ordoliberalismus, funktionierender Wettbewerb, Marktliberalismus, Europäische Kommission, Kartellbehörden, Wirtschaftsordnung, Ordnungspolitik, Marktwirtschaft, Monopol, Oligopol, Unternehmenskonzentration, Globalisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: EU-Wettbewerbspolitik
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die EU-Wettbewerbspolitik. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Glossar mit Schlüsselbegriffen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung, den Instrumenten, Akteuren und der Durchsetzung der EU-Wettbewerbspolitik, sowie dem Wandel von ordnungspolitischen hin zu marktliberaleren Modellen.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die Bedeutung des Wettbewerbs für die europäische Wirtschaft, die Entwicklung und Grundlagen der EU-Wettbewerbspolitik, die Instrumente und Akteure der Politik, die Durchsetzung des Wettbewerbsrechts in der EU und aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen. Es werden verschiedene wettbewerbspolitische Leitbilder wie Ordoliberalismus, funktionsfähiger Wettbewerb und die Chicago School verglichen. Die Rolle der Europäischen Kommission als oberste Kartellbehörde wird ebenfalls beleuchtet.
Welche wettbewerbspolitischen Leitbilder werden diskutiert?
Das Dokument vergleicht den Ordoliberalismus der Freiburger Schule, das Konzept des funktionsfähigen Wettbewerbs der Harvard School und die Chicago School. Der Schwerpunkt liegt auf den unterschiedlichen Ansätzen zur Gestaltung und Regulierung des Wettbewerbs und ihren Implikationen für die Politikgestaltung.
Wie wird die Durchsetzung des EU-Wettbewerbsrechts beschrieben?
Das Dokument beschreibt das Netzwerk der Kartellbehörden und die praktische Umsetzung des Wettbewerbsrechts, einschließlich der Sanktionsmaßnahmen. Es analysiert die Herausforderungen bei der Durchsetzung des Rechts in einem komplexen multinationalen Kontext, inklusive der "Privatisierung" des Wettbewerbsrechts und der "Ökonomisierung" der Wettbewerbspolitik.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Dokument verwendet?
Schlüsselbegriffe umfassen EU-Wettbewerbspolitik, Wettbewerbsrecht, Ordoliberalismus, funktionierender Wettbewerb, Marktliberalismus, Europäische Kommission, Kartellbehörden, Wirtschaftsordnung, Ordnungspolitik, Marktwirtschaft, Monopol, Oligopol, Unternehmenskonzentration und Globalisierung.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument umfasst Kapitel zur Einführung, dem Wettbewerb als schützenswertes Gut, wettbewerbspolitischen Leitbildern, den Grundlagen der europäischen Wettbewerbspolitik, der Durchsetzung des Wettbewerbsrechts in der EU und aktuellen Entwicklungen mit Ausblick.
Welche Rolle spielt die Europäische Kommission?
Die Europäische Kommission spielt als oberste Kartellbehörde eine zentrale Rolle bei der Durchsetzung der EU-Wettbewerbspolitik. Ihre Rolle und Bedeutung werden im Dokument ausführlich behandelt.
Wie hat sich die EU-Wettbewerbspolitik entwickelt?
Das Dokument beschreibt die historische Entwicklung der EU-Wettbewerbspolitik, beginnend mit dem Entstehen des Wettbewerbsgedankens in der Nachkriegszeit und dem GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen), bis hin zu aktuellen Herausforderungen wie Globalisierung und Digitalisierung. Es zeigt einen Wandel von ordnungspolitischen hin zu marktliberaleren Modellen auf.
- Quote paper
- Jonathan Loos (Author), 2018, Die EU-Wettbewerbspolitik. Ein Politikfeld zwischen wirtschaftlichen und strukturpolitischen Erwägungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/471299