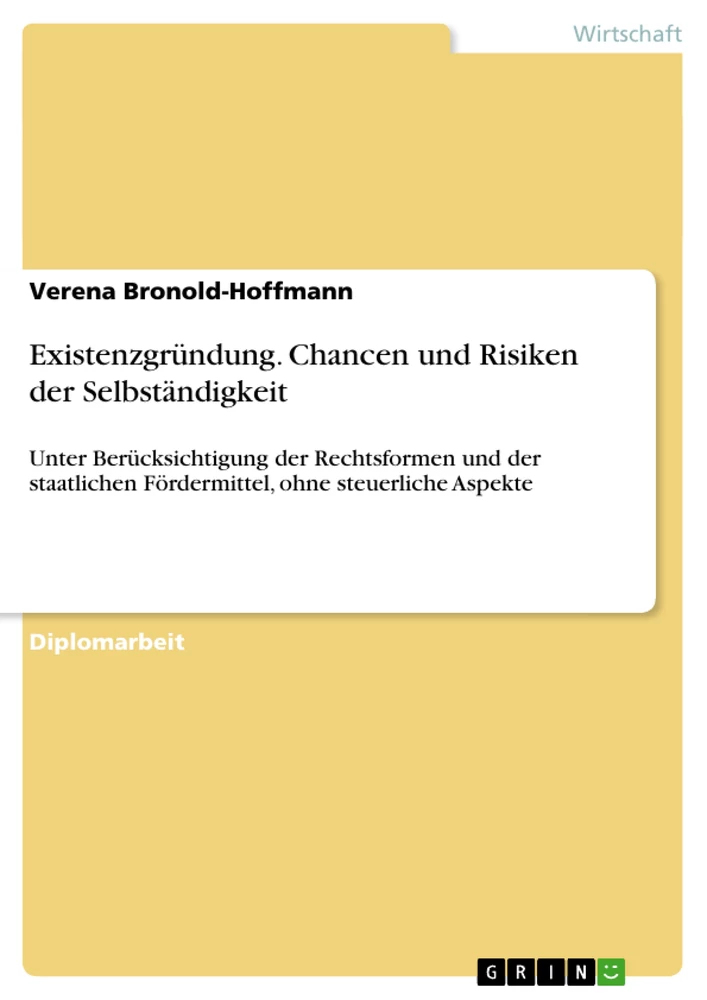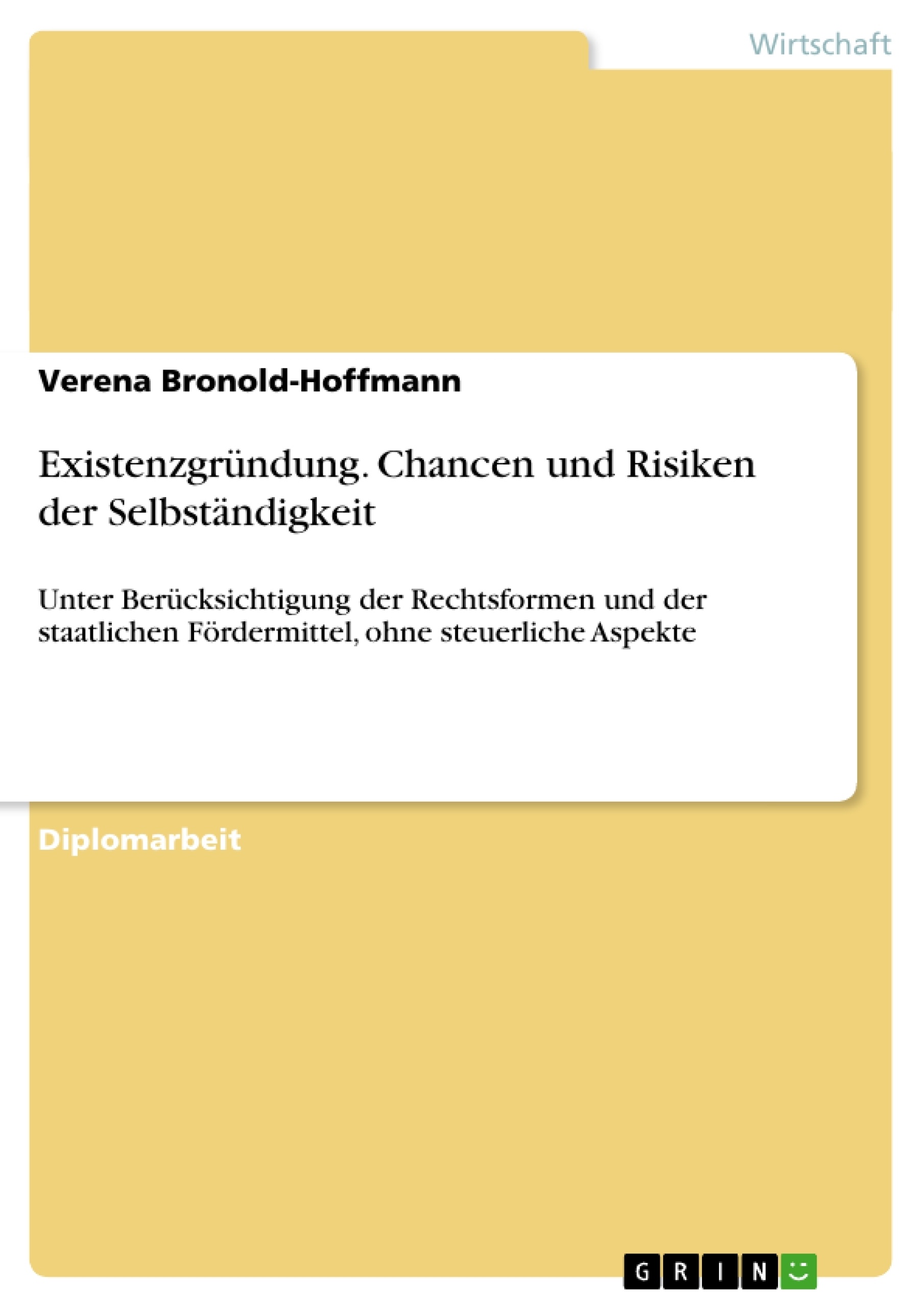Im Jahr 2003 wurden in Deutschland 810.706 Gewerbebetriebe angemeldet, wobei 678.439 der Gewerbetreibenden angaben, einen Betrieb neu gründen zu wollen. Darunter befanden sich 164.885 Betriebe mit größerer wirtschaftlicher Substanz und 513.554 Kleinunternehmen oder Nebenerwerbsbetriebe. Den Gewerbeanmeldungen standen 516.067 Betriebe gegenüber, die ihr Gewerbe 2003 völlig aufgaben.
Die Gesamtzahl der Gewerbeanmeldungen, die seit 1998 stetig zurückgegangen ist, hat sich im Jahre 2003 um 12,1 % gegenüber dem Vorjahr 2002 erhöht. Die Erhöhung der Gewerbeanmeldungen ergibt sich vorwiegend aus der Zunahme von Gründungen von Kleinunternehmen, wie z.B. Ich-AG´s und Nebenerwerbsbetrieben. Nach Schätzungen für das 1. Halbjahr 2004 stiegen die Gewerbeanmeldungen gegenüber dem 1. Halbjahr 2003 um 16,3 %.
Wie sich am Trend der Statistik von Existenzneugründungen erkennen lässt, bleibt diese Anzahl verhältnismäßig hoch. Zündende Geschäftsideen müssen also vorhanden sein, trotz pessimistischer Stimmungs- und Wirtschaftslage in Deutschland. Ob diese Neugründungen von Erfolg gekrönt sein werden, oder wie lange sie existieren, dazu liegen noch keine Erfahrungswerte vor.
Eine Existenzgründung ist vor allem dann erfolgreich, wenn sie wohlüberlegt und sorgfältig geplant wird. Planen bedeutet, künftige Ereignisse gedanklich vorwegzunehmen, somit ist Planung ein Vorgang, der hohe Anforderungen an die Vorstellungskraft stellt.
Deshalb sollten alle Gedanken schriftlich niedergelegt werden. Dafür eignen sich besonders Checklisten (Beispiel einer Checkliste, siehe Anlage I), in denen auftretende Probleme systematisch abgearbeitet oder noch einmal überdacht werden können.
In jeder Phase der Existenzgründung wie der Orientierungsphase, der Planungsphase und der Realisierungsphase sollten solche Überprüfungen durchgeführt werden. Eine Existenzgründung ist somit ein kontinuierlich zu überprüfender Prozess. Entscheidungen müssen deshalb permanent auf persönliche Anforderungen - wie z.B. Finanzierung und/oder Kapitalbegrenzung -und äußere Bedingungen - wie z.B. Kundenverhalten - kontrolliert werden. Dies sollte auch geschehen, wenn eine Existenzgründung erfolgreich war und sich am Markt etabliert hat.
Nur 5 Prozent aller Existenzgründungsideen in Deutschland sind wirklich neu, erfolgreiche Gründer sind in der Regel nicht Erfinder, sondern Innovateure. Es wird auf Existierendes zurück gegriffen, bereits Vorhandenes wird neu entdeckt.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- 1. Einleitung
- 2. Voraussetzungen an den Gründer für eine Existenzgründung
- 2.1 Persönliche Voraussetzungen
- 2.2 Unternehmerische Voraussetzungen
- 3. Chancen und Risiken der Selbständigkeit
- 3.1 Chancen der Selbständigkeit
- 3.2 Risiken der Selbständigkeit
- 3.2.1 Rechtsbeziehungen im Innen- und Außenverhältnis
- 3.2.2 Finanzplanung
- 3.2.3 Absicherung der Existenz
- 4. Wahl der Rechtsform
- 4.1 Einzelunternehmen
- 4.2 Personengesellschaften
- 4.3 Kapitalgesellschaften
- 5. Staatliche Förderung
- 5.1 Allgemeine staatliche Fördermittel
- 5.2 Spezifische Fördermittel für innovative Geschäftsideen
- 5.3 Spezifische Fördermittel, bezogen auf die Situation des Gründers
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Chancen und Risiken der Selbständigkeit in Deutschland. Sie beleuchtet die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Existenzgründung, berücksichtigt dabei verschiedene Rechtsformen und die Möglichkeiten staatlicher Fördermittel. Steuerliche Aspekte werden hingegen ausgeklammert.
- Voraussetzungen für eine erfolgreiche Existenzgründung (persönliche und unternehmerische Fähigkeiten)
- Chancen und Risiken der Selbständigkeit (persönliche Lebensumstände, wirtschaftspolitische Lage, finanzielle Aspekte)
- Die Wahl der geeigneten Rechtsform (Einzelunternehmen, Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften)
- Möglichkeiten der staatlichen Förderung von Existenzgründungen
- Zusammenfassende Betrachtung der wichtigsten Aspekte
Zusammenfassung der Kapitel
Vorbemerkung: Diese Vorbemerkung dient der Einleitung und liefert möglicherweise kontextuelle Informationen zur Arbeit, jedoch keinen eigentlichen inhaltlichen Beitrag, der zusammengefasst werden müsste.
1. Einleitung: Das einleitende Kapitel führt in das Thema Existenzgründung ein und skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit. Es liefert den konzeptionellen Rahmen für die folgenden Kapitel.
2. Voraussetzungen an den Gründer für eine Existenzgründung: Dieses Kapitel analysiert die notwendigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Selbständigkeit. Es differenziert zwischen persönlichen Voraussetzungen (seelische, geistige und körperliche Fitness sowie familiäre/partnerschaftliche Unterstützung) und unternehmerischen Voraussetzungen (fachliche Fertigkeiten, kaufmännische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse). Es betont die Interdependenz dieser Faktoren für den Gründungserfolg.
3. Chancen und Risiken der Selbständigkeit: Dieses zentrale Kapitel beleuchtet die Chancen und Risiken der Selbständigkeit umfassend. Die Chancen umfassen verbesserte persönliche Lebensumstände und die Ausnutzung wirtschaftspolitischer Gegebenheiten. Die Risiken werden in Rechtsbeziehungen (Innen- und Außenverhältnis), Finanzplanung (Mittel- und Finanzierungsplanung) und der Absicherung der Existenz (persönlich und betrieblich) unterteilt. Es wird eine Abwägung der Chancen und Risiken vorgenommen, um ein realistisches Bild der Selbständigkeit zu vermitteln.
4. Wahl der Rechtsform: Dieses Kapitel befasst sich mit der Auswahl der geeigneten Rechtsform für ein Unternehmen. Es werden Einzelunternehmen, Personengesellschaften (GbR, PartG, OHG, KG, GmbH & Co. KG) und Kapitalgesellschaften (GmbH, kleine Aktiengesellschaft) detailliert beschrieben und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile hinsichtlich Haftung, Steuerbelastung und Kapitalbeschaffung analysiert. Die Auswahlkriterien werden im Kontext der individuellen Gründersituation diskutiert.
5. Staatliche Förderung: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene staatliche Förderprogramme für Existenzgründer. Es differenziert zwischen allgemeinen Fördermitteln und spezifischen Programmen für innovative Geschäftsideen sowie Förderungen, die sich an die jeweilige Situation des Gründers (z.B. Hochschulabsolvent, Freiberufler, Arbeitsloser) richten. Die Bedingungen und Möglichkeiten der Inanspruchnahme dieser Fördermittel werden detailliert erläutert.
Schlüsselwörter
Existenzgründung, Selbständigkeit, Chancen, Risiken, Rechtsformen, staatliche Fördermittel, Unternehmerische Voraussetzungen, Persönliche Voraussetzungen, Finanzplanung, Absicherung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Chancen und Risiken der Selbständigkeit in Deutschland
Was ist der Inhalt dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit analysiert umfassend die Chancen und Risiken der Selbständigkeit in Deutschland. Sie beleuchtet die notwendigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Existenzgründung, untersucht verschiedene Rechtsformen und die Möglichkeiten staatlicher Fördermittel. Steuerliche Aspekte werden jedoch nicht behandelt.
Welche Themen werden in der Diplomarbeit behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: Voraussetzungen für eine erfolgreiche Existenzgründung (persönliche und unternehmerische Fähigkeiten), Chancen und Risiken der Selbständigkeit (persönliche Lebensumstände, wirtschaftspolitische Lage, finanzielle Aspekte), Wahl der geeigneten Rechtsform (Einzelunternehmen, Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften), Möglichkeiten der staatlichen Förderung von Existenzgründungen und eine zusammenfassende Betrachtung der wichtigsten Aspekte.
Welche Voraussetzungen werden für eine erfolgreiche Existenzgründung genannt?
Die Arbeit differenziert zwischen persönlichen Voraussetzungen (seelische, geistige und körperliche Fitness, familiäre/partnerschaftliche Unterstützung) und unternehmerischen Voraussetzungen (fachliche Fertigkeiten, kaufmännische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse). Die Interdependenz dieser Faktoren für den Gründungserfolg wird betont.
Welche Chancen und Risiken der Selbständigkeit werden beleuchtet?
Die Chancen umfassen verbesserte persönliche Lebensumstände und die Ausnutzung wirtschaftspolitischer Gegebenheiten. Die Risiken werden in Rechtsbeziehungen (Innen- und Außenverhältnis), Finanzplanung (Mittel- und Finanzierungsplanung) und der Absicherung der Existenz (persönlich und betrieblich) unterteilt. Es wird eine Abwägung der Chancen und Risiken vorgenommen.
Welche Rechtsformen werden betrachtet?
Die Arbeit beschreibt detailliert Einzelunternehmen, Personengesellschaften (GbR, PartG, OHG, KG, GmbH & Co. KG) und Kapitalgesellschaften (GmbH, kleine Aktiengesellschaft) und analysiert ihre Vor- und Nachteile hinsichtlich Haftung, Steuerbelastung und Kapitalbeschaffung. Die Auswahlkriterien werden im Kontext der individuellen Gründersituation diskutiert.
Welche Arten staatlicher Fördermittel werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt allgemeine Fördermittel und spezifische Programme für innovative Geschäftsideen sowie Förderungen, die sich an die jeweilige Situation des Gründers (z.B. Hochschulabsolvent, Freiberufler, Arbeitsloser) richten. Die Bedingungen und Möglichkeiten der Inanspruchnahme dieser Fördermittel werden detailliert erläutert.
Wie ist die Diplomarbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Vorbemerkung, Einleitung, Kapitel zu den Voraussetzungen für die Existenzgründung, Chancen und Risiken der Selbständigkeit, Wahl der Rechtsform, staatliche Förderung und eine Zusammenfassung. Die Vorbemerkung liefert kontextuelle Informationen, die Einleitung skizziert Aufbau und Zielsetzung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Diplomarbeit?
Schlüsselwörter sind: Existenzgründung, Selbständigkeit, Chancen, Risiken, Rechtsformen, staatliche Fördermittel, unternehmerische Voraussetzungen, persönliche Voraussetzungen, Finanzplanung und Absicherung.
- Quote paper
- Dipl.-Betriebswirtin (FH) Verena Bronold-Hoffmann (Author), 2005, Existenzgründung. Chancen und Risiken der Selbständigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/46938