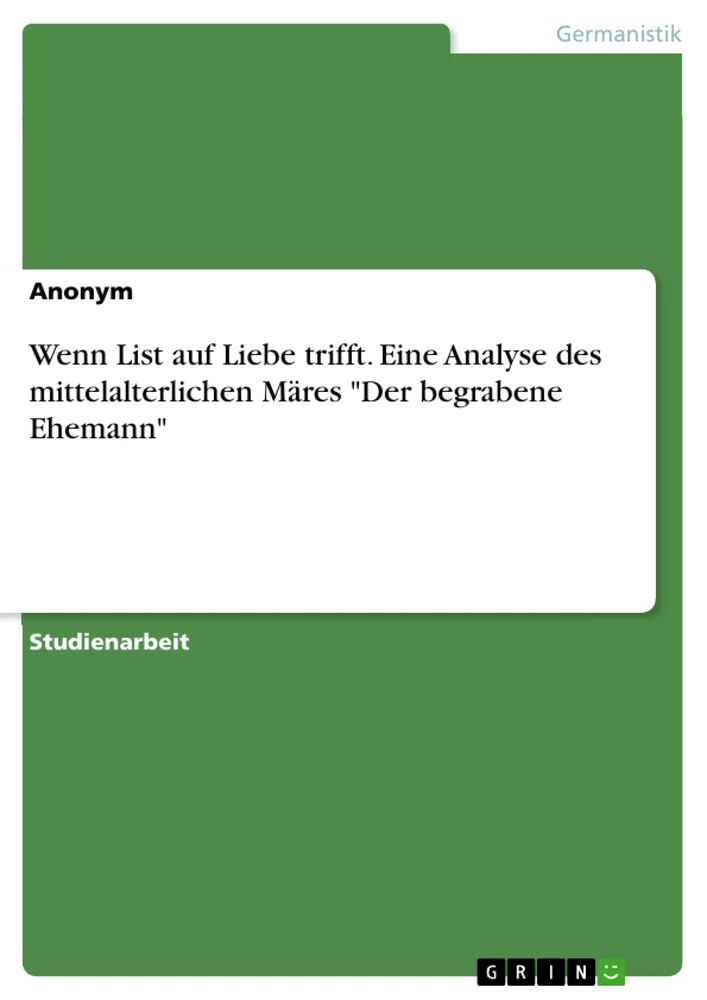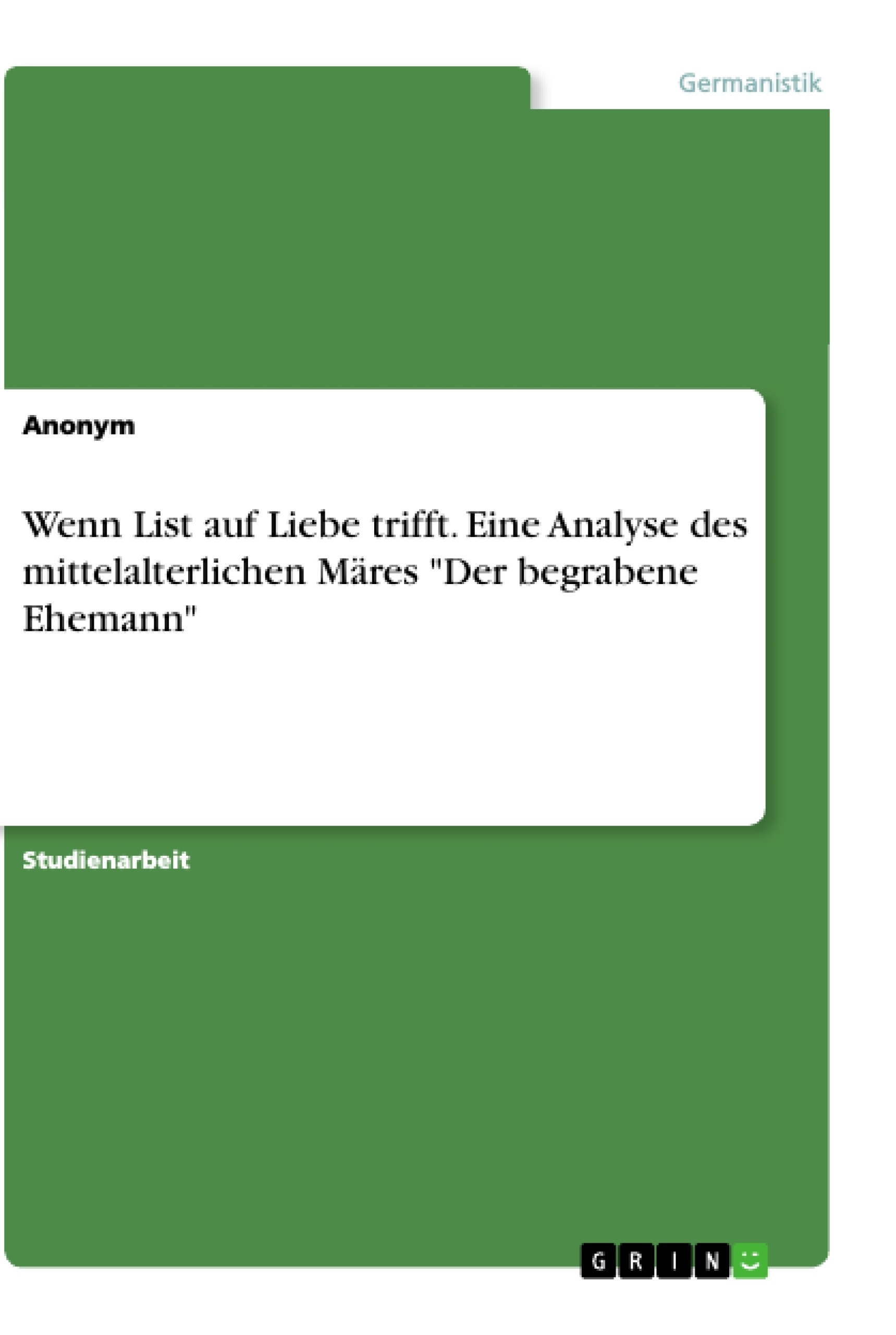Die nachfolgende Arbeit befasst sich mit der im mittelalterlichen Mär "Der begrabene Ehemann" geschilderten List und versucht gleichzeitig, die Entstehungsgeschichte des Begriffes der "List" sprachhistorisch zu beleuchten.
Gewalt ist für die Ehestandsmären vom Stricker ein allgegenwärtiges Thema. Es gibtzweifellos starke inhaltliche Parallelen zu anderen Mären, wie Kaufringers "Drei listigeFrauen", jedoch nimmt "Der begrabene Ehemann" im Hinblick auf die Drastik der Bestrafung - das lebendige Begraben - eine Sonderstellung ein. Ein drastisch klingendes Epimythion vollendet die ohnehin schon herzlos erscheinende Geschichte und ist aus diesem Grund lohnenswert näher zu betrachten.
Ziel der Hausarbeit ist es deshalb, das Gelingen der List näher zu untersuchen und zu klären, unter welchen Voraussetzungen eine solche überhaupt nur möglich ist. Dazu findet zunächst eine sprachhistorische Untersuchung des Begriffes statt. Des Weiteren wird die Entstehungsgeschichte des Märes kurz skizziert, um aufzuzeigen welches breite Spektrum der Nachlass vom Stricker darstellt und welche Werte für ihn von elementarer Bedeutung sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sprachhistorische Betrachtung der list
- Entstehungsgeschichte
- Analyse Der begrabene Ehemann
- Exposition
- Die Proben
- Epimythion
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Gelingen der List in Strickers Märe "Der begrabene Ehemann". Ziel ist es, die Voraussetzungen für das Gelingen einer solchen List zu klären und den Begriff "List" sprachhistorisch zu betrachten. Die Entstehungsgeschichte des Märes wird kurz skizziert, um den Kontext des Werkes zu beleuchten.
- Sprachliche Entwicklung des Begriffs "List"
- Entstehungsgeschichte und Kontext des Märes
- Analyse der "Minneproben" im Märe
- Das "Epimythion" als Kommentar zur Geschichte
- Konflikte zwischen gesellschaftlichen Werten und dem Handeln der Figuren
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt "Der begrabene Ehemann" als Sonderfall innerhalb der Ehestandsmären Strickers aufgrund der drastischen Bestrafung dar. Das Ziel der Arbeit ist die Untersuchung des List-Gelingens und der dafür notwendigen Voraussetzungen. Es wird eine sprachhistorische Betrachtung der "List" sowie eine kurze Skizzierung der Entstehungsgeschichte des Märes angekündigt.
Sprachhistorische Betrachtung list: Dieses Kapitel untersucht die semantische Entwicklung des Wortes "List" vom Mittelhochdeutschen zur Neuzeit. Es wird aufgezeigt, dass die Bedeutung im Mittelhochdeutschen im Gegensatz zur heutigen, eher negativ konnotierten Verwendung, positive Konnotationen aufweist, wie Weisheit und Klugheit. Dieser Unterschied ist essentiell für das Verständnis der Handlung im Märe.
Entstehungsgeschichte: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehungsgeschichte des Märes und den Autor Stricker, wobei die Unsicherheit über biografische Details hervorgehoben wird. Die Vielseitigkeit des Strickerschen Werkes und seine ambivalente Erzählerhaltung werden diskutiert, wobei der Aspekt des Spiels mit dem Rezipienten und die Infragestellung gesellschaftlicher Werte im Fokus steht.
Analyse Der begrabene Ehemann: Die Analyse des Märes gliedert sich in Exposition, Proben und Epimythion. Die Analyse beschreibt die Handlung: Die Frau fordert von ihrem Mann bedingungslosen Gehorsam. Er scheitert an mehreren "Minneproben", was zu einer Affäre der Frau mit einem Pfaffen führt. Der Höhepunkt ist die List der Frau, die ihren Mann für tot erklärt und begraben lässt. Der Text analysiert die Rolle von Begriffen wie "huld", "triuwe" und "stæte" und die unterschiedlichen Interpretationen des List-Gelingens in der Forschung.
Schlüsselwörter
Mittelhochdeutsche Literatur, Stricker, Der begrabene Ehemann, List, Minne, Ehestandsmäre, Sprachgeschichte, mittelalterliche Gesellschaft, Huld, Triuwe, Stæte, performativer Vollzug, Realitätsverlust.
Häufig gestellte Fragen zu Strickers "Der begrabene Ehemann"
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit analysiert das Gelingen der List in Strickers Märe "Der begrabene Ehemann". Sie untersucht die Voraussetzungen für das Gelingen der List und beleuchtet den Begriff "List" aus sprachhistorischer Perspektive. Zusätzlich wird die Entstehungsgeschichte des Märes skizziert, um den Kontext des Werkes zu verstehen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die sprachliche Entwicklung des Begriffs "List", die Entstehungsgeschichte und den Kontext des Märes, die Analyse der "Minneproben" im Märe, das "Epimythion" als Kommentar zur Geschichte und die Konflikte zwischen gesellschaftlichen Werten und dem Handeln der Figuren.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, eine sprachhistorische Betrachtung des Begriffs "List", ein Kapitel zur Entstehungsgeschichte des Märes und eine detaillierte Analyse von "Der begrabene Ehemann", unterteilt in Exposition, Proben und Epimythion. Sie schließt mit einem Fazit ab.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung stellt "Der begrabene Ehemann" als Sonderfall unter Strickers Ehestandsmären vor, aufgrund der drastischen Bestrafung. Sie definiert das Ziel der Arbeit – die Untersuchung des List-Gelingens – und kündigt die sprachhistorische Betrachtung der "List" sowie eine kurze Skizzierung der Entstehungsgeschichte an.
Wie wird die "List" sprachhistorisch betrachtet?
Das Kapitel zur sprachhistorischen Betrachtung untersucht die semantische Entwicklung des Wortes "List" vom Mittelhochdeutschen bis zur Neuzeit. Es zeigt auf, dass die Bedeutung im Mittelhochdeutschen im Gegensatz zur heutigen, eher negativ konnotierten Verwendung, positive Konnotationen wie Weisheit und Klugheit aufweist. Dieser Unterschied ist essentiell für das Verständnis der Handlung.
Was wird in der Entstehungsgeschichte behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehungsgeschichte des Märes und den Autor Stricker, wobei die Unsicherheit über biografische Details hervorgehoben wird. Die Vielseitigkeit des Strickerschen Werkes und seine ambivalente Erzählerhaltung werden diskutiert, mit Fokus auf das Spiel mit dem Rezipienten und die Infragestellung gesellschaftlicher Werte.
Wie wird "Der begrabene Ehemann" analysiert?
Die Analyse des Märes gliedert sich in Exposition, Proben und Epimythion. Sie beschreibt die Handlung, die Rolle von Begriffen wie "huld", "triuwe" und "stæte", und die unterschiedlichen Interpretationen des List-Gelingens in der Forschung. Die Frau fordert bedingungslosen Gehorsam, der Mann scheitert an "Minneproben", was zu einer Affäre führt. Die List besteht darin, den Mann für tot erklären und begraben zu lassen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mittelhochdeutsche Literatur, Stricker, Der begrabene Ehemann, List, Minne, Ehestandsmäre, Sprachgeschichte, mittelalterliche Gesellschaft, Huld, Triuwe, Stæte, performativer Vollzug, Realitätsverlust.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Wenn List auf Liebe trifft. Eine Analyse des mittelalterlichen Märes "Der begrabene Ehemann", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/468697