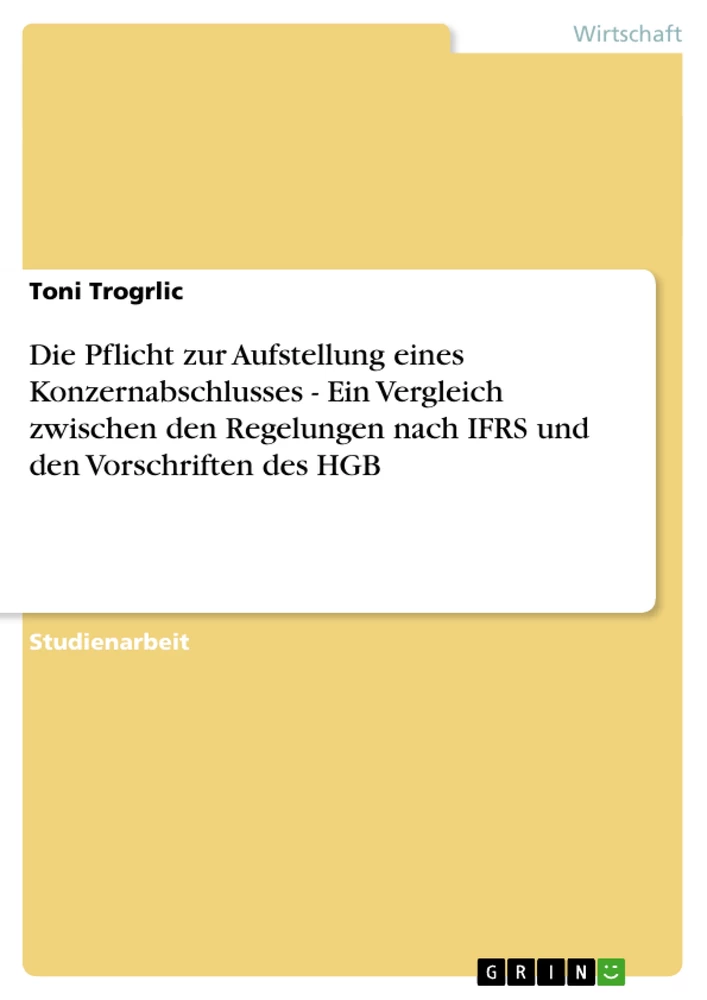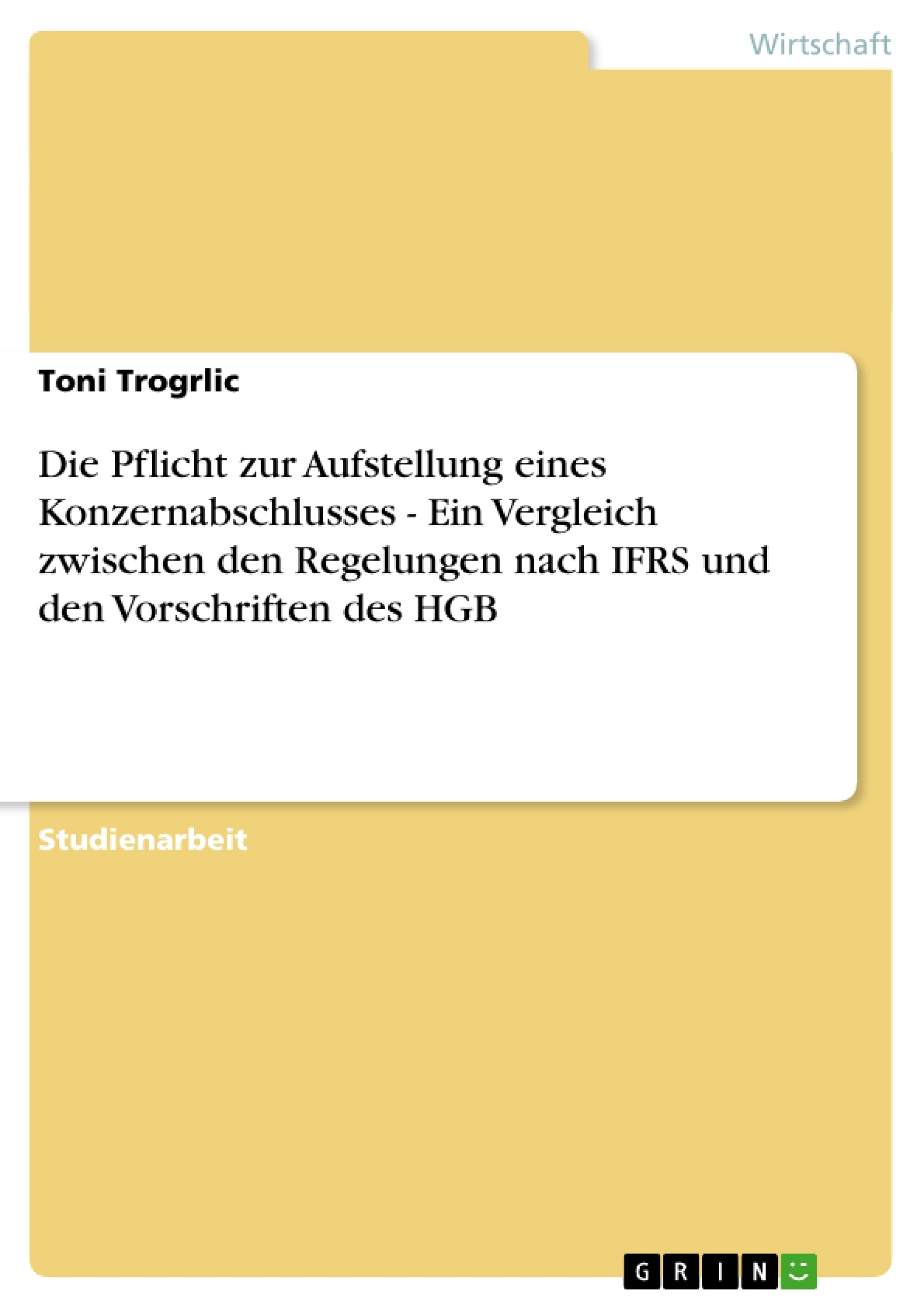Nach der EU-Verordnung vom Juni 2002 sind kapitalmarktorientierte europäische Unternehmen (einschließlich Banken und Versicherungen) verpflichtet, für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.1.2005 beginnen, ihre Konzernabschlüsse nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) aufzustellen. Somit treten in Deutschland die IFRS die Nachfolge der 2004 auslaufenden
Konzernabschlussregeln nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) an.
Nach Schätzungen sind in Deutschland von dieser Umstellung etwa 750 Unternehmen, EU-weit ca. 7000 Unternehmen betroffen. Die Mitgliedstaaten haben darüber hinaus noch das Recht, die Anwendung der IFRS auch auf Konzernabschlüsse nicht kapitalmarktorientierter Unternehmen sowie auf sämtliche Einzelabschlüsse auszuweiten.
In dieser Hausarbeit möchte ich die unterschiedlichen Möglichkeiten untersuchen, die zu einer Aufstellungspflicht eines Konzernabschlusses nach HGB und IFRS führen.
In Kapitel zwei werden zuerst der Begriff und die wesentlichen Bedeutungen des Konzerns herausgearbeitet. In dem nachfolgenden Kapitel drei widme ich meine Aufmerksamkeit dem Zweck und den Grundlagen des Konzernabschlusses. In den Kapiteln vier und fünf wird einerseits ein detaillierter Vergleich zwischen den Rechnungslegungsvorschriften nach HGB und IFRS zur Aufstellungspflicht eines Konzernabschlusses dargestellt und
andererseits werden auch einige Befreiungsmöglichten aufgezeigt. Der letzte Abschnitt dieser Arbeit enthält eine zusammenfassende Schlussbetrachtung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriff und Bedeutung des Konzerns
- 3. Zweck und Grundlagen des Konzernabschlusses
- 4. Die Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses
- 4.1. Aufstellungspflicht nach HGB
- 4.2. Aufstellungspflicht nach IFRS
- 5. Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses
- 5.1. Befreiung nach HGB
- 5.2. Befreiung nach IFRS
- 6. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Unterschiede in der Aufstellungspflicht von Konzernabschlüssen nach den Regelungen des Handelsgesetzbuchs (HGB) und den International Financial Reporting Standards (IFRS). Das Ziel ist ein detaillierter Vergleich beider Regelwerke.
- Definition und Bedeutung des Konzerns
- Zweck und Grundlagen des Konzernabschlusses
- Aufstellungspflicht nach HGB und IFRS
- Möglichkeiten der Befreiung von der Aufstellungspflicht
- Vergleich der Regelungen nach HGB und IFRS
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert den Hintergrund der Hausarbeit. Sie beschreibt die Bedeutung der Umstellung von HGB- auf IFRS-Konzernabschlüsse in Europa und in Deutschland, wobei die Anzahl der betroffenen Unternehmen genannt wird. Die Arbeit kündigt die Struktur der folgenden Kapitel an, in denen der Begriff des Konzerns, der Zweck des Konzernabschlusses, die Aufstellungspflicht nach HGB und IFRS sowie Befreiungsmöglichkeiten behandelt werden. Die Einleitung legt den Fokus auf den Vergleich der beiden Regelwerke und betont die unterschiedlichen Möglichkeiten, die zu einer Aufstellungspflicht führen.
2. Begriff und Bedeutung des Konzerns: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Konzerns als eine Verbindung mehrerer rechtlich selbstständiger, aber wirtschaftlich abhängiger Unternehmen. Es wird auf die einheitliche Leitung durch ein herrschendes Unternehmen hingewiesen, wie in § 18 AktG geregelt. Die Ziele der Konzernbildung (Marktmacht, Sicherung der strategischen Position) werden ebenso angesprochen wie die Konsequenzen für konzernfremde Minderheitsgesellschafter, Gläubiger und Arbeitnehmer aufgrund der Ausrichtung der Unternehmensentscheidungen am Gesamtinteresse des Konzerns. Das Kapitel verweist auf die Regulierung des Konzernrechts im AktG.
3. Zweck und Grundlagen des Konzernabschlusses: Dieses Kapitel beschreibt den Konzernabschluss als Dokumentations- und Entscheidungsinstrument, das ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt. Es werden die externen Berichtsempfänger (Anteilseigner, Gläubiger, Arbeitnehmer, Öffentlichkeit) genannt. Das Kapitel erläutert die Bedeutung von Konzernbilanztheorien, insbesondere die Einheitstheorie (entity theory) und die Interessentheorie (parent company theory). Die Einheitstheorie behandelt alle Beteiligten als gleichgestellt, während die Interessentheorie den Konzernabschluss als erweiterten Abschluss des Mutterunternehmens betrachtet.
Schlüsselwörter
Konzernabschluss, IFRS, HGB, Aufstellungspflicht, Befreiung, Konzern, Rechnungslegung, Vergleich, Mutterunternehmen, Tochterunternehmen, Konzernrecht, Einheitstheorie, Interessentheorie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Konzernabschlüsse nach HGB und IFRS
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit vergleicht die Aufstellungspflicht von Konzernabschlüssen nach den Regeln des Handelsgesetzbuchs (HGB) und den International Financial Reporting Standards (IFRS). Sie untersucht detailliert die Unterschiede beider Regelwerke.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Bedeutung des Konzerns, den Zweck und die Grundlagen des Konzernabschlusses, die Aufstellungspflicht nach HGB und IFRS, die Möglichkeiten der Befreiung von der Aufstellungspflicht und einen detaillierten Vergleich der Regelungen nach HGB und IFRS.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Begriff und Bedeutung des Konzerns, Zweck und Grundlagen des Konzernabschlusses, Die Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses (inkl. Unterkapiteln zu HGB und IFRS), Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses (inkl. Unterkapiteln zu HGB und IFRS) und Schlussbetrachtung.
Was wird in der Einleitung der Hausarbeit erläutert?
Die Einleitung führt in die Thematik ein, erläutert den Hintergrund der Arbeit, beschreibt die Bedeutung der Umstellung von HGB- auf IFRS-Konzernabschlüsse und kündigt die Struktur der folgenden Kapitel an. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der beiden Regelwerke und den unterschiedlichen Möglichkeiten, die zu einer Aufstellungspflicht führen.
Wie definiert die Hausarbeit den Begriff „Konzern“?
Die Hausarbeit definiert den Konzern als eine Verbindung mehrerer rechtlich selbstständiger, aber wirtschaftlich abhängiger Unternehmen unter einheitlicher Leitung eines herrschenden Unternehmens (gemäß § 18 AktG). Es werden die Ziele der Konzernbildung und die Konsequenzen für konzernfremde Minderheitsgesellschafter, Gläubiger und Arbeitnehmer angesprochen.
Welchen Zweck hat der Konzernabschluss laut der Hausarbeit?
Der Konzernabschluss dient als Dokumentations- und Entscheidungsinstrument, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln. Die externen Berichtsempfänger (Anteilseigner, Gläubiger, Arbeitnehmer, Öffentlichkeit) werden genannt. Die Bedeutung von Konzernbilanztheorien (Einheitstheorie und Interessentheorie) wird erläutert.
Welche Konzernbilanztheorien werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Hausarbeit behandelt die Einheitstheorie (entity theory), die alle Beteiligten als gleichgestellt betrachtet, und die Interessentheorie (parent company theory), die den Konzernabschluss als erweiterten Abschluss des Mutterunternehmens sieht.
Welche Schlüsselwörter sind für die Hausarbeit relevant?
Schlüsselwörter sind: Konzernabschluss, IFRS, HGB, Aufstellungspflicht, Befreiung, Konzern, Rechnungslegung, Vergleich, Mutterunternehmen, Tochterunternehmen, Konzernrecht, Einheitstheorie, Interessentheorie.
- Quote paper
- Toni Trogrlic (Author), 2004, Die Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses - Ein Vergleich zwischen den Regelungen nach IFRS und den Vorschriften des HGB, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/46585