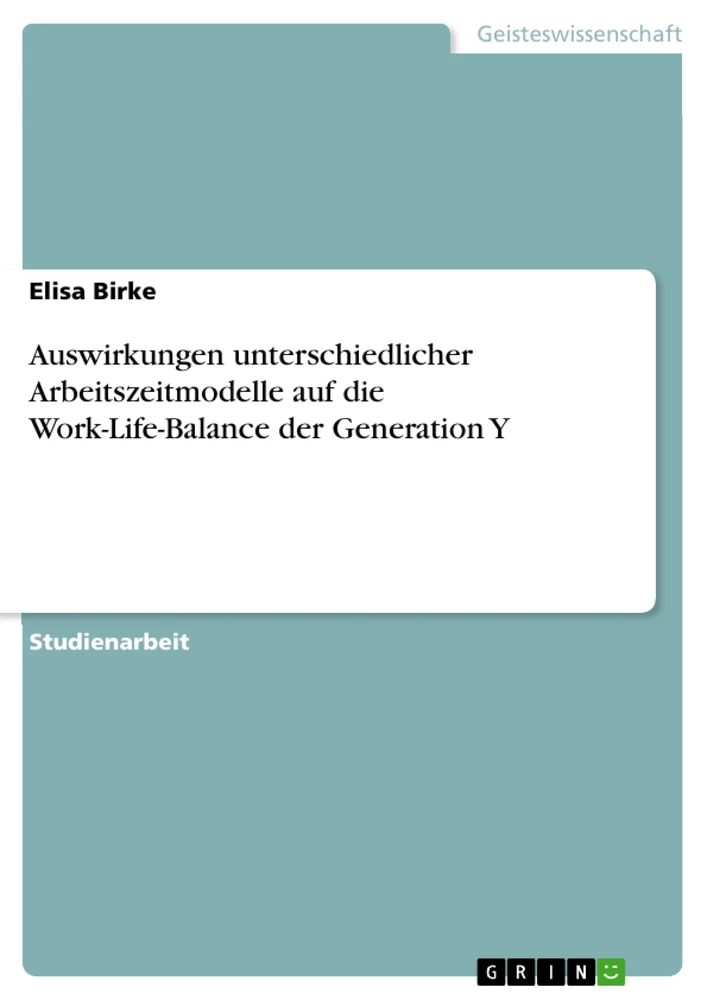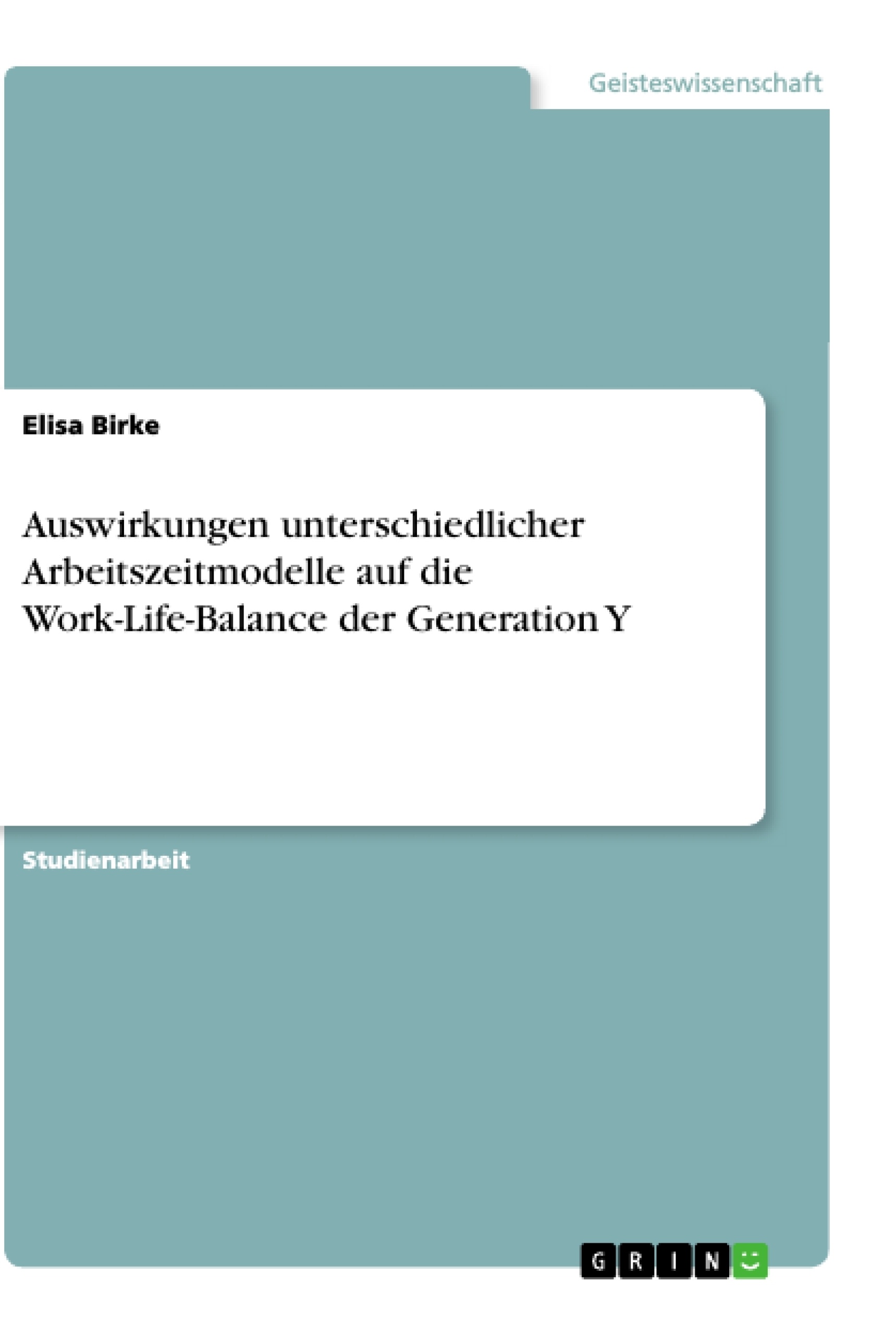Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Einfluss verschiedener Arbeitszeitmodelle auf die Problematik der Work-Life-Balance der Generation Y mittels qualitativer Forschungsansätze. Dazu werden zunächst die zentralen Begriffe, also Arbeitszeitmodelle, Work-Life-Balance und Generation Y erläutert.
Im weiteren Verlauf werden im Rahmen der qualitativen Forschungsmethoden zwei narrative Interviews geführt, um das Thema der Seminararbeit näher zu beleuchten. Dazu werden zwei Personen der Generation Y ausgewählt, deren berufliche Tätigkeiten in unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen organisiert sind. Sie werden zu Erfahrungen mit ihren Arbeitszeitmodellen und der damit verbunden Work-Life-Balance interviewt. Ziel dieser Befragungen ist es, das persönliche Empfinden der Befragten zur Work-Life-Balance zu untersuchen. Außerdem sollen anhand dieser Erfahrungen, allgemein gültige Aussagen zu priorisierten Arbeitsverhältnissen der Generation Y aufgestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Arbeitszeitmodelle, Work-Life-Balance und Generation Y
- 2.1 Arbeitszeitmodelle
- 2.2 Work-Life-Balance
- 2.3 Generation Y
- 3 Methodik
- 3.1 Grundlegendes und Induktion
- 3.2 Gütekriterien qualitativer Forschung
- 3.3 Form
- 3.4 Fragebogen
- 3.5 Setting
- 3.6 Interviewpartner
- 3.7 Durchführung der Interviews
- 3.8 Evaluation der Methode
- 4 Thematische Ergebnisse
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert den Einfluss verschiedener Arbeitszeitmodelle auf die Work-Life-Balance der Generation Y. Sie untersucht, wie verschiedene Arbeitszeitmodelle die Bedürfnisse und Erwartungen dieser Altersgruppe im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben erfüllen.
- Die Relevanz der Work-Life-Balance für die Generation Y
- Die Auswirkungen von Gleitzeitmodellen auf die Work-Life-Balance der Generation Y
- Die Auswirkungen von Vertrauensarbeitszeitmodellen auf die Work-Life-Balance der Generation Y
- Die Rolle der Selbststeuerung und Selbstorganisation in der Arbeitswelt der Generation Y
- Die Herausforderungen und Chancen der Work-Life-Balance für die Generation Y im Kontext verschiedener Arbeitszeitmodelle
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in das Thema der Seminararbeit und stellt die Relevanz der Work-Life-Balance für die Generation Y dar.
- Kapitel 2: Arbeitszeitmodelle, Work-Life-Balance und Generation Y Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe der Arbeit, beleuchtet die Merkmale der Generation Y und erläutert die Besonderheiten von Gleitzeit- und Vertrauensarbeitszeitmodellen.
- Kapitel 3: Methodik Kapitel 3 beschreibt die methodischen Grundlagen der Seminararbeit, insbesondere die Verwendung von narrativen Interviews und die Gütekriterien qualitativer Forschung.
- Kapitel 4: Thematische Ergebnisse In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Interviews präsentiert und analysiert, um Einblicke in die Erfahrungen der Interviewpartner mit verschiedenen Arbeitszeitmodellen und deren Auswirkungen auf die Work-Life-Balance zu gewinnen.
Schlüsselwörter
Generation Y, Arbeitszeitmodelle, Work-Life-Balance, Gleitzeit, Vertrauensarbeitszeit, Selbststeuerung, Selbstorganisation, qualitative Forschung, narrative Interviews
- Quote paper
- Elisa Birke (Author), 2018, Auswirkungen unterschiedlicher Arbeitszeitmodelle auf die Work-Life-Balance der Generation Y, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/463879