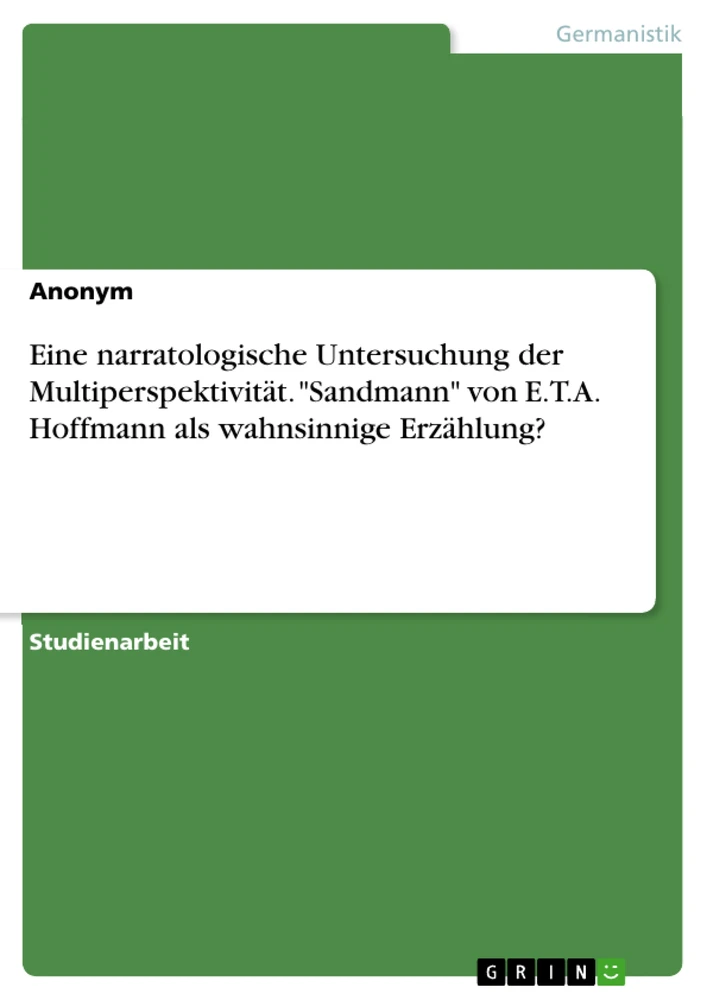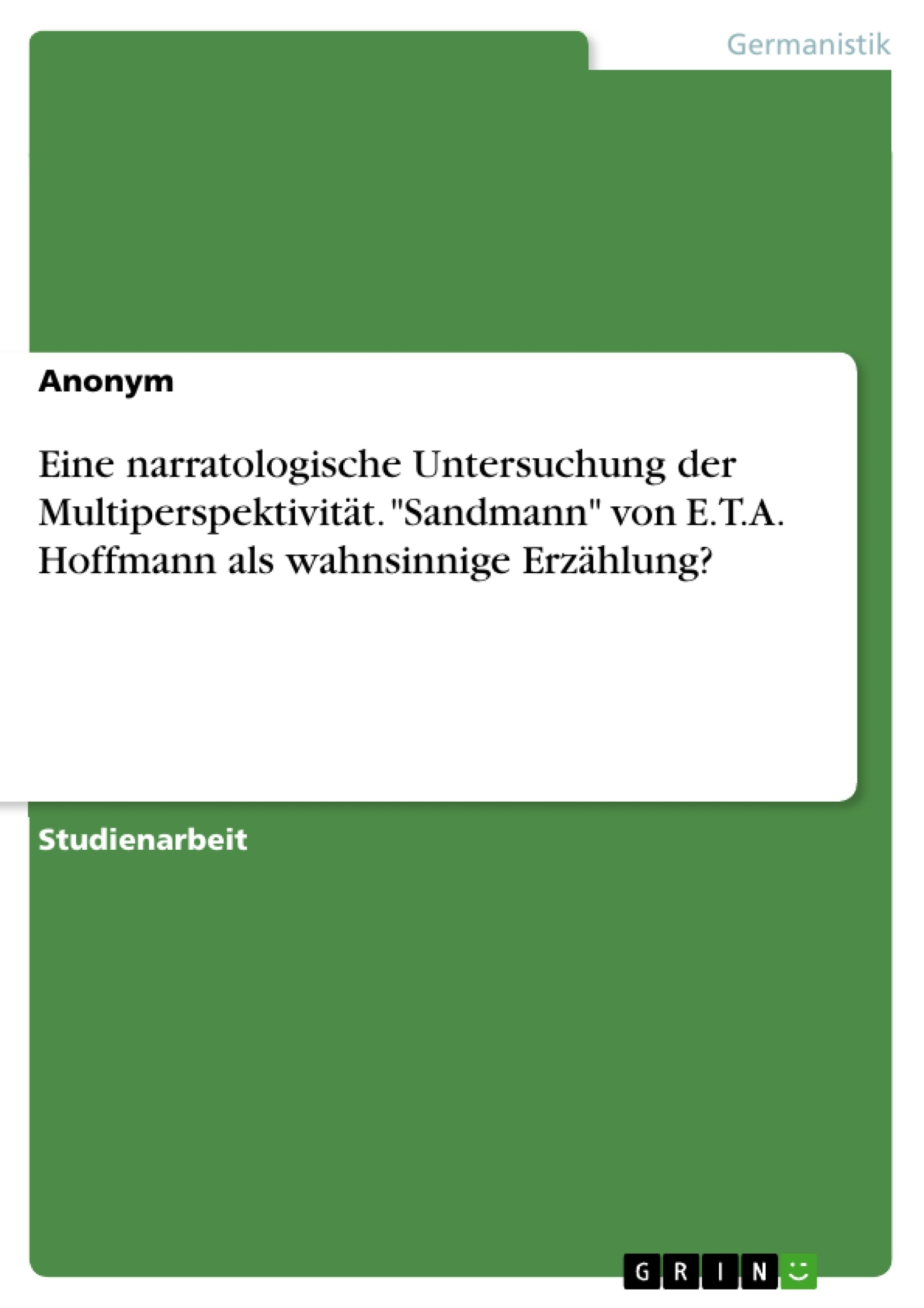"Der Sandmann": Traditionell assoziiert man mit dem Titel ein gutmütiges Sandmännchen, das abends Kindern Schlafsand in das Auge streut und sie somit zum Träumen bringt. Der Titel „Der Sandmann“ bei E.T.A. Hoffmann allerdings beschreibt eine „grausame Gestalt des Ammenmärchens“. Während der Leser mit einer harmlosen Gutenachtgeschichte rechnet, beginnt das Werk mit einer traumatischen Schauergeschichte eines ängstlichen Studenten Namens Nathanael. Mit dem 1816 erschienenen Werk der Romantik wird die Hoffmann’sche Sammlung seiner Nachtstücke eingeführt.
Die erste Verwirrung wird somit bereits mit dem Titel des Werkes verursacht, da dieser Erwartungen evoziert, die durch die Erzählungen nicht erfüllt werden. E.T.A. Hoffmann galt nämlich als „großer Meister der verwirrenden Erzählstrategien […], der ganz bewußt die geordneten Erzählstrukturen destruierte, um neue Ausdrucksmöglichkeiten zu schaffen.“
Die durch die erste Verwirrung geschaffene Ambivalenz zieht sich, unter anderem auch durch die auftauchende Multiperspektivität, durch den ganzen Verlauf der Erzählung. Hoffmann wechselt zwischen verschiedenen Fokalisierungstypen und schafft damit Unbestimmbarkeiten, weshalb seinem Werk so starkes Interesse entgegengebracht wurde. Im „Sandmann“ werden mit diesem Wechsel zwei Welten erzeugt: Die innere Welt des Protagonisten Nathanael, der durch das Auftauchen des Wetterglasverkäufers Coppola an sein Kindheitstrauma um Coppelius erinnert wird und die beiden als ein und dieselbe Person sieht. Daneben wird vom Erzähler eine äußere Welt erzeugt, die die Identität der Charaktere ablehnt und die Geschehnisse rational zu erklären versucht.
Um der Frage nachzugehen, welches diesen „Dualismus der Wahrnehmung“ bewirkt, werden die verschiedenen Lokalisierungen in der Erzählung untersucht. Bewusst wird mit dem Begriff der Fokalisierung gearbeitet. Gérard Genette führte diesen Begriff 1972 in seinem „Discours du récit“ ein und beschrieb damit das Verhältnis zwischen dem Wissen der Figuren einer Erzählung und dem Wissen des Erzählers. Die verschiedenen geschilderten und bewusst gewählten Erzählperspektiven beeinflussen die Wahrnehmung der Realität dieser Erzählung . Durch die multiperspektivische Darstellung und die „abrupten Leseransprachen“ nachdem ausschließlich genau das Innenleben des Protagonisten wiedergegeben wurde, bleibt der Leser im Unklaren, ob das berichtete der Wahrheit entspricht oder dem traumatisch begründeten Wahnsinn Nathanaels zuzuordnen ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Theoretische Grundlage: Fokalisierung nach Gérard Genette
- 2 Wahnsinn oder Realität?
- 2.1 Das Motiv der Multiperspektivität und der Wahrnehmung
- 2.2 Blendung der Wahrnehmung durch Kauf des,Perspektivs'
- 2.3 Der Tanz mit der künstlich schönen Olimpia
- 2.4 Ein letzter klarer Blick durch das,Perspektiv'
- 3 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der narratologischen Analyse der Multiperspektivität in E.T.A. Hoffmanns „Der Sandmann“. Ihr Ziel ist es, zu untersuchen, inwieweit der Wechsel der Erzählperspektive zu einer Verzerrung der erzählten Wirklichkeit führt und wie diese Verzerrung die Wahrnehmung des Protagonisten Nathanael beeinflusst.
- Fokalisierung und ihre Rolle bei der Gestaltung der Erzählperspektive
- Die verschiedenen Fokalisierungstypen in „Der Sandmann“
- Die Konstruktion zweier Wahrheiten: Nathanaels innere Welt und die äußere Welt des Erzählers
- Die Ambivalenz des Titels und die Verwirrung des Lesers durch die Erzählstrategie
- Die Frage nach der Realität und dem Wahnsinn des Protagonisten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Titel „Der Sandmann“ von E.T.A. Hoffmann in den Kontext der Romantik und beschreibt die Ambivalenz des Titels, die Erwartungen des Lesers weckt, die durch die Erzählung jedoch nicht erfüllt werden. Sie erläutert die Bedeutung der Multiperspektivität für die Geschichte und führt den Leser in die Themen der Arbeit ein.
- Theoretische Grundlage: Fokalisierung: Dieses Kapitel erläutert den Begriff der Fokalisierung nach Gérard Genette und seine Bedeutung für die Analyse der Erzählperspektive. Es definiert die verschiedenen Fokalisierungstypen und erklärt, wie diese in der Erzähltheorie eingesetzt werden.
- Wahnsinn oder Realität?: Dieses Kapitel untersucht die verschiedenen Fokalisierungstypen in „Der Sandmann“ anhand ausgewählter Szenen. Es analysiert, wie die wechselnde Perspektive die Wahrnehmung der Ereignisse durch den Leser beeinflusst und welche Rolle der „Dualismus der Wahrnehmung“ spielt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die narratologische Analyse der Multiperspektivität in E.T.A. Hoffmanns „Der Sandmann“. Wichtige Schlüsselbegriffe sind Fokalisierung, interne Fokalisierung, Nullfokalisierung, Wahrnehmung, Realität, Wahnsinn, Erzählperspektive, Verzerrung der Wirklichkeit, Dualismus der Wahrnehmung und Ambivalenz.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Eine narratologische Untersuchung der Multiperspektivität. "Sandmann" von E.T.A. Hoffmann als wahnsinnige Erzählung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/461495